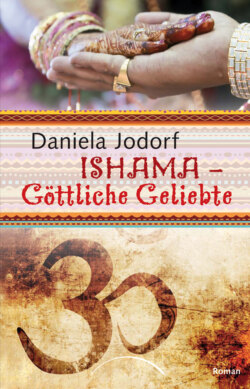Читать книгу Ishama - Daniela Jodorf - Страница 7
Erstes Kapitel
ОглавлениеIch fror. Müde zupfte ich meine provisorischen Handschuhe zurecht: ein Paar alte, durchlöcherte Wollsocken – die einzigen, die ich noch besaß. Alle anderen hatte ich längst verschenkt, fortgegeben an Menschen, die sie nötiger brauchten als ich, weil sie alles verloren hatten. Und doch blieb das schmerzliche Gefühl, nicht genug getan und gegeben zu haben. Eine Müdigkeit hatte von mir Besitz ergriffen, die mich gefühllos und leer machte. Doch schlimmer noch war die Hilflosigkeit, die ich empfand. Seit Wochen war ich die Ereignisse, die mich hierher geführt hatten, jeden Tag aufs Neue im Geiste durchgegangen, hatte sie immer wieder betrachtet wie eine Kette wundersamer innerer Bilder, deren Sinn ich nicht begriff. Was ich auch versuchte, nichts vermochte der Geschichte Bedeutung oder Leben einzuhauchen – mein Leben. Frankfurt war über fünfeinhalbtausend Kilometer entfernt von Pakistan und doch so nah. Längst Vergangenheit, aber in meinen Gedanken noch immer lebendige Gegenwart.
... Nichts hatte an diesem Morgen vor drei Monaten darauf hingedeutet, dass eine Veränderung bevorstand. Der Tag in der Klinik hatte begonnen wie jeder andere zuvor. Erst in dem Moment, als ich die Patientin auf dem Behandlungstisch liegen sah, die nach einem Verkehrsunfall in die Notaufnahme eingeliefert wurde, erlebte ich etwas völlig Ungewöhnliches: intuitives Wissen. Die Patientin würde sterben, das wusste ich plötzlich mit absoluter Sicherheit. Jeder Rettungsversuch wäre nutzlos, ja falsch. Ich durfte nichts tun, damit Frieden den Tod der Frau umgab statt Hektik, Wissen statt Angst, Ruhe statt Panik und Gelassenheit statt des Gefühls medizinischen Versagens. Ich wurde ganz ruhig, extrem bewusst. Ich betrachtete mich aus einer anderen, mir völlig neuen Perspektive, beobachtend statt involviert, neutral statt emotional. Alle Sinne – auch die inneren – waren geschärft. Ich erinnere mich noch genau an meine leise und kraftvoll gesprochenen Worte nach der Untersuchung: „Wir werden nicht operieren!“
Meine Kollegen wurden blass und sahen mich verständnislos an. „Wie, wir werden nicht operieren? Warum?“
„Weil wir für diese Frau nichts mehr tun können.“
„Aber das ist absurd. Sieh dir das Protokoll des Notarztes und die Aufnahmen doch an! Ihr Kreislauf ist stabil. Wir haben nur einen kleinen Eingriff vor. Wir müssen operieren. Das ist unsere verdammte Pflicht, Ellen.“
„Sie wird sterben und wir dürfen sie jetzt nicht aufschneiden! Ihr Herz wird während der OP versagen, weil der Zeitpunkt ihres Todes gekommen ist.“
„Nein, sie wird sterben, wenn wir nicht operieren. Ihr Herz ist vollkommen gesund. Wie kannst du es wagen, einen Patienten aufgrund von bloßen Vermutungen aufzugeben, bevor du alles Menschenmögliche versucht hast?“ Der anfängliche Unglaube meiner Kollegen wandelte sich langsam in Ungehaltenheit. Alle anderen nickten und rückten körperlich sowie emotional ein Stück von mir ab.
„Das ist erst der Anfang“, dachte ich und sah mir interessiert dabei zu, wie ich mich gegen jede medizinische Vernunft und meine Kollegen stellte, weil ich der inneren Einsicht mehr vertraute als den gängigen Regeln, die ich selbst seit über einem Jahrzehnt unhinterfragt angewendet hatte. Jäh und ungebeten riss mich die Intuition aus meiner ärztlichen Routine. „Ich werde diese Frau nicht operieren, weil wir sie nicht retten können. Und ich bitte euch, mir zu vertrauen. Sie wird während der OP an Herzversagen sterben“, wiederholte ich prophetisch und ohne Angst vor den Konsequenzen meiner Worte, während ich vor meinem inneren Auge das zukünftige Geschehen ebenso deutlich wahrnahm wie den gegenwärtigen Streit mit meinen Kollegen.
Eine der OP-Schwestern zögerte. Vielleicht spürte auch sie etwas Ungewöhnliches oder meine klaren, bestimmten Worte hatten die Kraft, sie zu überzeugen. Doch dann traf mich ihr hilfloser Blick. Sie zog die Schultern hoch und ließ sie wortlos fallen.
Mein Assistent reagierte ungewöhnlich ruhig und war offensichtlich um eine einvernehmliche Lösung bemüht. „Ellen! Jeder, der hierher kommt, wird operiert. Das ist sein Recht und unsere Pflicht. Nenn uns eine medizinische Indikation, die gegen eine OP spricht, und wir besprechen den Fall neu.“
„Sie wird sterben. Ob wir operieren oder nicht. Reicht das nicht?“
„Nein, Ellen. Das darf uns nicht reichen, und das weißt du. Niemand kann das zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit wissen. Wir operieren!“ Er blickte fragend in die Runde, um sich der Zustimmung der Kollegen zu versichern. Dann sah er mich an. „Bist du dabei?“
„Nein!“ Das war das deutlichste und einsamste Nein, das ich je in meinem Leben gesprochen hatte. Keiner hätte mich vom Gegenteil überzeugen können. Meine innere Gewissheit besaß eine Überzeugungskraft von allerhöchster Autorität, neben der die fachliche Autorität meiner Kollegen, ja selbst die des Chefarztes, vollkommen verblasste. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, nicht bloß zu funktionieren und meine Rolle zu erfüllen, sondern bewusst zu handeln. Ich war wach und absolut präsent und fand dadurch den Mut, eine sehr persönliche und ungewöhnliche Entscheidung zu treffen.
Die Gruppe wandte sich von mir ab und machte sich für die OP bereit. Nicht ohne vorher unseren Vorgesetzten darüber zu informieren, dass ich meine Arbeit – lebensrettende Arbeit – verweigert hatte. Niemand verstand mein Handeln oder kam auf die Idee, sich schützend vor mich zu stellen. Und das Merkwürdigste war, dass ich das auch von keinem erwartete.
Noch während meine Kollegen im OP glaubten, eine Routineoperation durchzuführen, rief der Chefarzt, Prof. Bauer, mich in sein Büro. Ich hatte ihn noch nie so wütend erlebt.
„Wie können Sie es wagen, Frau Dr. Jansen! Sie wissen, dass Ihr Verhalten Konsequenzen haben wird! Ich erwarte Ihren Bericht, bevor Sie heute das Krankenhaus verlassen. Sie sind beurlaubt, bis wir über Ihren Fall beraten haben.“
Das Telefon klingelte, als ich wortlos sein Büro verlassen wollte. Noch bevor der Professor das Gespräch annahm, wusste ich, dass sich meine Prophezeiung bereits erfüllt hatte. Ich beobachtete jede seiner Regungen. Das Blut wich ihm aus dem Gesicht, und die Hand, die den Telefonhörer fest umklammert hielt, begann zu zittern. Er rang nach Luft und um Fassung. Die Wahrheit meiner Voraussage konnte mir in diesem Moment nicht helfen. Ganz im Gegenteil: Sie bedeutete das Ende meiner ärztlichen Karriere an diesem Krankenhaus...
Ich durfte der Erinnerung nicht zu viel Raum geben, denn hier, in Muzzaffarabad im kaschmirischen Teil Pakistans, wurde ich gebraucht, hier zählten meine ganze Kraft und Aufmerksamkeit. Der Dienst begann um sechs. Jeden Morgen wunderte ich mich aufs Neue, dass der kurze, kalte Schlaf auf einem Feldbett der Bundeswehr, das aus einem deutschen Militärcamp in Afghanistan kam, überhaupt Erholung brachte. In weniger als fünf Minuten war ich mit kaltem Wasser gewaschen, umgezogen und einsatzbereit. Ich traf die Kollegen meiner Schicht im Versorgungszelt. Es gab nicht viel zu essen, doch es reichte, um nicht dauernd durch Hunger von der niemals endenden Arbeit abgelenkt zu werden. Ich nahm einen heißen Kaffee und ein mit Ghee und Zucker gefülltes Fladenbrot. Heimlich steckte ich noch drei Äpfel in meine Kitteltaschen. Sicher würde ich später jemanden finden, der seit Tagen nichts gegessen hatte.
Ich setzte mich zu Ian aus Australien, dem einzigen Kollegen, der nicht ständig von einer Aura der Melancholie umgeben war. Seine bloße Gegenwart ließ mich manchmal denken, dass die Katastrophe, der wir beiwohnten, doch ihre Sonnenseiten hatte und irgendwann enden würde. Ians Humor weckte Hoffnung in mir, die ich selbst nicht aufbringen konnte.
Doch heute wirkte auch er ernst und nachdenklich. „Ich habe letzte Nacht von Jamaika geträumt, kannst du das glauben? Stell dir vor, ich sah mich selbst im coolsten Urlaubsresort, den ich je gesehen habe. Sonne, Surfen, Flirts, Drinks – O Gott, ich wünschte, ich hätte einen Drink ... Es war das Paradies. Ich hasse mich dafür. Ich habe kein verdammtes Mitgefühl.”
Ich schwieg betreten, weil auch ich mich schuldig fühlte. Natürlich halfen wir, das Leid der Verletzten zu lindern und oftmals auch den Schmerz der Hinterbliebenen. Doch wie viele Menschleben konnten wir angesichts der unvorstellbaren Zahl von Todesopfern, die täglich stieg, retten? Fühlten wir wirklich mit den Opfern einer der größten Erdbebenkatastrophen der letzten Jahrzehnte? Mussten wir nicht den Schmerz, den wir täglich miterlebten, von uns fernhalten, um überhaupt helfen zu können? Fast siebzig Prozent von Muzzaffarabad waren zerstört. Beinahe jede Familie hatte einen Angehörigen unter den Trümmern der eingestürzten Häuser verloren. Ganze Schulen waren über den wehr- und hilflosen Schülern zusammengebrochen. Mit jeder Stunde, die verstrich, schwanden die Chancen, weitere Verletzte aus den Trümmern zu bergen. Wie unbedeutend waren mein eigener Verlust und Schmerz im Vergleich dazu.
… Nachdem ich meinen Bericht nüchtern, exakt und chronologisch zu Papier gebracht hatte, war ich nach Hause gefahren, hatte mir einen Kaffee gekocht und mich lethargisch an den Küchentisch gesetzt. Dort saß ich noch bewegungslos, als Niki spätabends nach Hause kam. „Ellen. Schatz! Bist du da?“
„Hier!“
„Wo?“
„In der Küche.“ Mein Blick war ebenso leer wie meine Empfindungen, als Niki hereinkam und mich fragend ansah.
„Hast du gekocht?“
„Nein“, erwiderte ich tonlos.
„Es ist neun Uhr abends. Fehlt dir was?“
„Ich ...“ Ich konnte es Niki einfach nicht sagen.
„Was ist passiert?“ Nikis Hand strich mir sanft über Nacken und Rücken. Seine Berührung erreichte die Oberfläche meiner Haut, aber nicht meine Gefühle. Ich war wie taub, wie unter Schock.
Ich versuchte es noch einmal. „Ich ...“
„Ellen, was ist mit dir?“, fragte Niki nun sehr eindringlich und besorgt. Er kniete vor mir und sah mich beschwörend an. Ich versuchte, seinem Blick auszuweichen und die Tränen zu unterdrücken. „Ich habe heute meinen Job verloren ...“
Niki wurde bleich und rang um Fassung. „Was? Warum? Was ist denn verdammt noch mal passiert?“
„Arbeitsverweigerung!“
Der Druck seiner Hände auf meinen Knien verstärkte sich. „Du bist eine hervorragende Ärztin. Dein Chef hat dich immer protegiert. Du wirst deine Gründe gehabt haben.“
Ja, ich hatte meine Gründe, dachte ich. Doch niemand verstand oder akzeptierte sie, weil sie nicht objektiv waren. Ich hatte bei voller Einsicht in die Folgen meiner Handlung gegen jede ärztliche Ethik verstoßen. Obwohl ich gewusst hatte, dass die Frau sterben würde, hätte ich sie operieren müssen. So waren die Regeln, die ich in der festen Überzeugung, dass das in diesem einen Fall nicht richtig und notwendig war, missachtet hatte...
Ian sah auf die Uhr. „Auf geht’s!“, versuchte er uns zur morgendlichen Visite zu motivieren. Wir gingen gemeinsam mit einer pakistanischen Schwester von Zelt zu Zelt, von Feldbett zu Feldbett, von Patient zu Patient. Wir mussten einfache Worte für unsere Diagnosen und Behandlungen finden, damit die Menschen uns verstanden, auch wenn die Krankenschwester sehr gut Englisch sprach. Die meisten hatten schwere Knochenbrüche und äußere Verletzungen erlitten. Einige hatten ein Bein oder einen Arm verloren, als schwere Trümmer auf sie herabgestürzt waren. Viele hatten Schädelverletzungen, Gehirnerschütterungen und Schädel-Hirn-Traumen, doch diese Verletzungen ließen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausreichend behandeln, weil uns die Diagnosegeräte fehlten. Wir gingen sparsam mit den Schmerzmitteln um, trotzdem überstieg der Bedarf die vorrätigen Mittel. Seit unserer Ankunft leisteten wir rund um die Uhr Erste Hilfe. Selbst eine Woche nach dem Beben fanden die Bergungstrupps noch Schwerverletzte unter den Trümmern und brachten sie zu uns. Inzwischen behandelten wir auch Entzündungen und Folgen falscher Erstversorgung. Wir befürchteten, dass die Anzahl der notwendigen Amputationen in den nächsten Tagen drastisch zunehmen werde.
Auf jeden Kranken kamen mindestens zwei Angehörige, die betroffen und oftmals schweigend an seinem Bett saßen, weil ihr Heim zerstört war und sie keinen anderen Aufenthaltsort hatten als unser Hospital. Auf der Kinderstation lagen zwanzig Waisen, die von niemandem besucht wurden. Jeder Blick dieser dunklen, fast schwarzen Augen, die mich flehentlich ansahen, traf mein Herz in einer mir unbekannten Tiefe. Ian ging mit diesen Blicken locker um. Er scherzte mit den Kindern und klopfte den Erwachsenen jovial auf die Schulter, als kämen sie gemeinsam von einem Kricketspiel. Mir fehlte diese Lockerheit, denn ich wusste einfach nicht, wie ich diesen Menschen Mut machen sollte. Ihr Schmerz lähmte mich. Das erste Mal in meinem Leben schämte ich mich dafür, dass es mir gutging.
Ameen humpelte auf neuen Krücken auf uns zu. Ian hatte sie gestern von einem örtlichen Schreiner abgeholt, dessen Werkstatt glücklicherweise nicht vollkommen zerstört worden war.
„Dakta Mister, Dakta Misses, look, look!” Ameen drehte sich wackelig wie ein kleiner Derwisch im Kreis. Ian fing ihn just in dem Moment auf, als er hinfiel. „Vorsicht, mein Kleiner!“, mahnte er. „Muhtaat!“, wiederholte Schwester Baquiya auf Urdu. Doch sobald Ameen wieder aufrecht stand, tanzte er weiter an seinen Krücken.
Nach der Visite trafen wir uns zur Besprechung des OP-Plans. Für den heutigen Tag waren fünf OP-Stunden angesetzt. Notfälle würden spontan operiert. Zurzeit arbeiteten vier Ärzte, in 12-Stunden-Schichten zu zweit. Dazu kamen vier Schwestern aus Deutschland, Holland, den USA und Kanada sowie vier einheimische Schwestern.
Wir waren die ersten ausländischen Hilfskräfte, die sich bereits am Tag nach der Katastrophe, am 9. Oktober, auf den Weg nach Pakistan gemacht hatten. Ich war erst seit drei Tagen im Einsatz, doch es kam mir vor, als wäre ich nie woanders gewesen. Keine Erfahrung meines Lebens war je so intensiv wie dieser Nothilfeeinsatz in Pakistan.
Die Sonne ging kurz vor sechs unter, und wir arbeiteten dann mit Lampen, die über einen Generator mit Strom versorgt wurden. Die Stadt um uns herum lag im Dunkeln, nur die Lichter der Feuer, um die die Menschen am Abend zusammenrückten, flackerten im Wind. Eine Stadt ohne Licht kann beängstigend sein: Jedes Geräusch erscheint in der Dunkelheit lauter, und für viele bedeutet Dunkelheit Gefahr. Ich hingegen mochte die Dunkelheit und die menschenleeren Straßen von Muzzaffarabad. Obwohl ich nach Dienstschluss müde und erschöpft war, unternahm ich jeden Abend einen kleinen Spaziergang, um mir selbst ein Bild der Lage zu machen und dem Nothilfelager für ein paar Minuten entfliehen zu können.
Sobald das Hospital einige hundert Meter hinter mir lag, tauchten die ersten Gestalten wie Phantome aus der Dunkelheit auf. Ein Junge heftete sich schweigend an meine Fersen, und eine ältere Frau erbat etwas zu essen. Ich schenkte ihr zwei Äpfel, die ich morgens in meine Tasche gesteckt hatte. Als ich dem Jungen ebenfalls einen Apfel anbot, rannte er verängstigt fort. Wieder hatte ich das Gefühl, nichts zu geben zu haben. Im selben Moment fühlte ich mich für den Bruchteil einer Sekunde beobachtet. Mir war, als sähe mich jemand aus der Dunkelheit an, so durchdringend und intensiv, wie ich niemals zuvor angesehen worden war. Mir wurde heiß und schwindelig. War da jemand hinter mir? Kurz wollte ich etwas rufen. Doch dann schwieg ich, weil das Gefühl im selben Augenblick, als ich Luft zum Sprechen holen wollte, nachließ.
Im nächsten Augenblick war der Junge wieder da. Diesmal nahm er den Apfel schüchtern an und verneigte sich höflich. „Shukriya, Dakta. Thank you.“