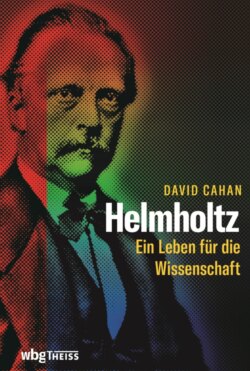Читать книгу Helmholtz - David Cahan - Страница 15
3 Studium der Medizin Das Friedrich-Wilhelms-Institut und Berlin
ОглавлениеIm Herbst des Jahres 1838 schrieb sich Helmholtz an der medizinisch-chirurgischen Hochschule der preußischen Armee ein, dem Friedrich-Wilhelms-Institut, auch bekannt als die Pépinière (vgl. Abb. 3.1). Da diese nah beim Zentrum von Berlin lag, war sie sowohl mit der medizinischen Fakultät der Berliner Universität als auch mit der Charité eng verbunden. Das Institut verlangte für die Unterkunft und das Studium keinerlei Entgelt, aber die Studenten, die aus eher bescheidenen Verhältnissen stammten, mussten sich nach dem Studium für einen bestimmten Zeitraum als Arzt und Chirurg beim Militär verpflichten. Für jedes Jahr am Institut musste ein Student zwei Jahre in der preußischen Armee dienen. Daraus ergab sich, dass nach einem einjährigen Medizinalpraktikum an der Charité und nach Ablegung des medizinischen Staatsexamens acht Jahre Militärdienst zu leisten waren.1
Abb. 3.1:Hofseite des Friedrich-Wilhelms-Instituts in der Friedrichstraße in Berlin, unbekannter Fotograf. Stiftung Stadtmuseum Berlin.
Jeder Student bekam vom Staat eine kleine Beihilfe für Mahlzeiten, allgemeine Bedürfnisse und für den zukünftigen Erwerb von Uniformen und chirurgischen Instrumenten. Helmholtz fand die Mahlzeiten am Institut besser als ihren Ruf, aber weniger nahrhaft als das Essen zu Hause. Das Institut verlangte, dass auch die Eltern einen kleinen finanziellen Beitrag leisteten. Ferdinand gab Hermann acht, später neun Taler monatlich, was ihm ein paar bescheidene Vergnügungen ermöglichte, unter anderem auch ein bis zwei Opernbesuche pro Monat.
Er führte ein einfaches, bescheidenes Leben. Auch wenn das Familienbudget keine großen Sprünge erlaubte, so konnte er sich doch ein Klavier sowie die Dienste eines Burschen leisten, der ihm die Stiefel putzte.2
Das Leben im Institut war durch strenge militärische Disziplin geprägt. Während des Sommersemesters standen die Studenten um 5 Uhr morgens auf (im Wintersemester um 6 Uhr), sie hatten abends um 22 Uhr wieder im Institut zu sein (im Wintersemester um 21 Uhr) und gingen kurz danach zu Bett. Das Betreten und Verlassen der Unterkunft, Ausgänge und Ferien, alles wurde streng kontrolliert. Der Unterricht begann im Sommer um 6 Uhr morgens und im Winter um 7 Uhr, endete um 20 Uhr und wurde lediglich unterbrochen durch eine Stunde Mittagspause. Von den Studenten und dem Lehrkörper wurde auch erwartet, dass sie jeden Samstagabend von 18 bis 20 Uhr eine Gemeinschaftsvorlesung besuchten. Rudolf Virchow, der künftige pathologische Anatom, Anthropologe und liberale Politiker, der sich ein Jahr vor Helmholtz am Institut eingeschrieben hatte, klagte, er könne »kaum eine Stunde zu Vergnügungen benutzen«. Er empfand all die Veranstaltungen am Institut sowie die privaten Studien als »beinahe zuviel«. Nur allzu oft hielten sich manche Studenten nicht an die Regeln. Virchow berichtete seinen Eltern, die meisten seiner Kommilitonen würden die Vorlesungen schwänzen und stattdessen Karten spielen, Bier trinken und vieles mehr. Helmholtz, der ein sehr ernsthafter Student war, missbilligte genau wie Virchow ein derartiges Verhalten. Er beklagte sich auch darüber, dass einige Kommilitonen ihn beim Arbeiten störten. Das Institut hatte sich nicht nur zum Ziel gesetzt, die Studenten in der Medizin zu unterweisen, sondern wollte ihnen auch Pflichtbewusstsein, Gehorsam und Respekt gegenüber Recht und Ordnung eintrichtern.3 Somit wurde hier fortgesetzt, womit Helmholtz’ Eltern, Elementarschule und Gymnasium schon begonnen hatten: Seine Studiergewohnheiten wurden weiter vervollkommnet, und es wurde ihm ein Zugehörigkeitsgefühl vermittelt. Bis zu einem gewissen Grad übernahm er dabei die Wertvorstellungen und Interessen des preußischen Militärs.
Ende Oktober 1838 zog Helmholtz in das Studentenheim des Instituts, das er seinem Vater bis ins letzte Detail beschrieb, wobei sogar der Stellplatz seines Klaviers Erwähnung fand. In diesem Zusammenhang berichtete er auch von der »wahrhaft rasenden Geschicklichkeit« seines Stubengenossen beim Klavierspiel, obwohl er es nicht mochte, dass dieser »colorierte Sachen und neue italienische Musik« spielte. Noch weniger schätzte er das laute Spiel einiger anderer Kommilitonen.4 Für ihn war das Klavierspiel Ausdruck seiner spirituellen Seite; dabei galt seine Vorliebe der klassischen, um nicht zu sagen: der ruhigen, dezenten Musik.
Mit Helmholtz’ erstem Wochenende am Institut begannen auch seine regelmäßigen Besuche bei Verwandten und Freunden in Berlin, das damals 300 000 Einwohner zählte, sowie seine Erkundung der kulturellen Angebote der Stadt. Er besuchte seine Tante Julie von Bernuth, die Tochter von Mursinna und Frau von Louis von Bernuth, der eine hohe Position im preußischen Ministerium des Innern bekleidete. Die Familie wohnte in einem der vornehmsten Wohnviertel Berlins, in der Nähe des Tiergartens, des eleganten öffentlichen Parks der Stadt. Seine Tante kochte für ihn so gut, dass er danach »kaum noch die beiden Treppen zu meiner Stube ersteigen konnte«. Dazu erteilte sie ihm nicht erbetene Unterweisungen in Tischmanieren. »Jedes Mal, wenn ich vom Tische aufstehe, zählt sie alles her, was ich schlecht gemacht habe, und findet, daß ich mich schon etwas gebessert habe.« Ferdinand hingegen befürwortete Julies Unterweisungen in der Etikette. Helmholtz suchte auch Friedrich Gottlob Hufeland und Emil Osann zu Hause auf und wurde von diesen »sehr freundlich« empfangen. Beide Männer waren Professoren am Institut und an der Universität. Obwohl er von ihnen eine Dauereinladung für den Sonntagabend erhielt, ging Helmholtz an diesem ersten Sonntag nicht zu den Osanns, da er sich eine Aufführung des Don Juan ansehen wollte. Er besuchte auch die Familie von Johannes Wilhelm Rabe, einem Porträtisten und Zeichenlehrer, und von Justus Friedrich Karl Hecker, einem maßgeblichen Medizinhistoriker, dem ersten Professor für Medizingeschichte an der Universität und Dekan der medizinischen Fakultät (1839 – 1840). Der Name Helmholtz öffnete ihm Tür und Tor zum Berliner Bildungsbürgertum. An jenem ersten Wochenende in Berlin besuchte er außerdem noch eine Kunstausstellung, auf der er »einige neue Bilder« entdeckte. Doch er bemerkte: »Aber es ist nicht viel dran, das Einzige, was mir mehr gefallen hat, ist eine Jephta.« Trotz dieses betriebsamen ersten Wochenendes hatte er Heimweh: »Ich denke viel an Euch, vergeßt auch Ihr nicht Euren Euch liebenden Herrmann.« Sie vergaßen ihn natürlich nicht und schrieben ihm kurz nach seinem Weggang einen Brief, in dem sie ihm ihre Liebe und Unterstützung versicherten.5
Als in der darauffolgenden Woche die Vorlesungen begannen, war er darüber nicht unglücklich – auch deshalb, weil er nun von allzu vielen Besuchern befreit wurde. »Bisher waren mir diese Gäste oft lästig, besonders wenn ich spielte, verlangten sie oft, ich sollte ihnen Tänze und dergleichen vorspielen.« Den anderen Kommilitonen ging er so gut wie möglich aus dem Weg und meinte, er sei dadurch »in den Ruf der Ungeselligkeit gekommen«. Für vulgäre, wenig intellektuelle Mitstudenten hatte er von Anfang an nichts übrig. Im Semester darauf bekam er einen neuen Zimmergenossen, dessen intellektuelle, kulturelle und künstlerische Aktivitäten ihn beeindruckten. Das war die Sorte Mensch, die ihm lag und die er respektierte. Seinen Eltern versicherte er, sie bräuchten sich keine Sorgen zu machen, dass er »die Musik werde liegen lassen«, denn die neuere Musik, die sein Stubengenosse auf dem Klavier spielte, genüge ihm nicht. »Um tiefere [Musik] zu hören, muß ich selbst spielen; auch ist mir selten der Ausdruck und Vortrag eines andern genügend, ich habe immer weit mehr Vergnügen an der Musik, wenn ich sie selbst ausführe.« Er spielte auch bei seiner Tante Julie, wo er am Wochenende zum Essen eingeladen war. Doch fühlte er sich bei ihr nicht besonders wohl und zog die kultivierteren Osanns vor, bei denen er viel Zeit verbrachte und sich »über Literatur, Studium und allerley« unterhielt. Besonders beeindruckt war er von der Dame des Hauses, Frau Osann, die »in allen Gegenständen der Bildung ausgezeichnet bewandert« sei. Gerne diskutierte er über Kunst. Doch seine Mutter beklagte sich liebevoll darüber, dass er ebenso wie andere Männer »stumm und verschlossen« sei. Sie wollte gern alles über sein Studium und seine Gefühle erfahren und fügte hinzu: »Gott gebe Dir ein, das Richtige zu thun und das Unrechte zu lassen.«6
Ausbildung zum Mediziner und darüber hinaus
Die medizinischen Lehrpläne am Friedrich-Wilhelms-Institut und an der Universität waren im Großen und Ganzen identisch. Gewöhnlich saßen die Studenten des Instituts in denselben Hörsälen wie die Universitätsstudenten, und die klinische Ausbildung erfolgte für beide Gruppen an der Charité. Die sozialen Unterschiede waren auch nicht groß. Das Institut bot eine anspruchsvolle medizinische Ausbildung, die der universitären mindestens ebenbürtig war. Es legte den Fokus auf die klinische, praktische Medizin sowie auf die Unterweisung in den Grundlagen. Der Hauptunterschied zwischen den zwei Lehreinrichtungen (im Hinblick auf die medizinische Ausbildung) bestand darin, dass die Universität ihren Studenten wesentlich mehr Wahlmöglichkeiten zugestand – in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Prinzip der Lernfreiheit, das im deutschen Universitätssystem galt –, während das Institut seinen Studenten einen starren Lehrplan vorschrieb. Es verkörperte sozusagen die direkte Antithese zur Humboldt’schen Vision von Lernfreiheit und Lehrfreiheit als dem Weg, der zu Bildung führte. Zudem war die Universität viel größer: An ihr waren etwa 1600 Studenten immatrikuliert, von denen ungefähr 350 an der medizinischen und 320 an der philosophischen Fakultät (Geistes- und Naturwissenschaften) studierten. Dagegen zählte das Institut lediglich etwa 90 Studenten.7 Etwa um 1840 studierten auch Karl Marx, Ivan Turgenew und Michael Bakunin an der Berliner Universität. Helmholtz traf aber offensichtlich nie auf einen der Genannten oder ihresgleichen. (Siehe Abb. 3.2.)
Genau wie alle anderen Medizinstudenten belegte Helmholtz in den ersten beiden Studienjahren Lehrveranstaltungen in den Grundlagenwissenschaften und, in geringerem Ausmaß, in den Geisteswissenschaften. Abgedeckt wurden Logik und Psychologie, Physik und Meteorologie (bei Karl Daniel Turte und Heinrich Wilhelm Dove); Chemie (bei Eilhard Mitscherlich); Botanik und Naturgeschichte; »Encyclopaedia medica« und Geschichte der Medizin; Osteologie, Syndesmologie und Splanchnologie; Anatomie und Physiologie (bei Johannes Müller) und Embryologie.8 Mitscherlich und Müller zählten in ihrer jeweiligen Disziplin zu den führenden Gelehrten Europas.
Im ersten Studienjahr stand Helmholtz seinem Studium mit gemischten Gefühlen gegenüber. Er schrieb seinen Eltern, »unsere Collegia gehen lustig vorwärts«, aber er empfand das Lernen als sehr zeitaufwendig und beklagte sich darüber, wie mühsam es sei, »oft des Abends zu sitzen und Muskeln über Muskeln zu lernen, daß uns der Kopf raucht«. Mit der Anatomie konnte er sich nie anfreunden, da es ihm eingestandenermaßen schwerfiel, in der Flut von Fakten Ordnung zu halten. Er fand Mitscherlichs Chemievorlesungen zwar »sehr interessant«, aber auch »zum Sticken voll« und »ein ganz klein Wenig langweilig«. Die Chemie konnte ihn nie so richtig begeistern. Und der Botaniker und Naturforscher Heinrich Friedrich Link litt nach Helmholtz’ Einschätzung an einem »Überfluß von Geist«. Sechs Wochen nach Beginn der Vorlesungen in Naturgeschichte sei Link immer »noch bei der philosophischen Einleitung (ach Gott!)«. Müllers Physiologievorlesung gefiel ihm hingegen ausgezeichnet. Dove, ein Experimentalphysiker und Meteorologe, hinterließ ebenfalls einen positiven Eindruck, seine Lehre betrachtete Helmholtz als erkenntnisreich. Insgesamt absolvierte er während einer Woche nicht weniger als 42 Stunden an Vorlesungen. »Das ist militairische [sic] Ordnung«, beklagte er sich.9
Abb. 3.2:Die Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, Unter den Linden. Kreidelithographie von W. Loeillot, um 1840. akg-images.
Trotz dieses anstrengenden Stundenplans fand er Zeit, seinen künstlerischen, philosophischen und gesellschaftlichen Interessen nachzugehen. Seine Eltern ermahnten ihn, das Klavierspiel nicht zu vernachlässigen, obwohl diese Erinnerung gar nicht nötig war: Während der Woche spielte er im Durchschnitt eine Stunde pro Tag, am Wochenende noch länger. Er liebte die Sonaten von Mozart und Beethoven, bewunderte aber auch Gluck. Auch ging er gerne ins Theater und besuchte eine Aufführung von Hamlet (»fürchterlich schlecht gegeben«); er sah sich zudem Carl Maria von Webers bekannte Beziehungskomödie Euryanthe (»ausgezeichnet«) und Faust I an. Er fand, die Aufführung von Goethes Meisterwerk mache »doch einen gewaltigen Eindruck auf alle Hörer, theils durch die göttliche Dichtung selbst, theils durch die ausgezeichnete Darstellung des Mephistopheles ([Karl] Seydelmann) und der Gretchen (Clara Stich)«. Noch nie zuvor habe er derartige schauspielerische Leistungen gesehen, »jener [Mephisto] ebenso satanisch und humoristisch und diese zart und schlicht«. Er studierte »seit einiger Zeit« auch Faust II und war zu dem Schluss gekommen: »Das Ding ist etwas colossal toll.« Er bat Ferdinand, ihm Johannes Falks Goethe-Studie aus der Bibliothek des Gymnasiums zu beschaffen und für ihn bereitzuhalten, wenn er demnächst nach Hause komme. In der Zwischenzeit schrieb er mit einem Freund zusammen selbst ein Stück.10
Helmholtz’ Lektüre war breit angelegt; er las Werke von Homer, Kant, Goethe, Byron und dem französischen Physiker Jean-Baptiste Biot. Er räumte ein, dass er in letzter Zeit den Zugang zu einigen dieser Autoren verloren habe, insbesondere zu Kant, und dass er sich wieder einarbeiten müsse (was er auch tat). »Ist das erst geschehen«, erklärte er seinem Vater, »dann fesseln sie auch mehr; besonders habe ich vom Homer mich kaum wieder losreißen können, sondern in einem Abend immer zwei oder drei Gesänge hintereinander fast verschlungen.« Zur Abwechslung treibe er Integralrechnung.11 Seine intellektuelle Energie und sein Ehrgeiz waren enorm.
Er wurde auch weiterhin in verschiedene Berliner Häuser eingeladen. Bei Geheimrat Langner zum Beispiel lernte er ein paar Jurastudenten kennen und spielte Whist. »Es war eine grandiose Parthie, aber auch grandioser Unsinn«, berichtete er. Als er an einem eisig kalten Tag seine Tante Julie besuchte, schenkte sie ihm ein Paar Handschuhe, »die mir sehr zu Statten kommen bei der jetzigen zarten Witterung«. Er berichtete, er habe »jeden Morgen eine anatomische Repetitionsstunde in einem ungeheizten Zimmer, und das Endchen nach der Anatomie ist auch hübsch ohne Mantel.« Er trug die Handschuhe sogar auf seiner Stube, wo es dermaßen kalt war, dass er nicht schreiben und kaum Klavier spielen konnte. Obwohl er seine Tante Julie weiterhin besuchte, versuchte er doch, einen gewissen Abstand zu wahren, da es zwischen ihr und der Familie Helmholtz Spannungen gab. Dafür machte er weiteren Freunden der Familie und Verwandten seine Aufwartung: den Rabes, August Spilleke, dem Direktor des Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums und der Realschule in Berlin, und den Hamanns. Gelegentlich kam er für ein verkürztes Wochenende nach Hause. Er fuhr dann entweder mit dem Zug oder ging zu Fuß, was ungefähr fünf Stunden Marsch bedeutete.12
Er nahm sich die Zeit, um sich körperlich fit zu halten: Er ruderte, schwamm und ging zum Fechten. Er betrachtete sich als guten Schwimmer. Im zweiten Semester wurde er gebeten, den Instituts-Bibliothekar zu unterstützen. Obwohl ihm dadurch pro Woche zwei Stunden »verloren« gingen, wie er es ausdrückte, war dies auch »das einzige Mittel zu erfahren, was in der Bibliothek Gutes vorhanden ist unter der unendlichen Menge alter Schmöker«. Bei dieser Arbeit habe er »in unbeschäftigten Minuten die Werke von Daniel Bernouilli, (Jean le Rond) d’Alembert und anderen Mathematikern des vorigen Jahrhunderts mir herausgesucht und durchmustert«. Aufgrund der Lektüre dieser Werke stellten sich ihm einige fundamentale Fragen im Bereich der Physik. »So stiess ich auf die Frage: ›Welche Beziehungen müssen zwischen den verschiedenartigen Naturkräften bestehen, wenn allgemein kein Perpetuum mobile möglich sein soll?‹ und die weitere: ›Bestehen nun thatsächlich alle diese Beziehungen?‹«13 Binnen eines Jahrzehnts sollte er in seinem Aufsatz »Über die Erhaltung der Kraft« Antworten auf diese Fragen geben.
Gegen Ende seines ersten Studienjahrs wurde Helmholtz krank: Mehrere Wochen lang litt er stark unter Diarrhoe und damit verbundenen Blutungen. Als er nach einem Besuch bei den Bernuths »außer meinem gewöhnlichen Pensum an Wein noch des Abends zwei Gläser getrunken hatte«, verschlechterte sich sein Zustand. Am nächsten Tag fühlte er sich in Mitscherlichs Vorlesung matt und hatte »fürchterliche Kopfschmerzen«. Er versuchte, sich selbst zu behandeln, doch ohne Erfolg. Also konsultierte er den Arzt des Instituts, der ihm den Rat gab, zwei Tage lang auf seinem Zimmer Ruhe zu halten. Er war »sehr molestirt«, fühlte sich sehr schwach und »sah ganz grün und gelb aus«. Er war erschöpft und sehnte sich nach einer Auszeit, die er sich dann auch gönnte: Er verbrachte etwa zwei Wochen bei der Familie seines Onkels August Helmholtz. In dieser Zeit las er Schiller, den großen deutschen Dichter und Freiheitsdenker. Es war das erste Mal seit Jahren. Ebenso beschäftigte Helmholtz sich mit verschiedenen Schriften aus der Feder Ludwig Rellstabs, eines Musik- und Theaterkritikers. Er ging ins Theater und spielte Klavier (Mozart, Strauss, Lanner, Czerny, Hünten, Auber, Ross, Bellini und andere, wobei er immer wieder auf Mozart und Cramer zurückgriff, »um meinen geistigen Magen wieder etwas zu stärken«). Er tanzte mit jungen Damen und spielte bei einer improvisierten Party Klavier. Außerdem ging er Segeln. Während des Besuchs bei seinem Onkel August spielte er auch in einer Komödie mit und begleitete seinen Onkel auf einer Geschäftsreise nach Stettin und Swinemünde. Er war beeindruckt von der norddeutschen Landschaft und den Flüssen, insbesondere der Oder und der Region um Swinemünde, wo er segelte und schwamm. »Besonders entzückte mich das Meer durch sein stets wechselndes Farbenspiel, welches aus der durch verschiedene Wolkenschichten dringenden Beleuchtung entstand. Ganz berauscht wurde ich am Abend, wo ich an der Spitze des einen der beiden vom Eingang des Hafens weit in die See hinausgeführten colossalen Steindämme ging und die Brandung beschaute, welche gerade so hoch ging, daß man noch trockenen Fußes auf dem Damme stehn konnte. Zwar war der Wellenschlag den Badegästen nicht stark genug; auf mich aber machten schon diese Wogen einen großartigen Eindruck.«14 Gewässer faszinierten ihn zeit seines Lebens. Auch das Muster von Überarbeitung und Krankheit am Ende eines Studienjahrs, woran sich Erholung und Entspannung im Sommer anschlossen, sollte sich noch häufig wiederholen.
Dieses Mal konnte er sich allerdings nur teilweise entspannen, denn er hatte ein Zoologielehrbuch dabei, um sich auf die bevorstehende Zwischenprüfung vorzubereiten, das Tentamen philosophicum, die erste von insgesamt drei Prüfungen, die alle Medizinstudenten durchlaufen mussten. Bei den anderen beiden handelte es sich um das Fakultätsexamen und das finale medizinische Staatsexamen.15
Als er am 10. Dezember 1839 das Tentamen ablegte, hatte er allerdings anderes im Kopf als die Wissenschaft. Seine Mutter war krank, und er sorgte sich vor allem wegen ihrer »Angst und Anspannung«, denn auch seine Geschwister waren an Scharlach erkrankt. Während es den Kindern schnell wieder besser ging, erholte sich die Mutter nur langsam. Er schrieb nach Hause, dass er die Prüfung mit »ziemlich gut« in Mineralogie, mit »sehr gut« in Logik, Psychologie, Physik, Zoologie und Botanik und mit »vorzüglich gut« in Chemie bestanden hatte. Seine Gesamtnote war ein »gut«. Er prahlte: »Übrigens war mein Zeugniß von uns Vieren [mit denen zusammen er die Prüfung abgelegt hatte] das beste.«16 Seine Familie war sehr stolz auf ihn und freute sich über diese guten Nachrichten.
Nach Ablegung des Tentamen erwähnte Helmholtz sein Studium in den Briefen an die Eltern nur noch selten, was auf ein zunehmendes persönliches oder fachliches Selbstvertrauen und eine innere Unabhängigkeit schließen lässt, vielleicht aber auch nur auf sein nachlassendes Interesse am Studium. Dieses war jetzt fast ausschließlich auf die Medizin fokussiert, wenn auch hauptsächlich auf deren theoretischen, nichtklinischen Part. Einige Vorlesungen waren nichts anderes als Diktierkurse: Der Professor las vor und die Studenten schrieben mit. Andere Veranstaltungen wiederum umfassten auch ein paar Experimente (doch nur gelegentlich wurde etwas am Mikroskop demonstriert). Dass die Studenten individuell im physiologischen oder physikalischen Labor arbeiteten, war nicht vorgesehen, allerdings gab es Übungen in Anatomie.17
Auch wenn der Lehrplan starr war, so war er doch nicht rückständig. In den 1830er- und 1840er-Jahren erfuhr das deutsche Medizinstudium nach und nach eine Reform, und in vorderster Reihe beteiligt waren dabei die Berliner Medizinprofessoren. Später bezeichnete Helmholtz diese Zeit als »eine Zeit der Gährung, des Kampfes zwischen gelehrter Tradition und dem neuen naturwissenschaftlichen Geiste, der keiner Tradition mehr glauben, sondern sich auf die eigene Erfahrung stellen wollte«. Auch wenn seine Argumentation ein bisschen rhetorisch und recht reformerisch war, so lag sie gar nicht so weit daneben: Hatten noch im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert verschiedentlich Bewegungen und Theorien wie die Naturphilosophie, der Brownianismus, der Cullenismus, Albrecht von Hallers Irritabilitätslehre oder der Vitalismus im Mittelpunkt gestanden, verschwanden sie doch zwischen 1830 und 1850 allmählich von der Bildfläche. Die große Schwäche dieser früheren Entwicklungsphase in der Medizin beruhte nach Helmholtz’ Meinung darin, »dass sie einem falschen Ideal von Wissenschaftlichkeit nachjagte in einseitiger und unrichtig begrenzter Hochschätzung der deductiven Methode«. Romantische Medizin, wie er und andere es nannten, bestand lediglich aus »Ruinen des alten Dogmatismus«. Zu der Zeit, als er sein Studium an der medizinischen Hochschule begann, war die romantische Medizin (insbesondere die Naturphilosophie) schon lange umstritten, so wie nun auch ihre Nachfolgerin, die (übertriebene) empirische Medizin. Seine Studienjahre fielen zusammen mit dem endgültigen Triumph der theoretisch orientierten Medizin über die eng gefasste empirische Medizin.18
Vermutlich war sein Interesse an den medizinisch und klinisch ausgerichteten Vorlesungen gering. In seinen Briefen nach Hause berichtete er nun hauptsächlich über sein persönliches und gesellschaftliches Leben. Am Ende seines zweiten Studienjahrs unternahm er im Sommer zusammen mit einigen Freunden eine Kutschreise nach Schlesien. Es war heiß und eng in der Kutsche, und er fand nicht alle Mitreisenden besonders sympathisch: »Uns gegenüber saßen zwei Jüdinnen aus Breslau und ein jüdischer Secundaner, der aber aussah u[nd] sich betrug wie ein Sextaner, nicht einen Augenblick still sitzen konnte, und uns den ganzen Weg über die Ohren vollschwazte [sic], während eine der Jüdinnen den ganzen Weg über sich mit ihm zankte, er rammele ihr den einen Arm ganz ein.« Dagegen fand Helmholtz die schlesische Landschaft, die lokale Küche und die Menschen höchst angenehm. Besonders angetan war er vom schlesischen Riesengebirge und dem Hirschberger Tal, das »überall ein romantisches, reizendes, lebendiges Bild« bot.19 Die langen Spaziergänge mit seinen Reisegefährten taten ihm körperlich und geistig gut: Er entspannte sich und wurde gegenüber seiner Umwelt offener.
Nachdem er 1840 die Weihnachtsferien mit seiner Familie verbracht hatte, fand er nach seiner Rückkehr »die Stimmung hier in Berlin […] bedeutend verschlimmert«. Im Juni 1840 war der preußische König Friedrich Wilhelm III. gestorben, und die Berliner hatten, wie andere auch, erwartet, dass sich sein Nachfolger Friedrich Wilhelm IV. als ein liberal gesinnter Monarch erweisen würde, der Veränderungen begrüßte. Stattdessen bekamen sie einen romantischen, nationalistisch gesinnten und höchst konservativen Herrscher, der in einem christlich geprägten deutschen Staat eine Alternative zu den revolutionären Kräften sah, die nach 1789 Europa erschüttert hatten. »Der Romantiker auf dem Thron«, wie man ihn nannte, enttäuschte viele seiner Untertanen. Helmholtz berichtete von einem »Scandal«, als der König die Aufführung einer überarbeiteten Version von Racines religiösem Drama Athalie (1691) forderte, in der Hoffnung, damit bei seinen Untertanen die Frömmigkeit zu wecken. Der König war entzückt von der neuen Version, doch die Zuschauer bedachten die Premierenaufführung mit Pfiffen, und die meisten sahen darin ein Werk der pietistischen Propaganda. Das Ergebnis war, dass der Argwohn der Bürger gegenüber Friedrich Wilhelm IV. weiter zunahm. Helmholtz berichtete seinen Eltern, dass eine Parodie auf das »kleine Göthesche Ständchen« mit dem Refrain »Schlafe, was willst du mehr?« (aus seinem Nachtgesang) im Umlauf sei und man sich damit auf Kosten des Königs lustig mache: »Er betet, was will man mehr?« Helmholtz teilte die allgemeine Verachtung für den neuen König. In seiner Freizeit besuchte er unter anderem die Vorträge des Berliner Sängers, Librettisten und Theaterhistorikers Eduard Devrient.20
Am Ende seines dritten Studienjahrs nahm Helmholtz Kontakt zu Immanuel Herrmann Fichte auf, der als Philosophieprofessor an die Universität Bonn berufen worden war. Sie hatten sich nie zuvor getroffen (oder miteinander korrespondiert). Es war Ferdinand, der den Kontakt initiierte. Er gestand Fichte, dass sich seine eigene Wesensart im Lauf der Jahre wenig geändert habe. Er sei nach wie vor ein zerrissener Mensch und mittlerweile »sehr alt« geworden. Konkret schlug er Fichte vor, entweder Hermann nach Bonn zu schicken, damit er zumindest für ein paar Wochen seinen Paten kennenlernen und sich dessen Gedankengut zu eigen machen könne, oder aber Fichte selbst solle doch einmal nach Potsdam kommen. Ferdinand erinnerte ihn an die Freude, mit der er einst die Geburt seines Erstgeborenen begrüßt hatte, und an das seinerzeit gegebene Taufversprechen. Hermann wiederum schrieb, dass er sich zwar, abgesehen von seinem kindlichen Geschrei bei der Taufe, noch nie an Fichte gewendet habe, dass er aber dennoch das Gefühl habe, ihn zu kennen: So oft habe ihm der Vater von seinem liebsten Freund erzählt. Seit Langem schon stelle er sich zudem das Rheintal als die schönste Gegend in deutschen Landen vor und habe sich immer danach gesehnt, seinen Paten und den Rhein kennenzulernen. Auch hatte er sich vor Kurzem mit einigen Werken von Fichte senior befasst und wollte gern mehr darüber erfahren. Er hoffte daher, Fichte entweder am Rhein oder an Havel und Spree zu treffen. Fast zwei Monate später hoffte er allerdings immer noch darauf, Fichte in Bonn zu besuchen – wozu der ihn eingeladen hatte – und bei dieser Gelegenheit auch noch die Vorlesungen einiger berühmter Professoren an der Bonner Universität zu hören.21
Typhus und ein Mikroskop
Doch aus dem vorgeschlagenen Treffen wurde nichts, da Helmholtz Ende Juli an Typhus erkrankte. Es begann mit Husten und Hämorrhoiden, und er meldete sich bei der Institutsverwaltung krank. Man verabreichte ihm Medikamente und wies ihn an, in seinem Zimmer zu bleiben und sich auszuruhen. Er befürchtete, dass sich seine Mutter große Sorgen um seine Gesundheit machen würde. »Du kannst der Mutter auf mein Ehrenwort versichern«, erklärte er Ferdinand, »daß es durchaus nichts andres ist als das gemeldete, und daß sie sich nicht im Geringsten Sorgen zu machen brauchte«. Vermutlich tat seine Familie ebendies dennoch, zumal er zugegeben hatte, dass er sich in einem »gefahrvollen Zustand« befand. Sein Husten besserte sich zwar, doch er bekam eine schwere Darmgrippe und wurde durch »vieles Schwitzen u[nd] besonders Nasenbluten ganz außerordentlich geschwächt«. Er betonte erneut, dass seine Eltern keinen Grund zur Sorge hätten. Aber natürlich sorgten sie sich weiter um ihren Sohn. Ein Institutsarzt schrieb Ferdinand, dass Hermanns Fieber gesunken sei, sein Appetit zugenommen habe und ein Aderlass Erleichterung gebracht habe, er aber am Institut keine Ruhe finden konnte und deshalb in die Charité verlegt werden musste. Ein anderer berichtete, Hermann leide an »einem gastrisch-katarrhalischen Fieber mit Congestionen zur Brust und zum Kopfe«. Er sei erst am Morgen zur Ader gelassen worden und das habe »den besten Erfolg« gehabt. Auch die verschriebenen Medikamente zeigten die gewünschte Wirkung. Er versicherte der Familie Helmholtz, sie müsse sich keine unnötigen Sorgen machen. Doch eine Woche später war Hermann immer noch in der Charité, hatte nach wie vor Fieber und schlief schlecht, obwohl er allmählich wieder etwas Appetit bekam. Er litt weiterhin unter Nasenbluten, das bei ihm auch früher schon häufig aufgetreten war. Sein Arzt war der Meinung, dass es bald zu einem Wendepunkt im Krankheitsverlauf kommen werde, daher bat er Ferdinand und Lina, ihren geplanten Besuch zu verschieben. Helmholtz pflichtete dem bei. Ferdinand schrieb an Fichte, Hermann befinde sich in Lebensgefahr und sei sogar zu krank, um nach Potsdam zu kommen. Er, Ferdinand, würde sich schon freuen, wenn er ihn in drei Wochen nach Hause holen könnte und Hermann in der Lage wäre, das nächste Semester pünktlich zu beginnen. Sein »armer Junge«, schrieb er, liege mit starkem Fieber darnieder, anstatt ein paar Tage am schönen Rhein zu genießen. Er und Lina erbäten nichts anderes von Gott, als dass er ihnen den Sohn nur nicht wegnehmen möchte, dem sie all ihre Liebe und ihr Verständnis geschenkt hätten und der sich so vielversprechend entwickelt habe. Dazu kam, dass seine Frau sich noch kaum von dem letzten, erst ein paar Wochen zurückliegenden Verlust erholt hatte, als ihr vierjähriger Sohn Johannes Heinrich Helmholtz gestorben war. Und nun musste sie erneut Kummer erleiden. Kurz: Beide Eltern befürchteten das Schlimmste. Bis Mitte September hielt das Fieber an. Helmholtz blieb im Krankenhaus und konnte nur kurze Spaziergänge unternehmen.22
Die Krankheit zog sich zwei Monate lang hin und kostete Helmholtz seine Ferien und das Treffen mit Fichte. Doch sie erwies sich als nützlich für seine berufliche Laufbahn. Da die Studenten des Instituts kostenlos ärztlich versorgt wurden, entfielen seine normalen Ausgaben, und er bewies seine übliche Sparsamkeit: Er legte genug Geld zurück, um sich ein Mikroskop kaufen zu können, das er bei den Recherchen zu seiner bevorstehenden Dissertation benutzen wollte. (Erst in den 1830er- und 1840er-Jahren wurde es üblich, dass Forscher und Institute, die auf dem Feld der Biologie tätig waren, sich ihre eigenen Mikroskope zulegten.) Diese Anschaffung zeigt, wie ernst es Helmholtz mit seinem Bekenntnis zur Wissenschaft war. Er fand das Instrument nicht besonders schön, wie er später erzählte, »doch ich war damit im Stande, die in meiner Dissertation beschriebenen Nervenfortsätze der Ganglienzellen [d. h. der Nerven] bei den wirbellosen Thieren zu erkennen, und [später, im Jahr 1843] die Vibrionen in meiner Arbeit über Fäulniss und Gährung zu verfolgen.« Ferdinand dachte jedoch, der Sohn habe sein Geld verschwendet, und rügte ihn deswegen.23
Dissertation bei Johannes Müller
Helmholtz verbrachte den größten Teil seines letzten akademischen Jahrs mit den vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen. Als sich das Semester dem Ende näherte, standen drei wichtige Ereignisse an. Da waren erstens die Fakultätsprüfungen, die auf Latein erfolgten und acht Bereiche umfassten: Anatomie und Physiologie, Nosologie, Pharmakologie, praktische Medizin, Chirurgie, Geburtshilfe, staatliche Arzneimittelvorschriften und Gerichtsmedizin sowie die Literatur und Geschichte der Medizin. Am 25. Juni 1842 legte er sein Examen ab und wurde damit zur klinischen Arbeit zugelassen. Zweitens feierte das Institut am 2. August sein jährliches Stiftungsfest, zu dem der Prinz von Preußen, weitere Mitglieder der königlichen Familie und des Adels sowie Freunde des Instituts eingeladen waren. Der Direktor des Instituts erinnerte bei dieser Gelegenheit an den Zweck der Einrichtung, stellte deren Leistungen vor und vergab Auszeichnungen an die Studenten. Jedes Jahr wählte er einen Studenten und einen Professor aus, die dann einen Vortrag über ein wissenschaftliches Thema hielten. 1842 fiel die Wahl auf Helmholtz. Sein Thema lautete: »Die Operation der Blutadergeschwülste«. Hinterher hatte er den Eindruck, dass seine damaligen Vorgesetzten den Vortrag »günstiger« als er selbst aufgenommen hatten. Als Belohnung und zur Erinnerung schenkte man ihm einige Bücher, die er lange hoch in Ehren hielt. Doch in Wirklichkeit hatte er nie eine solche Operation gesehen, sein Wissen war »lediglich aus Büchern compiliert«. Seine gesamte medizinische Ausbildung beruhte ja im Wesentlichen auf Buchwissen und gelegentlichen Demonstrationen im Rahmen von Vorlesungen; eine praktische Unterweisung im Labor fand nicht statt. Während seiner ganzen Laufbahn sollte Helmholtz solches reines Buchwissen in den Wissenschaften mit Geringschätzung betrachten. Wie er glaubte, entstand verlässlichere Erkenntnis im Zusammenspiel mit Erfahrung. Die Medizin während seiner Studienjahre sei aber derart theorieabhängig gewesen, behauptete er später, dass oft sogar Fakten ignoriert worden seien. Immerhin schätzte er sein Medizinstudium insofern, als es eng mit den Naturwissenschaften verbunden war. Ja, er vertrat sogar die Meinung, dass die Medizin ihm die »ewigen Grundsätze aller wissenschaftlichen Arbeit« vermittelt habe. Er sei dadurch »zu einer viel breiteren Kenntniss der gesammten Naturwissenschaft« gelangt, »als sie im regelmässigen Wege den Studirenden der Physik und Mathematik zu Theil wird«.24 Zudem bot sie ihm die Möglichkeit, Naturwissenschaften zu studieren und gleichzeitig seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Das dritte wichtige Ereignis in seinem letzten Studienjahr war seine Dissertation. Am 1. Juni 1842 schrieb er seinem Vater, dass er bereits fleißig daran arbeite und schon geglaubt habe, »ein sehr wichtiges Resultat gefunden zu haben«, doch werde er sich »die Sache noch genauer vornehmen«. Er arbeitete also bis Ende Juli weiter, dann begab er sich zu Müller, der seine Dissertation betreute, obwohl er eigentlich Professor an der Universität war. Müller nahm ihn sehr freundlich auf.25
Abb.3.3:Johannes Müller. Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin.
Es war einer der großen Glücksfälle in Helmholtz’ Laufbahn, dass Müller sein Lehrer, Mentor und Gönner wurde. Müller war um die Jahrhundertmitte – eine Zeit, in der die Deutschen ihre physiologische Forschung stark vorantrieben – einer der führenden Köpfe auf den Feldern der Anatomie, Physiologie, Zoologie, Embryologie und Pathologie (vgl. Abb. 3.3). (Humboldt bezeichnete Müller gar als »den größten Anatomen unseres Zeitalters«.) Er war bekannt für seine außerordentlich genaue und produktive Forschung und betonte gegenüber seinen Studenten die Rolle der Physik und Chemie (und des damit verbundenen Instrumentariums) bei der Untersuchung biologischer Phänomene. Seine Berufung an die Berliner Universität 1833 half der Medizin dort, sich von einem rigiden Festhalten an empirischen Phänomenen hin zu einer stärkeren Berücksichtigung der Theorie zu orientieren.26 Die Berufungen des begabten und innovativen Arztes Johann Lukas Schönlein im Jahr 1840 und des ebenso begabten Chirurgen Johann Friedrich Dieffenbach trugen weiter zum guten Ruf der Berliner Universität bei. Die medizinische Ausbildung in Berlin wurde, insbesondere unter der Leitung von Müller und Schönlein, insgesamt wissenschaftlicher. Zumindest in dieser Hinsicht war Berlin in deutschen Landen, wenn nicht sogar in ganz Europa führend.
Müller war vor allem bekannt für seine epochale Arbeit über die Physiologie des Sehens, und ganz besonders für sein Gesetz der spezifischen Sinnesenergien. Sein Handbuch der Physiologie des Menschen (zwei Bände in drei Teilen, erschienen 1833, 1834 und 1840) wurde von Studenten und Kennern des Fachs gleichermaßen gern benutzt. Zweifellos hat Helmholtz es sorgfältig studiert. Er besuchte vier von Müllers Vorlesungen: allgemeine Anatomie, vergleichende Anatomie, pathologische Anatomie und Physiologie. Seine Notizbücher über Müllers Vorlesungen in vergleichender und pathologischer Anatomie lassen vermuten, dass die Vorlesungen strukturiert und klar waren. Die Studenten strömten regelrecht dorthin. Allerdings hatten die meisten der 150 bis 200 (oder mehr) Studenten, die jedes Semester seine Vorlesungen über die menschliche Anatomie und seine Sezierübungen besuchten, keinen persönlichen Kontakt mit ihm. Müller wahrte Distanz. Bei der Sezierübung war er kaum eine halbe Stunde anwesend, um die Übung zu beaufsichtigen. Die meisten Studenten erhielten von ihm keinerlei Unterweisung im Sezieren, nicht einmal eine Einführung. Müllers Vorlesungen über Physiologie boten generell so gut wie keine Demonstrationen, diejenigen in vergleichender Anatomie hingegen schon.27
Dennoch verstand Müller es, seine Studenten zu inspirieren. Er mischte sich auch immer lange genug unter sie, um potenzielle Talente zu entdecken. Eine kleine Schar der Begabtesten lud er dann zum Arbeiten in seine spartanisch ausgestatteten Räume im Theatrum Anatomicum ein, die Mitte der 1830er-Jahre lediglich ein Mikroskop enthielten (vgl. Abb. 3.4). Neben Helmholtz gehörten zu Müllers bekanntesten Studenten Theodor Schwann, Jakob Henle, Robert Remak, Emil du Bois-Reymond, Ernst Brücke, Rudolf Virchow und Ernst Haeckel. Sie alle entwickelten sich zu Kapazitäten auf dem Gebiet der Naturwissenschaften und der Medizin. Manche studierten bei Müller schon vor Helmholtz, andere nach ihm. Wann genau Helmholtz die Bekanntschaft von einigen von ihnen machte, ist nicht bekannt. (Er beendete zum Beispiel gerade seine Dissertation, als du Bois-Reymond, der zu derselben Zeit in Müllers Labor arbeitete, seine ersten Erfolge in Elektrophysiologie verbuchte, doch die beiden hatten sich zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen.) Müller nahm diese und andere vielversprechende Studenten in seinen Kreis auf. Sein undogmatisches Wesen zog sie an, behandelte er doch Theorien als bloße Hypothesen und ließ, laut Helmholtz, allein die Fakten darüber entscheiden, welche Hypothesen richtig waren. Inakzeptabel fand Helmholtz allerdings Müllers vitalistische Ansichten und den damit verbundenen Glauben an eine »Lebenskraft«, die Müller zufolge als eine Art Ordnungsprinzip dem physischen Körper und dessen Funktionen innewohnte, sich aber im Tod auflöste. Auch den Glauben Müllers an eine bewusste Seele lehnte Helmholtz ab. Doch selbst bezüglich dieser Vorstellungen hielt er Müller für undogmatisch und der Faktenanalyse zugänglich. Als Anführer der neuen, experimentellen Richtung in der Physiologie befürwortete sein Doktorvater die Anwendung chemischer und physikalischer Methoden in der anatomischen und physiologischen Forschung, was Helmholtz sehr ansprechend fand. Vor allem gefiel ihm dessen Vorstellung vom Gesetz der spezifischen Nervenenergien, das er später als eine wissenschaftliche Errungenschaft ansah, deren Wert er »der Entdeckung des Gravitationsgesetzes gleichzustellen« geneigt sei.28 Diese Überschätzung spricht für sich selbst: Denn ungeachtet all seines Talents war Müller kein Newton.
Abb. 3.4:Das Theatrum Anatomicum, Universität Berlin, 1841. C. E. Geppert, Chronik von Berlin von Entstehung der Stadt an bis heute, 3 Bde. (Berlin: Ferdinand Rubach, 1839 – 1841), Bd. 3, unpaginiertes Faltblatt.
Ende Juli suchte Helmholtz also Müller auf, um ihm seine vorläufigen Untersuchungsergebnisse über die Nervenfasern bei mehreren höheren Tierarten zu präsentieren und den Stand seiner Dissertation zu besprechen, die sich mit einem Aspekt der Zelldifferenzierung befasste. Angesichts der kurz zuvor vorgelegten Zelltheorie von Schwann, der Dissertation Remaks über Zellfaserverbindungen und der damals gerade sehr aktuellen Verwendung des verbesserten achromatischen Mikroskops für neuroanatomische Studien ist es wahrscheinlich, dass es Müller war, der Helmholtz vorgeschlagen hatte, über den Ursprung der Nervenfasern zu arbeiten. Es ist aber auch möglich, dass Helmholtz eigenständig in Müllers Handbuch auf dieses Thema gestoßen war. Auf jeden Fall schätzte Müller Helmholtz’ Ergebnisse und Belege und erklärte, dass seine Arbeit »von großem Interesse« sei. Andere vor ihm hätten nur vermutet, was Helmholtz bewiesen habe. In diesem Zusammenhang empfahl er aber auch, dass Helmholtz seine Untersuchungen erweitern und über die drei oder vier Tiere hinausgehen sollte, die er bisher studiert hatte, »um ihm [dem Ergebnis] stringente Beweiskraft zu geben«, und bot dafür die Benutzung seiner eigenen Instrumente im Anatomischen Museum an. Sofern Helmholtz es nicht allzu eilig damit habe, seine Promotion abzuschließen, so schlug er vor, solle er die bevorstehenden Ferien für weitere Forschungen nutzen, »um ein vollständiges Kind in die Welt zu setzen, was weiter keine Angriffe zu fürchten hätte« – wie Helmholtz seinen Eltern behutsam erklärte. Es war ein sehr positives und doch zugleich etwas entmutigendes Treffen für ihn. Müller erwies sich als hilfreicher, aber auch anspruchsvoller Ratgeber; in Wahrheit sagte er nur wenig, was Helmholtz nicht schon selbst gedacht hatte. Helmholtz’ Unschlüssigkeit betraf denn auch nur die Verzögerung seiner Promotion, die seine Eltern möglicherweise enttäuschen würde. Er schrieb nach Hause: »Sollte Euch das zuviel Schmerz machen, so schreibt es mir, dann übersetze ich meine Rede, die ich zu Pfingsten hier im Institut gehalten habe, und bin in der nächsten Woche Doctor. Die Leutchen in Potsdam werden vielleicht herauscalculiren, ich sei durch das Examen gefallen, die in Berlin, ich wolle ihnen mit dem Doctorschmaus durch die Lappen gehen, aber beide werden sich zu ihrer Zeit beruhigen. Mir war es eigentlich auch etwas überraschend und nicht ganz recht, aber wie gesagt, ich weiß nichts vernünftiges dagegen einzuwenden.«29
Obwohl er sicher nicht ohne die Erlaubnis seiner Eltern weitermachen wollte und die Verzögerung auch ihn bekümmerte, wusste er natürlich auch, was er für eine erstklassige wissenschaftliche Arbeit zu tun hatte. Doch er konnte und wollte die Bedenken seiner Eltern nicht außer Acht lassen. Zwei Monate zuvor hatte er in seinem Lebenslauf geschrieben: »Gott der Allmächtige hat dafür gesorgt, dass sie [die Eltern] am Leben geblieben und wohlauf sind.« Er blieb der liebevolle Sohn, auch wenn er auf höchstem wissenschaftlichen Niveau zeigen wollte, was in ihm steckte. Als er sich dazu entschloss, weitere Forschungen anzustellen, war dies letztlich ein Akt der persönlichen Selbstverleugnung und eine energische Behauptung seines wissenschaftlichen Selbst.30 Und einer der ersten und stärksten Indikatoren dafür, dass er für die wissenschaftliche Forschung brannte.
Aufbauend auf früheren neuroanatomischen Arbeiten beobachtete Helmholtz in seiner Dissertation, dass in den Ganglien von wirbellosen Tieren die Axone von den Zellen ausgingen. Seine Studie schloss sich damit der gerade aufkommenden neurowissenschaftlichen These an, dass Nervenfasern die Fortsätze von Nervenzellen sind. Er schrieb und verteidigte seine Dissertation auf Latein. Als er sie fertiggestellt hatte, war er allerdings bereits als Unterarzt an der Charité tätig. Wie bei den allermeisten Kandidaten war das Risiko, noch durchzufallen, nämlich äußerst gering: Gewöhnlich wurde die Verteidigung einer Dissertation erst am Tag zuvor angekündigt, und die Schrift selbst war ebenfalls erst zu diesem Zeitpunkt verfügbar. Zudem wurden die »Opponenten« aus dem Freundeskreis des Kandidaten gewählt. Am 2. November 1842 verteidigte Helmholtz also erfolgreich seine Dissertation, erhielt sein Diplom und war jetzt Doktor der Medizin und der Chirurgie.31
Aber er war noch etwas mehr als das: nämlich auch ein Physiologe. Er hatte die letzte Routineerfordernis auf dem Weg zum Doktortitel, die Dissertation, in ein bemerkenswertes Stück Wissenschaft verwandelt und dadurch seine eigentlichen Ambitionen offenbart. Hier verdankte er sehr viel Müller, den er stets als einen überragenden Mann verehrte, »der uns den Enthusiasmus zur Arbeit in der wahren Richtung gab«. Wenn er seinem »grossen Lehrer, dem gewaltigen Johannes Müller« Dank sagte,32 war das mehr als nur bloße Rhetorik.