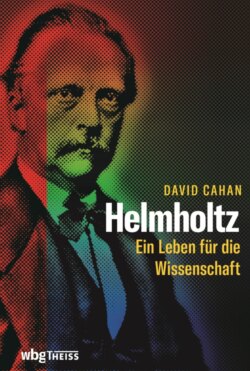Читать книгу Helmholtz - David Cahan - Страница 25
8 Unerfreuliches Intermezzo in Bonn In der Stadt Beethovens
ОглавлениеBonn hatte gegenüber Königsberg gewiss seine Vorzüge. Die Stadt hatte in den 40 Jahren vor Helmholtz’ Eintreffen im Jahr 1855 bedeutende Veränderungen erlebt. 1815 wurde das Rheinland – und mit ihm Bonn – infolge des Wiener Kongresses zu einem Teil Preußens. Mitte der 1850er-Jahre zählte die Stadt etwa 20 000 Einwohner und wurde in das expandierende deutsche Eisenbahnnetz eingebunden, was das Reisen erheblich erleichterte. Vor allem wurde Bonn, begünstigt durch seine Lage am Rhein und das milde Klima, auch zu einem kulturellen Zentrum, dessen größter Schatz die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (1818 von Friedrich Wilhelm III. von Preußen gegründet) war. Sie verband das Rheinland mit dem Hohenzollern-Regime. Und obgleich die jüngste aller deutschen Universitäten, war Bonn doch um die Jahrhundertmitte bereits eine Universität von mittlerer Größe und einigem Ansehen (vor allem für ihre historischen und philologischen Disziplinen). Bonn war zudem Sitz der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde, bei der Helmholtz mehrfach Vorträge halten sollte. Er publizierte auch in ihrer Zeitschrift und wurde schließlich sogar ihr Vorsitzender. 1845 erhob Bonn in einer Art Imagekampagne den Anspruch, die Stadt Beethovens zu sein – sie war der Geburtsort des Komponisten (1770) und über lange Jahre hinweg (bis 1792) seine Heimat –, errichtete ein Standbild des großen Sohnes und rief ein alljährliches dreitägiges Musikfest ins Leben. Für Helmholtz schien Bonn perfekt zu sein.
Abb. 8.1:Helmholtz im Jahr 1857. Lithographie von Rudolf Hoffmann (1857) von einer Photographie von Schallenberg in Bonn. bpk / DeAgostini / New Picture Library.
Somit sah seine Zukunft glänzend aus, als er sich Ende Juli 1855 von Königsberg in Richtung Bonn aufmachte. Seine akademischen Leistungen hatten ihn, kurz vor seinem 34. Geburtstag, zu einem führenden Vertreter der deutschen Wissenschaft gemacht und ihm internationales Ansehen verschafft. Er hatte eine liebevolle Familie und allen Grund zu der Annahme, dass das milde rheinische Klima die Krankheit seiner Frau lindern, wenn nicht sogar heilen würde. Folglich gab es keinen Anlass zu der Vermutung, dass die kommenden drei Jahre in der Beethoven-Stadt die schwierigsten seines beruflichen Lebens werden würden. (Siehe Abb. 8.1.)
Die erste Augusthälfte verbrachte Helmholtz damit, Bonn, Kreuznach, Heidelberg und Berlin zu besuchen, wobei er die ganze Zeit in Sorge um Olgas Husten, Käthes chronischen Schnupfen und seine Familie im Allgemeinen war. In Bonn suchte er für sie nach einer Wohnung, traf zwei (von dreien) seiner Anatomiekollegen und machte sich persönlich mit der Lage der dortigen Anatomie und Physiologie bekannt. Das Wohnhaus in ruhiger, grüner Lage, das sein Interesse fand, war als die Vinea Domini bekannt und lag auf einer Terrasse direkt am Rhein, vor dem Koblenzer Tor in der Koblenzer Straße; er fand die Villa »paradiesisch« und mietete eine Hälfte des Hauses an. Helmholtz nahm an, dass Olga hier die beste Aussicht haben werde, die sie je genossen habe. Das Haus war eine elegante Villa mit neun Zimmern und viel Platz für sie beide, ihre Kinder Käthe und Richard sowie für Olgas Mutter. Helmholtz handelte die Jahresmiete auf 250 Taler plus zwei zusätzliche Zimmer herunter. Dass er so hart verhandelte, verdankte sich teilweise dem Umstand, dass er sein Geld zum Kauf neuer Möbel benötigte, die er dann nach durchgeführtem Preisvergleich – er bevorzugte Eichenholz – in Geschäften im nahe gelegenen Köln (wo er sich auch den berühmten Dom ansah) sowie in Bonn und in Berlin erwarb. Mitte Oktober hatte sich die Familie eingelebt und genoss den reizvollen Blick auf den Rhein (siehe Abb. 8.2). Während ihrer ersten Monate dort schien sich Olgas Gesundheitszustand jedoch nicht zu verbessern. Richard ließ sich von der in der Nähe verlaufenden Eisenbahn ganz in den Bann schlagen, und diese kindliche Begeisterung für die seinerzeit aufregendste Technologie überhaupt, Stolz aller liberalen Schwärmer, wurde später sogar zu seinem Beruf. Die Familie lebte bis ins Jahr 1857 in diesem Anwesen und zog dann in ein Haus, das Helmholtz’ Kollegen, dem Anatomen Moritz Ignaz Weber, gehörte und im Universitätsgarten gelegen war. Alles in allem fand Helmholtz Bonn »reizend«.1
Abb.8.2:Helmholtz’ Wohnung in Bonn (1855 – 1857) war die Vinea Domini (das Haus links im Bild). Die oberen vier Fenster rechts vom Mittelturm gehörten zur Wohnung der Familie Helmholtz. Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek Bonn.
Bei seinem ersten Besuch traf Helmholtz seine neuen Kollegen Weber und Budge und lernte die von ihnen aufgebauten institutionellen Strukturen in den Fächern Anatomie und Physiologie aus erster Hand kennen. Budge hatte ihm in seiner Eigenschaft als Ordinarius für Physiologie bereits im Vorfeld geschrieben und ihm mitgeteilt, dass er sich in Bonn isoliert fühle und sich daher sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm freue, dass sie mit- und nicht gegeneinander arbeiten sollten und er ihm bei seinem Umzug nach Bonn behilflich sein wolle. Helmholtz fand ihn zunächst »sehr vernünftig« und zugänglich, obwohl er zugleich das Gefühl hatte, »wie ein toller Pudel herumgeteckelt« zu sein. Beide planten eine gemeinsame Veranstaltung in Physiologie (die sie tatsächlich nie realisierten), und Helmholtz überließ Budge mit Freuden die mikroskopische Anatomie, die Entwicklungsbiologie und die vergleichende Anatomie. Das Institutsgebäude der Anatomie ließ in seinen Augen zwar sehr zu wünschen übrig, aber die Vorbereitungen für einen Neubau waren bereits weit gediehen; es ging gerade darum, ein passendes Grundstück zu erwerben (siehe Abb. 8.3). Das Institut befand sich »in einem schauerlichen Zustande«, und Helmholtz war der Ansicht, dass Budge darin versagt hatte, auch nur die wenigen, unzureichenden Instrumente für die Physiologie instand zu halten. (Der Institutshaushalt sah für seine Veranstaltung in experimenteller Physiologie bloße 54 Taler vor, während es Helmholtz zufolge für eine pädagogisch angemessene Ausstattung etwa 200 Taler bedurft hätte.) Am Nachmittag seines ersten Besuchs begleitete er Budge zu einer Gesellschaft.2 Mit ihm war es ein guter Anfang gewesen.
Bevor er seine Familie aus Dahlem herholte, hoffte Helmholtz, noch William Thomson treffen zu können, der seine kranke Frau Margaret nach Kreuznach, einem Kurort weiter im Südwesten Deutschlands, gebracht hatte. Diese erste Begegnung von Helmholtz und Thomson kam auf die Initiative des Letzteren hin zustande, aber es sei daran erinnert, dass Helmholtz sich schon zwei Jahre zuvor in Glasgow (vergeblich) darum bemüht hatte, ihn zu treffen. Thomson »bedauerte sehr«, dass er nicht zum BAAS-Treffen in Hull gefahren war, um Helmholtz zu sehen, und dass er ihn dann erneut verpasst hatte, als dieser ihn in Glasgow hatte besuchen wollen. Er wusste, dass Helmholtz eine offizielle Einladung zur Teilnahme am bevorstehenden BAAS-Treffen in Glasgow erhalten hatte, und lud ihn »persönlich« ein, verbunden mit dem Angebot, seine Unterbringung für ihn zu arrangieren: »Ich sollte Ihre Anwesenheit als eine der vornehmsten Errungenschaften betrachten, die das Treffen haben könnte.« Er sei »bestrebt« gewesen, seine Bekanntschaft zu machen, seit er »zum ersten Mal die ›Erhaltung der Kraft‹« in Händen gehalten habe. Niemand, nicht einmal Helmholtz’ größte Bewunderer in Deutschland, hatte diese Abhandlung zuvor als sein bedeutendstes Werk bezeichnet. Wie Clausius 1852 ließ Thomson Helmholtz echte Anerkennung als Physiker angedeihen, indem er ihn als hochgeschätzten Kollegen behandelte, der zu abstrakten und theoretischen Problemen der Physik arbeitete. Er gab Helmholtz gegenüber seiner Hoffnung Ausdruck, bald selbst in Deutschland zu sein und ihn dort zu treffen.3
Abb.8.3:Das Bonner Anatomiegebäude. Lith. Anst. v. Henry & Cohen in Bonn.
Helmholtz hatte Thomsons Brief kurz vor seiner Abreise aus Königsberg erhalten und geantwortet, dass es ihm, da er gerade umziehe, unmöglich sei, in diesem Jahr am BAAS-Treffen »in dem durch die großartigste Entwickelung der Industrie so ausgezeichneten Glasgow« teilzunehmen, so gern er auch wolle. Stattdessen hoffte er darauf, Thomson in Kreuznach zu begegnen.4
Am Abend des 6. August traf Helmholtz in der malerischen Stadt Bingen ein – »was genauso aussieht, wie im Stereoskop« – und nahm von dort eine Kutsche ins nahe Kreuznach. Thomsons Jugendlichkeit überraschte ihn: »Ich erwartete in ihm, der einer der ersten mathematischen Physiker Europas ist, einen Mann etwas älter als ich selbst zu finden, und war nicht wenig erstaunt, als mir ein sehr jugendlicher hellblondester Jüngling von ganz mädchenhaften Aussehen entgegentrat«, wie er an Olga berichtete. Margaret Thomson begegnete er nur kurz und fand sie »eine ziemlich hübsche, sehr anmuthige und geistvolle junge Frau, aber in einem jammervollen Zustande« (sie konnte ohne Schmerzen weder gehen, sitzen noch stehen).5 Die beiden Männer hatten damit sowohl die Physik als auch Ehefrauen mit schweren Leiden gemeinsam; es verwundert nicht, dass sie eine starke Zuneigung zueinander entwickelten.
Helmholtz hatte eigentlich geplant, Kreuznach am nächsten Morgen wieder zu verlassen, aber die beiden Männer hatten sich so viel zu sagen, dass er, Olga um Verständnis anflehend, einen weiteren Tag blieb. Von Thomsons intellektuellen Fähigkeiten zeigte er sich beeindruckt: »Er übertrifft übrigens alle wissenschaftlichen Größen, welch ich persönlich kennen gelernt habe, an Scharfsinn, Klarheit und Beweglichkeit des Geistes«, wie er schrieb, »so daß ich selbst mir stellenweise neben ihm etwas stumpfsinnig erscheine.« Thomson erkundigte sich nach elektrischen Drähten für Widerstandsnormale – ein Thema, auf das sie in den folgenden 40 Jahren immer wieder zu sprechen kommen sollten. Helmholtz antwortete, dass er mit Kirchhoff darüber gesprochen habe, der ihm mitgeteilt habe, dass er die Drähte, die er für solche Arbeiten verwendet hatte, an Wilhelm Weber in Göttingen weitergegeben habe und dass dieser sie benutzt habe, als er in Leipzig an den elektrodynamischen Maßbestimmungen arbeitete. Er versprach, Thomson über die Ergebnisse von Leipzig aus Bericht zu erstatten. Dieser Besuch in Kreuznach markierte den Anfang einer wissenschaftlich stimulierenden, beruflich vorteilhaften und warmherzigen persönlichen Beziehung zwischen den beiden Männern über 40 Jahre hinweg. Von Kreuznach aus fuhr Helmholtz für mehrere Tage nach Heidelberg, um dort Bunsen und Kirchhoff zu besuchen, dann nach Berlin, wo er sich – in der Hoffnung, seine und die Situation des Instituts in Bonn zu verbessern – an einige Ministerialbeamte wenden wollte, und landete schließlich bei seinen Angehörigen in Dahlem.6 Von dort aus reisten sie als ganze Familie in ihre neue Heimat Bonn.
Wie in Königsberg, so baute die Familie Helmholtz auch in Bonn einen engen Freundeskreis auf, der zum größten Teil aus Historikern und Philologen bestand. Helmholtz war der Meinung, dass die »bedeutendsten« Bonner Fakultätsmitglieder in diesen Disziplinen tätig seien und dass, mit der Ausnahme der Geologie, die Naturwissenschaften dort »etwas stiefmütterlich« behandelt würden. Zu ihren Freunden zählten der Philologe, Archäologe, Kunst- und Musikhistoriker Otto Jahn, Verfasser eines vierbändigen Werks über Mozart, Ernst Moritz Arndt, ein liberaler und nationalistischer preußischer Patriot, Historiker und Dichter, Klaus Groth, Dichter, Homme de lettres und Linguist, der Historiker und Politologe Friedrich Christoph Dahlmann, Moritz Naumann, der Spezialist für klinische Medizin, Karl Otto Weber und Wilhelm Busch, beides Chirurgen an der Universität, sowie Heinrich Eberhard Heine, außerordentlicher Professor für Mathematik. Busch war der einzige aus dem Kreis der Ärzte oder Wissenschaftler, zu dem Helmholtz in Bonn ein engeres Verhältnis entwickelte. Seine Familie empfing auch Besucher aus dem Ausland, darunter mehrere englische Familien und den Niederländer Donders, der ein enger Freund von Helmholtz wurde. Regelmäßig war ihr Haus voll von intelligenten, gebildeten Gästen und guter Musik.7
Helmholtz baute in seiner Bonner Zeit noch eine weitere, außergewöhnlich zu nennende Beziehung auf. Im November 1856 hatte ihn nämlich der junge Mathematiker Rudolf Lipschitz, der in Königsberg (bei Neumann) und Berlin (bei Peter Gustav Lejeune Dirichlet) studiert hatte und dann Gymnasiallehrer in Elbing geworden war, um Rat ersucht, da er Privatdozent an einer Universität werden wollte, vielleicht in Bonn oder Königsberg. Helmholtz hat ihn bei diesem Vorhaben unterstützt, zum einen deshalb, weil er und Olga ihn von Königsberg her kannten – auch Lipschitz war ein großer Musikliebhaber und zählte verschiedene Künstler zu seinen Freunden –, und zum anderen (wahrscheinlich) auch, weil Lipschitz Mathematik studiert hatte und enge Beziehungen zu Berliner Mathematikern unterhielt. Er hegte umfassende mathematische Interessen, war ein Experte und bald auch einer der Vorreiter in der linearen Algebra, den Differentialgleichungen, der Differentialgeometrie und in der mathematischen Physik und wurde zudem ein bemerkenswerter Vertreter der Berliner Mathematikschule, die in Opposition zu ihrer Erzrivalin in Göttingen stand, wo Gauß und dessen Nachfolger regierten.8
Helmholtz erklärte Lipschitz, dass die Mathematik in Bonn durch zwei ordentliche Professoren vertreten sei: Plücker (für Mathematik und Physik) und Beer (für mathematische Physik). Plücker hielt er für einen fähigen Mathematiker, der jedoch seine Grenzen habe, vor allem von seinem Karrierestreben angetrieben werde und seine begabteren und analytischeren Kollegen fürchte. Beer hielt er für angenehmer und ehrenwerter, aber auch für nicht sonderlich ehrgeizig und, wie Plücker, für einen an der Geometrie (und folglich nicht an der Analysis) interessierten Mathematiker. Aus diesen Gründen war er der Meinung, dass Bonn einen an der Analysis orientierten Mathematiker wie Lipschitz gebrauchen könnte, und ermutigte ihn, sich dorthin (und nach Halle) zu bewerben. Das Bonner Umfeld war, wie er ihm mitteilte, »reizend« und die Fakultät »vornehm« und »die grosse Gesellschaft steif und luxuriös«. Die Familie Helmholtz würde es, kurzum, sehr begrüßen, wenn Lipschitz nach Bonn käme und sich ihrem »Cirkel von norddeutschen Seelen« anschlösse. Lipschitz entschied, sich in Bonn zu habilitieren, und bat Helmholtz um eine Mitteilung an Beer, dass er hoffe, nach Ostern dort mit seinen Vorlesungen beginnen zu können. Ende März 1857 überreichte Helmholtz ihm eine detaillierte Liste der Schritte, die ein Kandidat zu befolgen hatte, und teilte ihm mit, dass seine Bewerbung um eine Habilitation in Bonn gut vorankomme. Zugleich warnte er ihn jedoch davor, dass sich Plücker »misstrauisch« gegen ihn, Helmholtz, aufführe, weil er »viel […] verkehrt habe« mit dem Mathematiker Heine, der vorher in Bonn und jetzt in Halle war. Er freue sich darauf, Lipschitz in Bonn zu sehen, teils ihrer alten Freundschaft wegen, teils aber auch, weil er »einen mathematischen Rathgeber« brauche. Ebenso freue er sich darauf, ihn als Gast in seinem Haus zu begrüßen, hielt es aber für am besten für Lipschitz, wenn sie Plücker nichts von ihrer freundschaftlichen Beziehung wissen ließen. Im April 1857 habilitierte sich Lipschitz erfolgreich in Bonn. Die Unterstützung durch Helmholtz war dabei nach eigenem Bekunden »von außerordentlichstem Werth« für ihn gewesen. Niemand sonst habe so viel für ihn getan wie Helmholtz. Plücker konnte oder wollte nicht helfen, während sich Beer allerdings etwas wohlwollender verhielt; im Unterschied zu Helmholtz waren sie an Lipschitz’ Arbeit jedenfalls nicht interessiert. Dieser beschloss recht bald, sich auf eine freie Stelle als ordentlicher Professor in Zürich zu bewerben, zum Teil auch deshalb, weil er wenig Chancen sah, eine außerordentliche Professur in Bonn zu erhalten, und ersuchte in dieser Angelegenheit erneut um Helmholtz’ Rat. Allerdings wollte Lipschitz eigentlich nicht aus Preußen fortgehen, das, wie er bei dieser Gelegenheit anmerkte, eine vielversprechende wissenschaftliche Zukunft vor sich habe. 1862 ging er als außerordentlicher Professor für Mathematik nach Breslau, kehrte aber zwei Jahre später als ordentlicher Professor für Mathematik nach Bonn zurück.9 Helmholtz und er bauten in Bonn eine stabile Freundschaft auf, die für beide lebenslang wichtig blieb.
Anatomen gegen Physiologen
Die naturwissenschaftlichen Institute der Universität (Botanik, Mineralogie, Zoologie, Chemie und Physik) waren im Poppelsdorfer Schloss angesiedelt und von der Größe und Ausstattung her bescheiden. Helmholtz’ Büro befand sich allerdings anderswo, nämlich im Anatomischen Theater, einem alten Gebäude im Universitätsgarten, das als Sitz der Anatomie, Physiologie und der pathologischen Anatomie diente. Helmholtz machte sich so weit wie möglich von seinen anatomischen Aufgaben frei; entsprechende Übungen überließ er weitgehend dem schon etwas betagten Moritz Ignaz Weber, was dessen akademische Freuden maximieren und seine, Helmholtz’, Leiden minimieren sollte. In Helmholtz’ Bonner Zeit wurde auch ein Lehrstuhl für pathologische Anatomie von der eigentlichen Anatomie abgetrennt und der Chirurgie zugewiesen. Damit war Helmholtz faktisch in erster Linie für die Physiologie zuständig. Zusätzlich bemühte er sich darum, den jungen Göttinger Anatomen Georg Meissner anzuwerben, der ihn noch von weiteren Aufgaben in der Anatomie befreien sollte. Dieser fürchtete aber, dass Helmholtz’ Assistent oder Prosektor zu werden, trotz aller Vorteile eine Verlängerung seiner Studienzeit und seine Abhängigkeit von ihm bedeuten würde, weshalb er die Offerte ablehnte. Unterm Strich bot Helmholtz in Bonn von 1855 bis 1858 in jedem Wintersemester Veranstaltungen zur Sinnesphysiologie und Anatomie an, außerdem zur mikroskopischen Anatomie und experimentellen Physiologie (Sommersemester 1856), zur Entwicklungsphysiologie (Sommer 1857) und zur experimentellen Physiologie (Sommer 1857).10
Helmholtz kam bald zu dem Schluss, dass Budge deshalb Ordinarius geworden war, weil er sich der evangelischen Reformbewegung (der Inneren Mission) angeschlossen hatte, einer Art christlich-sozialistischer Bewegung, die große Unterstützung von Friedrich Wilhelm IV. erfuhr. Er spottete über Budges vor Kurzem erfolgten Übertritt vom Judentum zum Christentum, da dieser, wie er durchblicken ließ, (nur) konvertiert war, um beruflich voranzukommen. Dieses Urteil war alles andere als hochherzig, war Budge doch nach seiner Promotion in Bonn fast ein Jahrzehnt lang als praktizierender Arzt tätig gewesen und hatte sich zu einem Spezialisten für Nervenphysiologie entwickelt. 1846 entdeckte er, dass die Stimulation des Nervus vagus die Herzfunktion beeinträchtigt. Diese Entdeckung, die für die Pathologie und die klinische Medizin von großer Bedeutung war, hatten gleichzeitig allerdings auch die Gebrüder Weber gemacht, und es war vor allem deren Name, der künftig damit in Verbindung gebracht wurde. Ähnliches ereignete sich, als Budge 1853 die Abhängigkeit der Pupillenbewegung vom Nervenzentrum der Medulla oblongata nachwies, wofür er von der Pariser Akademie der Wissenschaften den Prix Monthyon für experimentelle Psychologie erhielt. Seinem Assistenten, dem Engländer Augustus Waller, gelang dann freilich der Nachweis, dass ein Nervenbündel degenerierte, wenn es von seinem Ursprung abgetrennt wurde, und diese Entdeckung überschattete die Budges. Letzterer hatte also durchaus substanzielle fachliche Errungenschaften vorzuweisen, und sein Vorankommen dürfte mehr als seiner religiösen Affinität (beziehungsweise deren Fehlen) geschuldet gewesen sein. Was Weber anging, so beurteilte Helmholtz ihn einen Hauch wohlwollender: »[E]in alter geschickter Prosektor, im Genre von Schlemm, aber zurückgesetzt und gekränkt hat er natürlich keinen großen Trieb zu arbeiten.«11 Helmholtz legte tatsächlich hohe Maßstäbe an.
Das Verhältnis von Helmholtz und Budge verschlechterte sich bald, obwohl du Bois-Reymond meinte, dass Helmholtz ihm gegenüber eigentlich zu konziliant sei, und Ludwig war anscheinend der gleichen Ansicht. Du Bois-Reymond goss noch zusätzlich Öl ins Feuer, indem er Helmholtz gegenüber behauptete, dass Budge im Ministerium das Gerücht verbreite, Helmholtz sei zur Lehre im Fach Anatomie gar nicht fähig, und er wolle mit dem Minister sprechen, um Helmholtz zu »protegieren«. (Brücke hatte ebenfalls gehört, »daß man Dich in Bonn anfeindet«.) Dieses Gerücht ärgerte Helmholtz, der äußerte, es handle sich dabei um »eine reine Erfindung […], die auf die Gesinnung dessen, der sie vorgebracht hat, kein schönes Licht wirft«. Dennoch fand er selbst, dass seine Anatomievorlesungen verbesserungsfähig waren, und hatte auch vor, in der Sache etwas zu unternehmen. Mehrere ihm nicht wohlgesinnte Zuhörer unterzogen seine Vorlesungen einer genaueren Prüfung, was in Ratschläge von der Art mündete, dass seine Einbeziehung von Physiologie und Chemie auf Kosten der allgemeinen Anatomie gehe. Manche Studenten lachten sogar, als er in seiner Vorlesung zur physiologischen Optik über den Kosinus sprach. Einige Kollegen und Studenten in höheren Semestern schätzten seine Vorlesungen jedoch. Helmholtz selbst behauptete, dass praktisch alle Studenten, die Physiologie lernen wollten, von Budge zu ihm gekommen seien. »Dieses Ergebnis, denke ich, beweist schlagend, daß ich in den Vorlesungen über Anatomie mich weder blamiert haben kann noch durch meine Vortragsweise [den Studenten] mißfallen habe.« Also hielt er es für unnötig, das Gerücht zum Verstummen zu bringen, hoffte jedoch, dass du Bois-Reymond in der Angelegenheit mit dem Minister oder mit Schulze reden würde. Immerhin waren die ersten Schritte hin zu einem neuen Gebäude für die Anatomie und die Physiologie bereits unternommen – und er wollte dieses Vorhaben nicht gefährden. Was Budge betraf, so »will ich lieber nicht genauer schildern; die schwachen Seiten der semitischen Nationalität sind in ihm noch zu mächtig, als daß er gegen mich, der ich ihn in seinen pekuniären Interessen verletzt habe und durch dessen Erfolge sein maßloser Eigendünkel vielleicht den ersten heftigen Stoß bekommen hat, gerecht zu denken und zu handeln geneigt sein könnte«. Zwar sprachen er und Budge auch weiterhin miteinander, aber Helmholtz hegte die Hoffnung, dass Budge anderswo eine Stelle offeriert werden würde.12
Tatsächlich erfuhr er, als er 1856 von einer Spätsommerreise in die Schweiz zurückkehrte, dass Budge ein Angebot aus Greifswald angenommen hatte. Das linderte die Spannungen in Bonn natürlich, wie Helmholtz zugab; allerdings bedauerte er, »daß das Ministerium, obgleich überzeugt von seiner wissenschaftlichen Untüchtigkeit, doch Verdienste um die innere Mission hoch genug schätzt, um ihm eine solche Stelle zu geben«. Faktisch hatte er Budge aus Bonn vertrieben. Dessen Fortgang hatte Helmholtz’ Erwartungen sogar noch übertroffen, denn er war überzeugt gewesen, dass keine nichtpreußische Universität Budge je beschäftigen würde und Preußen seine Professoren nur äußerst ungern intern versetze. »Nur die innere Mission konnte glücklich dieses Rätsel lösen.«13 In gewisser Weise hatte ihn also die Religion errettet.
Seine Schwierigkeiten mit Budge haben vermutlich sein Urteil über die Bonner Professorenschaft insgesamt geprägt, die seiner Meinung nach »ein kurioses Treiben« an den Tag legte: »[S]ie suchen weniger durch Wissenschaft zu glänzen als durch ihre Verbindungen mit den Prinzen, was um so mehr auffällt, wenn man aus dem strengen und ehrenhaften Königsberg mit seinen einfachen Sitten kommt«, wie er sagte. Umgekehrt war er selbst der Bonner Fakultät faktisch vom Ministerium vorgesetzt worden, wobei diese seine Talente und seinen Ruf durchaus anerkannte – in jedem Fall ein Umstand, der auch nicht jedem gefiel. Was Weber betraf, so nannte er ihn hämisch »Knochenweber«. Zwar hielt er ihn für einen fähigen Lehrer und hatte ein gutes Verhältnis zu ihm, aber er fand auch, dass es ihm an Forschertalent mangele. Weber selbst erkannte durchaus an, dass er, wie Helmholtz sagte, »höhere Ziele nicht erreichen kann, [doch] ist er als fleißiger Einpauker der ganz gemeinen Anatomie immer ein nützliches Mitglied der Universität«. Seinen anderen (dritten) Kollegen in der Anatomie, Hermann Schaaffhausen, Anthropologe und außerordentlicher Professor des Fachs, charakterisierte er als eine Person, die »die Wissenschaft vom Standpunkte eines reichen Mannes nur als ein Mittel des Amüsements [betrachtet] und als einen Gegenstand über den sich schönrednerische Perioden bilden lassen«. Ihn respektierte Helmholtz genauso wenig wie Budge. Keiner der Männer, auch nicht Weber, kamen seiner Vorstellung von einem wahren (professionellen) Wissenschaftler nahe.14
So fand sich Helmholtz ein Jahr nach seiner Ankunft in Bonn als »der Hauptrepräsentant der Physiologie und menschlichen Anatomie […], welche beiden Fächer ich mit Vergnügen lese«. Das bedeutete, dass das Ministerium von ihm nicht mehr verlangen konnte, dass er mikroskopische und vergleichende Anatomie lehrte, »was mir doch lästig gewesen sein würde«. Erstere hatte er im vorigen Sommer »zu meinem eigenen Unterricht« unterrichtet, und er hatte vor, sie nur im Rahmen einer Lehrveranstaltung zur menschlichen Anatomie erneut zu lesen.15
Auf institutioneller Ebene hatte sich durch Budges Weggang nichts verbessert: Mitte des Jahres 1857 beurteilte Helmholtz das Institut als »alte[s] Schmutzloche« und beklagte »die ewigen Verhandlungen über die Leichenlieferungen, gegen welche die katholische Geistlichkeit im Verborgenen intrigiert und wobei man keine Gelegenheit vorbeigehen läßt, uns möglichst unanständig zu behandeln«. In Bonn besaß er nicht mehr (und vielleicht sogar weniger) institutionelle Kapazitäten für seine Forschung als in Königsberg: An keinem von beiden Orten gab es ein Institut für Physiologie, und in Bonn fehlten sogar physiologische Instrumente. Nahezu seine gesamte eigene experimentelle Arbeit führte Helmholtz zu Hause durch, und die Studenten die ihre eben im Hörsaal. Der Zustand des anatomischen Instituts beschämte ihn so sehr, dass er stets darum bemüht war, Besucher fernzuhalten: Es war »ein Saustall, wo aus dem Schmutz und der Unordnung gar nicht herauszukommen ist«.16