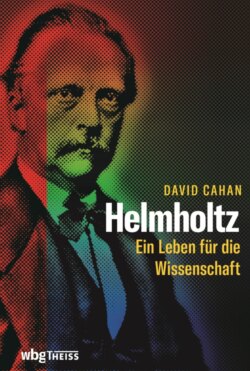Читать книгу Helmholtz - David Cahan - Страница 23
7 Ein neues Zeitalter Die Thermodynamik der Geschichte
ОглавлениеUm 1852/53 machte sich Helmholtz sowohl als Physiker als auch als Physiologe einen Ruf. In Großbritannien wurde sein Satz von der Erhaltung der Kraft neu interpretiert. In Deutschland jedoch stellte Rudolph Clausius, eigentlich ein großer Bewunderer von Helmholtz’ Schrift zur Krafterhaltung, seine bisherigen Ergebnisse infrage. Die Kritik an seiner Arbeit gereichte Helmholtz aber zum Vorteil, denn endlich nahm ihn ein großer deutscher Physiker ernst. Zudem spielte sich ihre Auseinandersetzung auf den Seiten der Annalen der Physik und Chemie ab. Clausius hatte 1850 erstmals Ergebnisse vorgestellt, die sich in den folgenden zwei Dekaden zum Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik entwickeln sollten. Er kritisierte Helmholtz’ Auffassung in puncto Potenzialtheorie, Arbeitsbegriff und Rolle der Zentralkräfte. Geschickt verteidigte Helmholtz jedoch seinen generellen Ansatz von 1847 und gestand die Berechtigung nur kleinerer Kritikpunkte zu (30 Jahre später räumte er auch größere ein).1 Von nun an war die weitere Diskussion des Prinzips der Energieerhaltung ein Thema für Physiker, nicht für Physiologen.
Helmholtz beendete auch seine Studien zur Anpassung der Brechkraft des Auges (Akkommodation), veröffentlichte diese jedoch in einer medizinisch-physiologischen Zeitschrift, die wenige Physiker lasen. Magnus war von dem Artikel sehr beeindruckt und schlug Helmholtz vor, einen weiteren für Poggendorffs Annalen zu schreiben, in dem er seine Ergebnisse zusammenfassen und die Aspekte hervorheben sollte, die für Physiker interessant wären. (Er versicherte ihm, dass Poggendorff einen solchen Artikel veröffentlichen würde.) Außerdem bat Kirchhoff Helmholtz um ein Empfehlungsschreiben, mit dem er sich auf die Physikprofessur in Heidelberg bewerben wollte. In diesem Zusammenhang beurteilte Wilhelm Weber die Veröffentlichungen aus Helmholtz’ Feder anerkennend als physikalisch wie physiologisch wichtig und überaus interessant.2 Die führenden Physiker Deutschlands betrachteten Helmholtz mittlerweile als Kollegen.
Den Winter 1853/54 über konstruierte Helmholtz »neue Apparate für Menschenzeitmessung«, erwartete aber, dass er im Sommer wenig Zeit haben würde, damit zu experimentieren, da er gerade in ein neues, noch unfertiges Labor umgezogen war. Er hatte mit schwierigen Arbeitsbedingungen zu kämpfen und musste für das akademische Jahr 1854/55 zudem noch die Funktion des Dekans der medizinischen Fakultät wahrnehmen. Leider, so schrieb er an du Bois-Reymond, sei »in pekuniärer Beziehung ein Königsberger Dekanat nicht mit einem Berliner zu vergleichen«. Er hatte nicht nur seine Untersuchungen zur Akkommodation fertiggestellt, sondern sandte du Bois-Reymond auch einen kurzen Text zur Leitgeschwindigkeit von Nerven für die Monatsberichte der Akademie und für einen Vortrag vor der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin (am 30. Juni 1854) über die Messung von Vorgängen in Nerven und Muskeln. Für das physiologische Institut in Gießen ließ er einen Myographen bauen, fürchtete aber, dass er in die Hände des Physiologen Eckhard gelangen könnte, der ihm »manches von dem wegnehmen« wolle, was er, Helmholtz, schon entdeckt habe.3 Er wollte sein geistiges Eigentum schützen.
Helmholtz absolvierte den ersten von zahlreichen populärwissenschaftlichen Vorträgen zur Erhaltung der Kraft (Energie) und machte das Thema so in den gebildeten Schichten und darüber hinaus bekannt. Am 7. Februar 1854 hielt er in seiner Funktion als Präsident der Königsberger Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft einen Vortrag unter dem Titel »Ueber die Wechselwirkung der Naturkräfte und die darauf bezüglichen neuesten Ermittlungen der Physik«. Darin sprach er über »ein neues allgemeines Naturgesetz« der Physik, welches »von sehr allgemeinem Interesse« sei. Es betreffe die Beziehungen zwischen allen Kräften der Natur untereinander und sei daher einerseits von Bedeutung, um die Natur in theoretischer Hinsicht zu verstehen, und andererseits »für die technische Anwendung derselben von Wichtigkeit«.4 Letzteres war ein Punkt, mit dem er sicher beim nichtakademischen Teil seines Publikums Anklang fand. Im selben Jahr, in dem Thomson das Thema auf den neuen Namen »Thermodynamik« taufte, rückte Helmholtz es in den Fokus der Öffentlichkeit.
Helmholtz erinnerte daran, dass die Erfinder lange gehofft hatten, sie könnten ein Perpetuum mobile konstruieren; es war eine Art heiliger Gral der Moderne. Sie träumten von einer Maschine, welche die Arbeit von Tier und Mensch übernehmen würde, ohne dabei materielle Ressourcen zu verbrauchen (oder nur in geringem Maße). Einer Maschine, die eine »unerschöpfliche Arbeitskraft« generieren und damit quasi aus nichts Geld machen würde. »Arbeit aber«, erinnerte Helmholtz seine Zuhörer und Leser, »ist Geld«. Womit für ihn feststand, dass das Perpetuum mobile »nur noch von verwirrten und schlecht unterrichteten Köpfen« gesucht werde.5 Seine Analyse zu Maschinen, Arbeit, Kraft und Geld kam zu einem Zeitpunkt, als die Industrialisierung in Deutschland in vollem Gange war. Helmholtz traf damit den Nerv seiner Zuhörer und Leser in Königsberg und anderen wirtschaftlich aufstrebenden Regionen Deutschlands.
Helmholtz führte aus, dass das Kernkonzept einer Maschine in ihrer »Triebkraft oder Arbeitskraft« bestehe, und erklärte, der Wert von Arbeit bestimme sich »zum Theil nach dem Kraftaufwande«. Er erleichterte das Verständnis dieser und anderer abstrakter, mechanischer Konzepte, indem er sie auf konkrete, bekannte Objekte übertrug: Wassermühlen, Eisenhämmer, Wanduhren mit sinkenden Gewichten oder Taschenuhren mit gespannten Federn. Auch damit konnten seine Zuhörer und Leser schnell etwas anfangen.6
Weiter erläuterte er, dass die neuen Erkenntnisse nicht nur deutlich machten, dass ein Perpetuum mobile unmöglich existieren könne. Sie zeigten auch, dass die Erhaltung für alle Kräfte gelte, nicht nur für mechanische, sondern auch für thermische, elektrische, magnetische, Licht- und chemische Kräfte. Und gerade in diesen Bereichen außerhalb der Mechanik liege »der Fortschritt der neueren Physik«. Viele Naturphilosophen und Physiker – er nannte unter anderem Mayer – hatten in der ein oder anderen Form die Behauptung anerkannt, dass jede Kraft sich in eine andere umwandeln ließ. Helmholtz berichtete, dass er in England unter den Wissenschaftlern auf wachsendes Interesse an dem Gesetz zur Erhaltung der Kraft gestoßen war (das bald als Energieerhaltungssatz bekannt wurde und später als Erster Hauptsatz der Thermodynamik). Joule und andere hatten die Theorie experimentell bestätigt, Henri Victor Regnault, »der bedeutendste der französischen Physiker«, hatte sie seinen Untersuchungen zur spezifischen Wärme von Gasen zugrunde gelegt. Auch wenn die Theorie durchaus noch weiterer wissenschaftlicher Belege bedürfe, hielt Helmholtz es nicht für verfrüht, damit vor ein »nichtwissenschaftliches Publikum« zu treten.7
Die große Frage damals war, in welcher Beziehung die Kräfte zueinander standen. Helmholtz erklärte in seinem Vortrag, dass es in der Natur als Ganzer einen Vorrat an Kraft gebe, der sich weder vergrößern noch verringern lasse, und dessen Quantität »ebenso ewig und unveränderlich ist, wie die Quantität der Materie«. Natur war für ihn stets etwas, das es zu untersuchen und verstehen galt, das man aber auch genießen und kommerziell nutzen dürfe: »Der Waldbach und der Wind, die unsere Mühlen treiben, der Forst und das Steinkohlenlager, welche unsere Dampfmaschinen versehen und unsere Zimmer heizen, sind uns nur Träger eines Theiles des grossen Kraftvorrathes der Natur, den wir für unsere Zwecke ausbeuten und dessen Wirkung wir nach unserem Willen zu lenken suchen. Der Mühlenbesitzer spricht die Schwere des herabfliessenden Wassers oder die lebendige Kraft des vorbeistreichenden Windes als sein Eigenthum an.«8 Helmholtz liebte die Natur über alles, aber er war gewiss kein Umweltschützer.
Er fuhr fort, William Thomson habe (auf Basis der Erkenntnisse Sadi Carnots) kürzlich ein Gesetz formuliert, wonach Wärme nur in mechanische Arbeit umgewandelt wird (und auch nur teilweise), wenn sie von einem wärmeren auf einen kälteren Körper übergeht. Dieses Gesetz – später bekannt als Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik – musste erst noch bewiesen werden; Helmholtz glaubte jedoch daran, dass es sich bestätigen würde (er erwähnte Clausius hier nur am Rande). Überlasse man die Kräfte sich selbst, entstehe ein Temperaturgleichgewicht, und ein »vollständiger Stillstand aller Naturprozesse« wäre die Folge, was das Universum »zu ewiger Ruhe« verurteilen würde. Langfristig gesehen drohe der Welt der »ewig[e] Tod« – beziehungsweise, so seine berühmte Formulierung, der »Wärmetod«.9 Es war das erste Mal, dass er den Zweiten Hauptsatz erwähnte, und auch später geschah das nur selten. Ob es vielleicht daran lag, dass seine eigene optimistische Grundhaltung nicht zu einem derlei »negativen« Gesetz passte, das auf Unordnung, Unumkehrbarkeit, Zerfall und Tod hinauslief?
Das Zusammenspiel der Naturkräfte brachte Helmholtz auch dazu, über andere kosmologische Themen nachzudenken. Mithilfe der Krafterhaltung konnte er den »Haushalt des Weltalls« verstehen. Er spielte die Kant-Laplace’sche Urnebelhypothese zur Entstehung des Sonnensystems durch Gravitationskräfte auf verstreute Himmelsmaterie durch und verkündete stolz, Kant habe diese Hypothese »innerhalb der Mauern dieser Stadt« entwickelt. Immerhin räumte er diplomatisch ein, dass Pierre-Simon de Laplace, »der grosse Verfasser der Mécanique céleste«, unabhängig davon zu denselben Schlüssen gekommen sei. Ihre Gedanken boten eine rationale Erklärung für Entstehung und Aufbau der Erde, des Sonnensystems und darüber hinaus, sie führten die Menschheit »aus dem Dunkel hypothetischer Vorstellungen in die Helle des Wissens«. Dennoch handele es sich um eine bloße Hypothese und eine unvollständige kosmologische Idee. Die Wissenschaft sei hier noch zu nah an den alten Legenden der Menschheit angesiedelt und an den Ahnungen poetischer Fantasien. Helmholtz zitierte aus dem Tanach, der Hebräischen Bibel, und aus Goethes Faust, (vermutlich) um strukturelle Ähnlichkeiten zwischen alter und neuer Kosmologie aufzuzeigen.10 Er appellierte an die intellektuelle Toleranz und den Gebrauch der Fantasie.
Aber damit nicht genug. Aus der Erhaltung der Kraft zog Helmholtz Schlüsse, um Phänomene wie Bewegung und Arbeit von Lebewesen, die Auswirkungen der Sonne auf die Erdatmosphäre und geologische Formationen zu verstehen. Was Nahrungsaufnahme und -verwertung angehe, seien organische Wesen wie Dampfmaschinen: Man könne im Prinzip berechnen, wie viel Wärme (oder deren Äquivalent in Arbeit) bei der Verbrennung einer bestimmten Materialmenge im Körper eines Tieres erzeugt werde. Das war tatsächlich ein Beispiel aus dem Lehrprogramm für organische Physik, das er seinen Zuhörern und Lesern da präsentierte. Helmholtz erinnerte sie daran, dass die Pflanzenwelt (beziehungsweise das Fleisch der pflanzenfressenden Tiere) die Nahrungs- und damit Energiequelle für Tiere ist: Die Nährstoffe, die von Tieren gefressen und verbrannt werden, stammen von Pflanzen, und die Pflanzen wiederum leben von den tierischen Verbrennungsprodukten – ein Energiekreislauf. Sollte sich all dies bewahrheiten, ergab sich für Helmholtz daraus, dass alle Kraft ursprünglich von der Sonne herstamme »und dass wir alle an Adel der Abstammung dem grossen Monarchen des chinesischen Reiches, der sich der Sohn der Sonne nennt, nicht nachstehen«. Das gelte gleichermaßen für »alle unsere niederen Mitgeschöpfe, die Kröte und der Blutegel, die ganze Pflanzenwelt und selbst das Brennmaterial, urweltliches wie jüngst gewachsenes, womit wir unsere Oefen und Maschinen heizen«. Wenngleich es derlei biochemische Energiekreisläufe noch zu belegen gelte, wie er eingestand, beinhalteten Helmholtz’ Überlegungen, die fünf Jahre vor Darwins On the Origin of Species (1859; Über die Entstehung der Arten, 1860) angestellt wurden, einen ähnlichen Grundgedanken: Alles Lebendige hängt zusammen. Die dynamische Kraft hinter dem ganzen System war für ihn ganz klar die Sonne mit ihren erleuchtenden und wärmenden Strahlen. Alle Planeten besaßen schließlich eine Atmosphäre, und auf dem Mars, so verkündete er feierlich, gebe es Anzeichen für das Vorhandensein von Wasser und Eis.11
Als Leitfaden durch alles gerade Gesagte hindurch dienten Helmholtz vor allem der Krafterhaltungssatz und das Gravitationsgesetz. »Physikalisch-mechanische Gesetze sind wie Teleskope unseres geistigen Auges; sie dringen in die fernste Nacht der Vergangenheit und Zukunft.« Derlei Gesetze könnten in Verbindung mit empirischen Daten etwa zur Verbreitung von Kulturpflanzen als Ausdruck von Schwankungen in der mittleren Jahrestemperatur Aufschluss über die Erdtemperatur in der fernen Vergangenheit oder auch der Zukunft geben. Denn die Geschichte unseres Planeten zeige, »wie winzig der Augenblick in seiner Dauer ist, der die Existenz des Menschengeschlechtes ausgemacht hat«. Die ganze Menschheitsgeschichte werde auf 6000 Jahre geschätzt, und das sei nichts gegen die Zeiträume, in denen die Erde eine lange Reihe heute ausgestorbener Tier- und Pflanzengeschlechter getragen habe. Von den Geologen werde diese Entstehung organischen (aber noch nicht menschlichen) Lebens auf ein bis neun Millionen Jahre geschätzt. Und diese Zeitspanne sei wiederum klein gegen jene 350 Millionen Jahre, die der aus geschmolzenem Gestein bestehende Erdball einst benötigt habe – wie Versuche zur Abkühlung nahelegten –, um auf 200 Grad abzukühlen. Heute sei Leben geographisch ganz anders auf der Erde verteilt als in der fernen Vergangenheit, und die Menschheitsgeschichte jedenfalls »nur eine kurze Welle in dem Ocean der Zeit«. An dieser Stelle versicherte Helmholtz seiner Zuhörer- und Leserschaft, es werde noch viele Generationen lang Leben auf der Erde geben, sie hätten also nichts zu befürchten. Wie er einräumte (als würde er James Hutton oder Charles Lyell zitieren), seien freilich heute noch dieselben geographischen Kräfte am Werke wie in der Vergangenheit. So wie sie die Erde und ihre Lebensformen in vergangenen Zeiten verändert hätten, würden sie dies auch in Zukunft tun. Das Gesetz von der Erhaltung der Kraft habe der Menschheit eine lange, aber keinesfalls unendliche Geschichte beschert: »Wie der Einzelne, so muss auch das Geschlecht den Gedanken seines Todes ertragen; aber es hat vor anderen untergegangenen Lebensformen höhere sittliche Aufgaben voraus, deren Träger es ist und mit deren Vollendung es seine Bestimmung erfüllt.«12 Helmholtz war wahrhaft kein Pessimist. Er bot eine naturalistische, evolutionäre und nichtchristliche Sicht auf die Erd- und Menschheitsgeschichte. Unter seinen physikalischen Mitstreitern im nördlichen Britannien hätte er damit wohl keine Freunde gefunden.
Der Materialismusstreit
Helmholtz’ Aufsatz über die Wechselwirkung der Naturkräfte wurde sehr positiv aufgenommen – etwa von du Bois-Reymond, der Helmholtz zum Korrespondierenden Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften ernennen lassen wollte. Die Akademie war Helmholtz wohlgesinnt und du Bois-Reymond hoffte, dass sein Vorschlag bald auf positive Resonanz stoßen würde. Tatsächlich sollte es jedoch noch zweieinhalb Jahre dauern, bis Helmholtz im Januar 1857 ernannt wurde.13
Beeindruckt von Helmholtz’ Ausführungen zeigten sich auch Ludwig Büchner, der Philosoph Friedrich Albert Lange sowie Karl von Vierordt. Ernst Haeckel, der 1857 in Wien studierte, wollte die Rede zusammen mit Arbeiten von Jacob Moleschott und Büchner vortragen. Selbst Ferdinand Helmholtz war von dem Text beeindruckt, lobte dessen Inhalt in höchsten Tönen und ausnahmsweise sogar Hermanns Stil, gab aber zu bedenken, dass Natur und Geschichte Ausdruck gottgefälligen Lebens seien. Dass die Schöpfungsgeschichte in der Sichtweise seines Sohnes zu einem Ergebnis universeller thermodynamischer Prozesse wurde, konnte er nicht akzeptieren. Derweil fand Hirst in Großbritannien Helmholtz’ Text eine hervorragende Lektüre, sehr spekulativ, aber dennoch dicht dran an den Fakten. Er war so fasziniert, dass er ihn noch mehrmals zu lesen vorhatte. Tyndall übersetzte den Text für das Philosophical Magazine ins Englische. Auch Thomson las ihn sorgfältig, besonders interessierte er sich für die Ausführungen zur Sonnenwärme und zum Wärmetod. Aber er verwarf Helmholtz’ Hypothese, wonach die Wärme (Energie) der Sonne gravitativer Kontraktion entsprang (und nicht einem Meteoriteneinschlag, wie er und Mayer geneigt waren anzunehmen). Das lag vor allem daran, dass Helmholtz’ Sicht auf der Kant-Laplace’schen Urnebelhypothese beruhte und evolutionärer Natur war. 1861 revidierte Thomson seine Meinung jedoch zugunsten von Helmholtz’ Ansatz, der mit seinem Fokus auf dem Stellenwert der gravitativen Kontraktion inzwischen zur vorherrschenden Meinung bezüglich der Herkunft der Sonnenenergie avanciert war und es lange bleiben sollte.14
Im deutschen Geistesleben wurde gerade eine neue Seite aufgeschlagen, und auch Helmholtz’ Publikation kündete davon. Seit dem Tod von Hegel (1831), Goethe (1832) und Schelling (1841) hatte sich das intellektuelle Leben in Inhalt und Ton deutlich verändert. Die Goethezeit (1770 – 1830) oder, aus philosophischer Perspektive, die Ära des absoluten Idealismus und Romantizismus, war definitiv zu Ende. In den 1830er- und 1840er-Jahren setzte in Deutschland die Industrialisierung ein und die Naturwissenschaften erlebten einen Aufschwung. Hegelianismus und Naturphilosophie standen in der Kritik und wurden schließlich von einer jüngerer Generation Gelehrter und Wissenschaftler beiseitegewischt, die sie als zu spekulativ, zu unempirisch, zu romantisch empfanden. Stattdessen standen Historizismus und empirische Wissenschaft, Materialismus, Mechanizismus und ein neu erwachtes Interesse an Kant im Vordergrund.15 Helmholtz’ Aufsatz baute auf dem auf, was später die ersten beiden Hauptsätze der Thermodynamik werden sollten, und gelangte so zu einem Verständnis der Sonne als Quelle aller Energie. Er betonte den Stellenwert der Wissenschaft, um die Rolle des Menschen in der Natur, die Energiequellen und das Alter des Universums zu ergründen.
Die veränderte kulturelle Atmosphäre manifestierte sich zum einen im Aufkommen der Junghegelianer, deren gelehrte Kritik sich zum Teil auch gegen Hegel selbst richtete. Zu ihnen zählte David Friedrich Strauß, der in Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet (1835) die unhistorische Darstellung der Bibel mit all ihren Wundern hinterfragte und die mythenbildende Funktion des Christentums hervorhob. Auch Ludwig Feuerbach gehörte zu den Junghegelianern. In seinem Das Wesen des Christentums (1841) tat er die christliche Theologie als Projektion der intellektuellen Bedürfnisse des Menschen ab und stellte stattdessen die körperlichen Empfindungen und Erfahrungen in den Vordergrund. Auch wenn keiner dieser beiden Kritiker ein Materialist war wie ihr Kollege Karl Marx, ebenfalls ein Junghegelianer, argumentierten sie doch naturalistisch. Das galt gleichermaßen für die Anhänger des biologischen Reduktionismus (inklusive der organischen Physiker), die Mitte der 1840er-Jahre auf der Bildfläche erschienen und physiologisches Leben auf physikalische und chemische Gesetze herunterbrechen wollten. Natürlich waren sie (wie Helmholtz) Naturwissenschaftler, dazu auch »Mechanizisten«, also Verfechter eines mechanistischen Weltbildes, aber sicher keine Materialisten.
Zum anderen schlug sich die veränderte geistige Atmosphäre im allgemeinen Aufstieg von Naturwissenschaften und Technologie nieder, begleitet vom Aufkommen vielfältiger neuer Institute und sonstiger Bildungseinrichtungen zu ihrer Förderung. Vielerorts hielt man Philosophie jetzt entweder für irrelevant oder für in Widerspruch zu den Naturwissenschaften stehend. Die natürliche und die soziale Welt galten als Gegenstände detaillierter empirischer und dabei immer stärker spezialisierter Studien, nicht als Objekte allgemeiner philosophischer Spekulation. Empirische Forschung wurde besonders von deutscher Seite mit bisher nicht gekannter Intensität und Reichweite betrieben. Empirismus, Naturalismus, Realismus und Materialismus kennzeichneten die damalige Wissenschaft; die Philosophie wurde von den Naturwissenschaftlern ignoriert, angegriffen oder einverleibt.16
Als eine dritte Manifestation des atmosphärischen Wandels bildete sich eine Gruppe von Wissenschaftlern und Medizinern heraus, die nicht unpassend als »wissenschaftliche Materialisten« bezeichnet wurden. Drei von ihnen – Karl Vogt, Jacob Moleschott und Ludwig Büchner – waren besonders erfolgreich in ihrer Polemik und der Popularisierung von Wissenschaft. Durch ihre materialistische Sichtweise sowie ihren allgemeinen intellektuellen und politischen Radikalismus, den sie für naturwissenschaftlich fundiert hielten, trugen sie dazu bei, das öffentliche Verständnis von Wissenschaft zu schärfen. Der Physiologe Vogt war vor allem bekannt für seine Physiologischen Briefe für Gebildete aller Stände (1845 – 1847) und seine Schrift Köhlerglaube und Wissenschaft: Eine Streitschrift gegen Hofrath R. Wagner in Göttingen (1855). Moleschott kam aus der Anatomie und Physiologie (er hatte Helmholtz’ Analyse zur physiologischen Wärme gelesen), wandte sich dann jedoch hauptsächlich der physiologischen Chemie zu. Er machte sich mit Die Lehre der Nahrungsmittel: Für das Volk (1850) und Der Kreislauf des Lebens: Physiologische Antworten auf Liebig’s Chemische Briefe (1852) einen Namen. Büchner war der berühmteste der drei, er stand an der Spitze der materialistischen Strömung im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Politisch war er ein Befürworter der Republik. Sein bekanntestes Werk war Kraft und Stoff: Empirisch-naturphilosophische Studien (1855), das von Klerus und konservativen Kreisen stark angefeindet wurde. Man zwang ihn sogar, seine Lehrposition an der Universität Tübingen aufzugeben. Diese und andere Werke der »wissenschaftlichen Materialisten« verbreiteten sich also im deutschsprachigen Raum und weit darüber hinaus. Sie trugen wesentlich zu der allgemein materialistisch-naturalistischen Atmosphäre bei, die in der Zeit nach 1848 in Europa vorherrschte.17