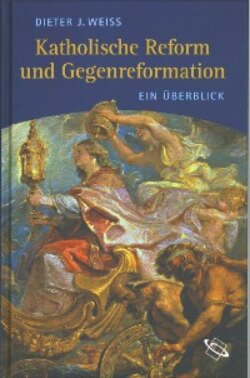Читать книгу Katholische Reform und Gegenreformation - Dieter J. Weiß - Страница 15
Die Frömmigkeitsformen
ОглавлениеDas Spätmittelalter bildete eine Epoche intensivierter Laienfrömmigkeit, wie sie sich in zahlreichen Altar- und Messstiftungen und einer Steigerung des Glaubens an die Heilsnotwendigkeit guter Werke äußerte. Das weite Feld der Laienfrömmigkeit ist schwer zu fassen, doch wendet sich die Forschung diesem Bereich verstärkt zu. Wichtig wurden die sinnliche Erfahrbarkeit der Sakramente, die Betonung der Schau und die bei Sakramentsandachten und Prozessionen zum Ausdruck kam.
Die Visionen der hl. Juliana von Lüttich († 1258) hatten aus Dankbarkeit für die Einsetzung der Eucharistie zur Einführung des Fronleichnamsfestes zunächst in ihrer Heimat geführt. Prozessionen, bei denen der eucharistische Heiland in der Monstranz sichtbar durch die Straßen getragen wurde, waren zunächst kein fester Bestandteil. Auch die hohen Feste des Kirchenjahres, Gebete in Notzeiten und die Engelämter (Messen vor ausgesetztem Allerheiligsten an Donnerstagen) konnten mit solchen Prozessionen verbunden werden. Die Übernahme des Fronleichnamsfestes erfolgte in den einzelnen Diözesen, Kirchen und Orden zu unterschiedlichen Zeitpunkten, weitere Verbreitung gewann es in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.
Kirchen, aber auch Einzelpersönlichkeiten häuften Reliquienschätze an, wie in Halle oder in Wittenberg die Sammlung Kurfürst Friedrichs des Weisen von Sachsen (1463 –1525). Weisungen, bei denen sie den Gläubigen etwa in Aachen, Trier oder Nürnberg zur Verehrung gezeigt wurden, fanden wie neu aufblühende Wallfahrtsorte ungeheueren Zulauf. Während des Spätmittelalters entstanden zahlreiche Hostien- und Heilig-Blut-Wallfahrten wie nach Andechs, Wilsnack oder Walldürn. Advents- und Osterspiele verdeutlichten den Gläubigen die Heilsgeschichte.
Bußprediger wie Johannes von Capestrano (1386 –1456) fanden massenhaft Zuhörer. Ein zentrales Motiv bildete die Angst vor dem „jähen“, dem nicht durch den Empfang der Sterbesakramente vorbereiteten Tod und damit die Gefahr ewiger Verdammnis. Überlebensgroße Christophorus-Darstellungen an den Kirchen sollten davor schützen, artes moriendi (Bücher zur Vorbereitung auf einen christlichen Tod) wurden geschrieben und Seelstiftungen ergingen in großem Umfang. Priester und Laien schlossen sich in Bruderschaften zu Gebetsverbrüderungen, zur Sorge für christliche Begräbnisse, zur Abhaltung von Seelenmessen und zu karitativen Zwecken zusammen.
Die Intensivierung des religiösen Lebens weckte Forderungen nach einer Steigerung der Seelsorge an den Klerus, die dieser oft nicht zu erfüllen in der Lage oder willens war. Die Gläubigen wünschten Predigten und eine stärkere geistliche Betreuung. Die Frömmigkeitshaltung wurde durch das Ringen um das eigene Seelenheil von einem Hang zum Individualismus begleitet. Martin Luther traf mit seinen Reformforderungen eine in weiten Kreisen latent vorhandene Stimmung und artikulierte mit seiner Fragestellung um einen gnädigen Gott ihre Sorgen.