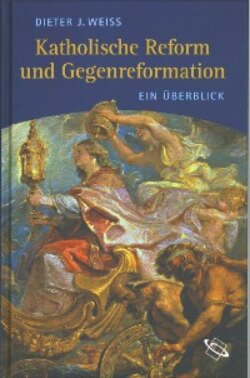Читать книгу Katholische Reform und Gegenreformation - Dieter J. Weiß - Страница 17
Die Erneuerung in Spanien
ОглавлениеWilhelm Maurenbrecher setzte den Beginn der kirchlichen Reform in Spanien an. In den spanischen Königreichen entstand an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert im Zeichen des Sieges über die Muslime (Reconquista) ein streng katholisches Staatskirchentum. 1492 gelangen die Eroberung des Reiches von Granada und darauf die Verdrängung der maurischen Herrschaft von der Iberischen Halbinsel. Die Kronen von Aragón und Kastilien wurden im Jahr 1479 vereinigt. Die „katholischen Könige“ Ferdinand von Aragón (1479 –1516) und Isabella von Kastilien (1474 – 1504) betrieben die Erneuerung der Kirche, die sie in den Dienst der Einheitlichkeit ihres Reiches stellten. Das Nationalkonzil von Sevilla nahm 1478 Reformforderungen des Konzils von Trient vorweg, indem es die Einhaltung der Residenzpflicht der Bischöfe und Kleriker und eine Zurückdrängung der Exemtionen beschloss.
Das Königspaar stützte sich dabei auf den Franziskanerobservanten Francisco Ximénez de Cisneros (1436 –1517). Königin Isabella erhob ihren Beichtvater 1495 zum Erzbischof von Toledo und damit zum Primas von Spanien und Großkanzler von Kastilien. Ximénez wurde 1507 Kardinal und Großinquisitor für Kastilien und León. Um den Klerus nach seinen Vorstellungen zu bilden, sorgte er für die Reform der Universitäten Salamanca und Valladolid sowie die Neugründung Alcalá (Complutum) bei Madrid. Diese Hochschulen waren durch den Geist eines kirchlichen Humanismus geprägt. Die Theologie, insbesondere diejenige des Thomas von Aquin (um 1226 –1274, heilig gesprochen 1323) rückte hier ins Zentrum, während an den Universitäten im Reich vielfach noch die kanonistische Jurisprudenz im Mittelpunkt auch geistlicher Studien stand. Das erste Kolleg in Alcalá, San Ildefonso, wurde 1508 eröffnet. Hier entstand ein Zentrum des spanischen Humanismus, in dem biblische Studien besonders gepflegt wurden. Die Gelehrten erarbeiteten eine Neuedition des Alten und Neuen Testaments in den Originalsprachen und in Übersetzungen (Complutenser Polyglotte 1514/17), die Ximénez finanziell unterstützte.
An den spanischen Universitäten fand eine Renaissance der scholastischen Theologie statt. Der Dominikaner Francisco de Vitoria (nach 1483 – 1546) lehrte an den Hochschulen von Paris, Valladolid und Salamanca. Er wurde zu einem der maßgeblichen Erneuerer der spanischen Spätscholastik, welche die theologische Entwicklung über Spanien hinaus bis in das ausgehende 17. Jahrhundert prägen sollte. Die Theologie der Schule von Salamanca entfaltete auf dem Konzil von Trient starken Einfluss.
Auch Schriften der deutschen Mystik und der Devotio moderna wurden in Spanien rezipiert und wirkten ihrerseits auf den spanischen Ordensgründer Ignatius von Loyola (1491–1556) und die großen Mystiker des späten 16. Jahrhunderts. Die Praxis des häufigen Sakramentenempfangs, besonders die Intensivierung der Beichte, wurde gefördert. In den spanischen Zweigen der Bettelorden machte die Durchführung der Observanz große Fortschritte, zumal Ximénez aus ihren Reihen hervorgegangen war.
Allerdings war die Reform in Spanien mit der Hypothek belastet, dass sie durch das Königtum vorangetrieben wurde und kräftige staatskirchliche Strukturen entstanden. 1523 erhielt die Krone von Papst Hadrian VI. (1522/23) das Besetzungsrecht für alle Bistümer, außerdem bekam sie das Privileg des Placetum regium, die königliche Zensur über alle kirchlichen Verlautbarungen.
Inquisition (Spanien)
Der Inquisitionsprozess entstand im 12. Jahrhundert als Folge der Verwissenschaftlichung des Rechtes und wurde später auf Häresie angewendet. Die Ergründung der materiellen Wahrheit sollte durch gerichtliche Befragung ermittelt werden. Königin Isabella erwirkte 1478 von Papst Sixtus IV. (1471–1484) die Errichtung einer Staatsinquisition für Kastilien, die in Vorformen in Aragón seit 1232 bestand. Die von einem Generalinquisitor geleitete Behörde bildete dann das zunächst einzige gemeinsame Organ Spaniens, das den Katholizismus im Interesse der Staatsideologie rein erhalten sollte. Als staatliche Behörde war sie unabhängig von Rom. Das Gericht befasste sich mit der Rechtgläubigkeit der oft ohne innere Überzeugung zum Christentum übergetretenen, auch als „Marranen“ bezeichneten Judenchristen (Conversos) und der zwangschristianisierten Muslime (Moriscos) und entwickelte sich zu einem Instrument der gesellschaftlichen Kontrolle. Von den zwischen 1540 und 1700 angestrengten knapp 50 000 Verfahren endeten weniger als 3 % mit einem Todesurteil, von denen die Hälfte vollstreckt wurden (Gustav Henningsen).
Durch das enge Zusammenwirken von Staat und Kirche konnten Reformen in Spanien erfolgreich durchgeführt werden. Diese Verbindung sollte auch in anderen Ländern wie Bayern oder Österreich zu einem Wesensmerkmal der katholischen Reform werden. In einer Zeit, in der in weiten Teilen Europas heterodoxe Regungen auftauchten, verbanden sich die spanische Gesellschaft und Monarchie auf das engste mit dem Katholizismus, der zu einem Wesensmerkmal der Nation wurde.