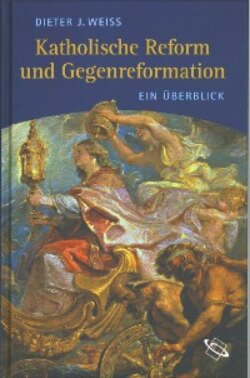Читать книгу Katholische Reform und Gegenreformation - Dieter J. Weiß - Страница 6
Оглавление[Menü]
I. Einleitung
Epochendiskussion
Gegenreformation
Wer die Grenzen eines Zeitalters festlegt, bestimmt seine charakteristischen Züge. Epochen sind keine der Geschichte immanenten, unverrückbaren Größen, sondern von Schulmeistern und Historikern willkürlich gesetzte Einteilungen, um den Fluss der Zeit zu gliedern. Der Begriff Gegenreformation – ursprünglich im Plural verwendet – kam im 18. Jahrhundert auf, zunächst 1776 bei dem Göttinger Staatsrechtslehrer Johann Stephan Pütter (1725 –1807). Er setzte sich mit dem Gebrauch durch den preußischen Historiker Leopold von Ranke (1795 –1886) durch. Dieser verstand darunter die gewaltsame Rückführung eines protestantisch gewordenen Gebietes zur altgläubigen Religionsausübung, den katholischen Gegenangriff auf die Reformation unter Führung des Papsttums. Später verwendete er den Begriff generell für das kämpferische Vorgehen der katholischen Kirche und katholischer Fürsten gegen die evangelische Reformation. Gegenreformation galt als kirchlich inspirierte militant-politische Unternehmung. Moriz Ritter (1840 –1923) kennzeichnete damit die Reichsgeschichte zwischen dem Augsburger Religionsfrieden 1555 und den Westfälischen Friedensschlüssen 1648. Auch außerhalb Deutschlands fand dieser Begriff nun Verwendung (contre-réforme, counter-reformation, contra-riforma), wenn er von der katholischen Historiographie auch abgelehnt wurde.
Der Terminus Gegenreformation bildet eine Antithese und setzt eine Reformation voraus. Protestantische Autoren verstanden die Reformation Martin Luthers (1483 –1546) als wahre Rückkehr zum ursprünglichen Christentum und interpretierten die Erneuerung der katholischen Kirche nur als eine Antwort darauf. Der Begriff „reformatio“ begegnet in der Antike bei Seneca und Plinius im Sinne einer moralischen oder politischen Veränderung des gegenwärtigen Zustandes durch Rückkehr zu vergangenen Zeiten. Der Apostel Paulus benutzte das Verb „reformare“ (Röm 12, 2; Phil 3, 21), um die Veränderung des Menschen zum Ebenbild Gottes zu fordern. Bei den Kirchenvätern finden sich beide Aspekte, die Rückkehr zum Urzustand vor dem Sündenfall und Reform als Fortsetzung der Schöpfung. Das Mittelalter verstand Reform dagegen als Rückkehr zu einem verlorenen Idealzustand („bona et antiqua consuetudo“). Die Bezeichnungen Reform und Reformation wurden unterschiedslos gebraucht. Im allgemeinen Bewusstsein wird heute unter Reformation die Ausbildung der evangelisch-lutherischen und reformierten Konfessionen im Anschluss an Martin Luther verstanden. Berndt Hamm beschreibt die Entwicklung von der spätmittelalterlichen „reformatio“ zur Reformation als Prozess normativer Zentrierung von Religion und Gesellschaft in Deutschland. Er betont den systemsprengenden Charakter der Reformation Luthers, die nicht mehr „als eine ausgefallene Position innerhalb der Variationsbreite kirchlich tolerierter mittelalterlicher Theologien, Frömmigkeitsformen und Reformmodelle und ihres deutenden Umgangs mit der Hl. Schrift erklärbar ist“. Ihr Ergebnis bildete eine neue Konfession, die sich von der bestehenden Kirche abgrenzte. Für diese Entwicklung hat sich als Epochenbezeichnung der deutschen Geschichte seit dem 18. Jahrhundert der Begriff Reformation eingebürgert, der durch Ranke für die Zeit zwischen 1517 und 1555 festgeschrieben wurde.
Der Gebrauch von Reformation und Gegenreformation als Epochenbezeichnungen außerhalb der Kirchengeschichte ist nicht unproblematisch, weil in diesem Zeitalter auch zahlreiche andere prägende historische Entwicklungen wie die europäischen Hegemonialkämpfe, der innere Staatsausbau, die Ständekriege oder der Aufbau der Kolonialreiche stattfanden. Obwohl Ernst Walter Zeeden seine Epochendarstellung unter den Titel „Das Zeitalter der Gegenreformation“ stellte, relativierte er diesen Begriff durch den Verweis auf die vergleichbare Bedeutung des Calvinismus, des militanten Protestantismus oder des konfessionellen Fürstentums sowie auf die kulturellen Leistungen der Zeit zwischen 1555 und 1648. Er definierte: „Konfessionelle Politik, wenn sie von katholischen Mächten getrieben wurde, nennen wir Gegenreformation.“ Noch Heinrich Lutz hat in seinem Band für die Reihe Grundriss der Geschichte die Zeit zwischen Luthers Reformation und dem Westfälischen Frieden unter den Titel „Reformation und Gegenreformation“ gestellt.