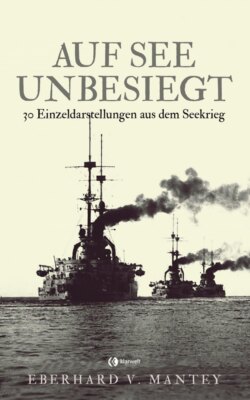Читать книгу Auf See unbesiegt - Eberhard von Mantey - Страница 10
Mit dem Marinekorps vor Antwerpen und in Flanderns Dünen.
ОглавлениеVon Kapitän zur See a. D. Hugo v. Waldeyer-Hartz, damals Abteilungskommandeur einer Matrosen-Artillerie-Abteilung in Flandern.
m Reichsmarineamt, wenig mehr als Tage nach Kriegsausbruch, eine feierliche Sitzung. Exzellenz von Tirpitz ist aus dem Großen Hauptquartier zurückgekehrt, sämtliche Immediatstellen der Marine haben Vertreter entsandt. Worum es sich handelt, jeder von den Beteiligten weiß es, und doch — in manche Köpfe will die geplante Maßnahme nicht recht hinein. Es handelt sich um etwas völlig Unvorhergesehenes, Überraschendes...
Der Großadmiral ergreift das Wort, Spannung auf allen Zügen: „Meine Herren, Seine Majestät haben befohlen, es ist seitens der Marine ein Expeditionskorps für Flandern auszurüsten. Ich bemerke ausdrücklich — es steht hier nicht mehr zur Debatte, ob es geschehen soll oder nicht, sondern nur die Frage ist zu prüfen, wie und wie schnell die Entsendung geleistet werden kann!“
Von verschiedenen Seiten kommen Einwendungen, Pflichtgemäß erfolgen sie. Die Aufstellung eines Expeditionskorps, das greift doch über den Rahmen der beabsichtigten Verwendung der Marine erheblich hinaus! Sind Kiel und Wilhelmshaven sicher vor feindlichen Angriffen? Darf man die Hauptstützpunkte unserer Flotte von einem gewichtigen Teil ihrer Deckungsstreitkräfte entblößen? Ist die Kriegslage schon soweit geklärt?
Mit wenigen Sätzen zerstreut Exzellenz von Tirpitz die Bedenken. Man spürt seinen weiten, zielsicheren Blick: Die Marine nach Flandern, Besetzung von Antwerpen, Ausnutzung der strategischen Lage an der flandrischen Küste, deutsche Torpedoboote, U-Boote und Minenleger im englischen Kanal manchem wird heiß bei solchen Gedanken, rasche und klare Arbeit wird geleistet. Das Expeditionskorps marschiert auf dem Papier auf. Ende August schon rollen die ersten Staffeln ab, obwohl die feldmarschmäßige Ausrüstung improvisiert werden musste, und am 10. September pfeifen im Kampf um Löwen die Kugeln der Feuertaufe. Mitte September ist die erste Marinedivision mit ihren 17 000 Mann im Felde, Mitte Oktober wird eine zweite Division in Stärke von 20 000 Mann aufgestellt. Das gesamte Korps steht unter dem Befehl des Admirals Ludwig von Schröder.
Die Feuertaufe — fast noch im rollenden Eisenbahnzug ward sie empfangen. Die Belgier stießen von Antwerpen aus vor, besetzten Merchtem und nach hartem Kampfe Aerschot, wollten die Bahn nach Brüssel zerstören, auf der die VII. Armee im Durchtransport war, und gedachten nach Brüssel durchzubrechen, das nur darauf wartete, sich zu erheben. Seesoldaten und Matrosenartilleristen, Leute wie sie prächtiger die Garde nicht kannte, stemmten sich im Verein mit Landsturm und Landwehr den Belgiern entgegen, Teile der VII. Armee halfen, über Overdevaert und Thildonck wurde der Feind zurückgetrieben, so stark auch seine Überlegenheit an Artillerie war. Vier Tage dauerte der ungleiche Kampf, unser blieb der Sieg.
Dann schloß sich der Ring um Antwerpen. Ein ungeheurer Drang nach vorwärts lag in den Mannschaften. „Das Ausland hat sich über uns Sozialdemokraten gründlich getäuscht“, so sagten sie. Heilig glühte die Flamme der Vaterlandsliebe, und es herrschte eine Manneszucht, die Gehorchen und Befehlen leicht machte. Ein gesundes und natürliches Empfinden lebte in allen Leuten, sie waren froh, aus der Stickluft der Parteiatmosphäre heraus zu sein. „Neu-Deutschland“ las man überall an den Wärterhäusern der Bahn, und erbeutete Lokomotiven mussten sich auf der Schwärze ihres Kesselleibes die Kreideaufschrift gefallen lassen: „Ich war ein Belgier, will ein Preuße sein!“
Die 1. Marinedivision deckte die linke Flanke des III. Reservekorps, als der Sturm auf Antwerpen begann. Während der Nacht hatten die Scheinwerfer der belagerten Festung den herbstklaren Himmel nach Fliegern abgesucht. In das graue Morgengewölk legte die Sonne eine goldene Bresche. Aus den Gräben wuchsen Tausende von Männerleibern empor. Geschlossene Reserven folgten. Nach einheitlichem Plan geleitet, vom unerschütterlichen Willen zu siegen beseelt, rückten die Massen vor.
Die Seesoldaten — gern hören sie sich nach ihrer Uniform die schwarzen Jäger nennen — nehmen den Eisenbahndamm bei Hofstade und besetzen nach heftigem Häuserkampf die Orte Geerdeghem und Muysenstraet. Über Sempst und Klempoel prasseln belgische Schrapnellkugeln. Sie halten die stürmenden Matrosenartilleristen nicht auf. Nach Mecheln, dem Hauptstützpunkt des Feindes, senden deutsche 21-cm-Mörser ihre schweren Grüße. Heftig antwortet die belgische Artillerie, die gut geleitet wird — kein Wunder, sie kennt Weg und Steg im Gelände — und außerdem zahlenmäßig überlegen ist.
In den nächsten Tagen geht es weiter, unaufhaltsam, trotz hartnäckigem Widerstande. Gewaltige Forts, erst in jüngster Zeit entstanden, lassen sich nur schwer niederkämpfen. Aus verschiedenen Ortschaften, so aus Elsestraet, muss der Feind mit blanker Waffe vertrieben werden. Die Matrosenartilleristen kommen vor dem Überschwemmungsgebiet im Netheabschnitt zum Stehen, Wenige hundert Meter vorm Fort Waelhem und der Panzerredoute Chemin de Fer graben sich die Seesoldaten ein. Zweimal prallen sie vergeblich vor. Um 5 Uhr nachmittags am 2. Oktober zeigt Waelhem die weiße Flagge. 550 Gefangene werden gemacht. Die Besatzung der Redoute zieht sich zurück, nachdem sie das zäh verteidigte Werk gesprengt hat.
Wenn die Sonne sinkt — es sind Herbsttage von unvergleichlicher Pracht und Schönheit — und das Nachtdunkel breitet unter dem glitzernden Sternenhimmel seine schwarzen Laken über das Land, dann glüht und lodert es an vielen Stellen gespenstisch auf. Aus brennenden Scheunen quillt dichter, schwerer Rauch. Wie eine Mauer lagert er sich und versperrt die Sicht. Bunte Leuchtkugeln irren empor und überkreuzen sich hoch in der Luft. Noch immer wischt von Antwerpen aus der Scheinwerfer hin und her.
Eine weitere Truppenstaffel ist aus Kiel und Wilhelmshaven eingetroffen. Zu den Seesoldaten und Matrosenartilleristen treten Matrosen in Stärke eines Regiments. Bei Mecheln werden sie eingesetzt. Die alte Handelsstadt ist längst in unserer Hand. Mit ihrer ehrwürdigen Kathedrale beherrscht sie die ganze Gegend. Schusslöcher klaffen in den geweihten Mauern. Belgische Granaten haben sie gerissen, als die Stadt fluchtartig geräumt worden war. Aus dem Gotteshaus ist jeder Schmuck entfernt, die Belgier haben ihn geborgen. Kahl und nüchtern starren die Wände den Besucher an, und das Sonnenlicht fällt durch geborstene Scheiben. Schutt und Mauertrümmer bedecken an mehreren Stellen den Boden. Und doch nimmt der Deutsche die Mütze ab, wenn er eintritt. Er ehrt die Weihe der Stätte.
Man will die Nethe überschreiten. Allen brennt der Angriffsgeist bis in die Fingerspitzen. Jenseits des Flusses, in gedeckter Stellung sitzen Nester voll belgischer Artillerie. Und sie haben Munition genug, um Stunden am Tage zu schießen, Wer sich am Südrande der Nethe zeigt, wird mit Geschossen überschüttet. Selbst auf einzelne Leute feuert der Feind. Immer wieder versuchen die über jedes Lob erhabenen braven Pioniere zum Brückenschlag zu kommen. Sie spüren, wie hinter ihnen die Seesoldaten zum Angriff drängen. Aber die Zugänge zu den Brückenstellen sind nur schmal und werden derart heftig unter feindlichem Maschinengewehr- und Infanteriefeuer gehalten, dass es über Menschenvermögen geht, hier vorzukommen. Soviel Brückenmaterial auch herangebracht wird, es wird den Leuten unter den Händen in Trümmer geschossen und versinkt im Schlick des Ufers. Doch fest verbissen bleiben die vorgeschobenen Abteilungen unter Oberstleutnant von Götze am Südrande der Nethe liegen und warten auf ihre Stunde. Aber auch am folgenden Tage kommt die tapfere Truppe nicht weiter. Das Sumpfgelände der Nethe widerstrebt hier jedem Brückenschlag. Und ohne Artillerie ist die starke Stellung des Feindes nicht zu erschüttern.
Der rechte Flügel der Angriffstruppen, die 5. Reservedivision, ist inzwischen vorgebrochen. Bei Duffel hat sie die Nethe überschritten, Vier Bataillone Marineinfanterie folgen ihr. Der Feind weicht dem starken, wieder belebten Druck. Oberstleutant von Götze kann melden, dass auch vor seiner Front die belgische Stellung brüchig wird. Bei Cuykerstraet überschreiten auch hier Seesoldaten das Nethehindernis. In panikartiger Flucht räumt der Feind das Feld. Maschinengewehre und Geschütze werden als Beute eingebracht. So eilig hat es der Belgier sich zurückzuziehen, dass die Fühlung mit ihm verloren geht. Selbst starke Kavallerieaufklärung vermag sie zunächst nicht aufzunehmen. Auch dort, wo die Matrosenartillerie-Brigade unter Führung des Kapitäns zur See Herr sich festgesetzt hat, gibt der Feind unter Einwirkung des starken östlichen Flankendrucks seine Stellungen preis. Heyndonck, Willebroek und Blaesveld, von wo aus ein wütendes Artilleriefeuer gesprochen hatte, werden als frei gemeldet. Mit dem Glockenschlage zwölf in der Nacht vom 7. zum 8. Oktober beginnt die Beschießung von Antwerpen. In elftägigem Sturmlauf ist der äußere Verteidigungsgürtel der mächtigen Festung überrannt.
Um den Abzug der feindlichen Armee nach Westen zu erschweren, wird von den schwachen Einschließungstruppen die 4. Ersatzdivision abgezweigt und über Termonde in nördlicher Richtung vorgetrieben. General von Beseler will mit seiner kleinen Schar — an der Größe Antwerpens gemessen ist es nicht mehr als ein Häuflein — das Unmögliche möglich machen und ganze Arbeit leisten; nicht nur die Festung will er bezwingen, sondern auch ihre Verteidigungsarmee mit Mann und Maus gefangennehmen. Die Abzweigung der Ersatzdivision weist den Marinetruppen einen größeren Gefechtsabschnitt zu. Sie haben nunmehr die ganze Fläche zwischen dem Willebroeck-Kanal und der Scheide zu besetzen. Buntscheckig ist die Marinedivision zusammengestellt. Was mobilmachungsmäßig zur Deckung der Landfronten der beiden Hauptkriegshäfen gehört, ist mit nach Flandern gerückt. Am 8. Oktober kapituliert Fort Breendonck. 300 Gefangene werden gemacht, am folgenden Tage häufen sich die Meldungen, dass auch die inneren Forts vom Feinde geräumt seien. Immer enger presst sich der Belagerungsring an die Stadt heran. Am 11. Oktober streckt das letzte der Forts die Waffen, Antwerpen ist unser! Die Truppen marschieren ein. Es hat in den letzten Tagen noch manchen blutigen Strauß gesetzt. Nun hämmern die schweren Schuhe der Sieger auf dem Pflaster der Stadt im Parademarsch. Und zwischen den Häuserwänden schmettert der helle Schall jubelnder deutscher Militärmusik. Ein Werk ist geglückt, beispiellos kühn in seiner Anlage, aber aufgebaut auf einem Fundament, das den Erfolg verbürgte, auf deutscher Waffentüchtigkeit. Mit insgesamt 50 000 Mann ist in Tagen eine Festung bezwungen, die nach Stärke und Ausdehnung zu den mächtigsten der Welt gehörte, ein Bollwerk, auf dessen Widerstandskraft nicht nur Belgien, nein der gesamte Feindbund seine besonderen Hoffnungen gesetzt hatte. Antwerpen bedrohte vom Norden aus den Rücken unseres siegreichen Heeres, Von Antwerpen aus konnte jederzeit ein Angriff auf die so außerordentlich wichtige Eisenbahnlinie Lüttich-Brüssel unternommen werden. Zur Verlängerung des linken Flügels der französischen Heeresmassen waren die ersten Divisionen des englischen Heeres auf Frankreichs Boden gelandet worden. Für weiteren Nachschub hätte man sicherlich Antwerpen ausgenutzt. Dieselben Leute, die sich das mehr als unbesonnene Wort eines deutschen Staatsmannes noch immer zunutze machen, um aus dem Tränensack ihres Völkerrechtsempfindens eine Zähre nach der anderen über das von Deutschland an Belgien verübte Unrecht hervorzupressen, sie hätten nicht eine Sekunde gezögert, die auf dem Besitz der Scheldemündung beruhende Neutralität Hollands zu missachten, wenn die Wahrung des eigenen Vorteils in Frage gekommen wäre. Man komme nicht mit der Anwendung, England habe doch den oft erwogenen Plan, von der Scheldemündung aus in den Rücken unserer Flandernfront zu gelangen, auch später nicht ausgeführt! Richtig ist das schon, nur dass sich zweierlei zur Entkräftung des Einwandes sagen lässt: einmal war für England die Unternehmung mit dem Augenblick außerordentlich erschwert, wo wir die flandrische Küste behaupteten, und zum anderen war die Unternehmung entwertet, als sich Antwerpen nicht mehr in belgischen Händen befand. Umsonst ist Churchill in jenen Schreckenstagen nicht nach Antwerpen geeilt, als die Panzerwerke der großen Scheldefestung vor der deutschen Artillerie in überraschend kurzer Zeit dahinsanken und die belgische Infanterie wie Herbstblätter, die der Wind fortwirbelt, vorm deutschen Angriff wichen. Es blieb nur das Aufflackern einer schwachen Hoffnung, als der vielgewandte englische Minister mit dem Expeditionskorps der britischen Marine paradierte. Die Leute haben sich nicht schlecht geschlagen. Aber unsere schlugen sich zehnmal besser. Und einen hellen, ehrlichen Jubel gab es, als unsere Marine britische Seeleute zu Gefangenen machte.
Der Fall von Antwerpen ist in der Hochflut der Ereignisse der ersten Kriegsmonate, über denen die Sonne von Tannenberg am hellsten strahlte, vielleicht zu wenig hervorgetreten. Es war eine Waffentat erster Ordnung, die nicht nur ihren genialen Führer, den General von Beseler, sondern im gleichen Maße seine Truppen lobt. Man denke — nur 50 000 Mann! Und darunter 17 000 Mann Marine, die für derartige Unternehmungen nicht ausgerüstet, zum Teil nicht einmal vorgebildet waren. Und doch ist das Werk geglückt, in überraschend kurzer Zeit geglückt, weil wir einig waren und an unseren Sieg glaubten, weil jede Parteipolitik daheim und in den Schützengräben schwieg und deutsches Herz zu deutschem Herzen schlug, und weil das schleichende Gift der feindlichen Lügenhetze noch nicht in unsere Reihen eingedrungen war.
Einen Blutzoll von 660 Toten und Verwundeten hatte die Marinedivision vor Antwerpen entrichten müssen. Er wurde gern und freudig gebracht, denn alles strebte zum Ganzen. Stadt und Festung wurden unter den Befehl von Admiral von Schröder gestellt. Das III. Reservekorps marschierte nach Südwesten ab, dem weichenden Feind auf den Fersen. Ihn abzuschneiden, war mit den wenigen Truppen leider nicht geglückt.
Und nun sei noch eine Tatsache erwähnt, die wenig bekannt ist und doch dazu herhalten darf, davon zu sprechen, dass auch die Marine im Landkriege ein neues gutes Reis auf den Stamm „Heereswissenschaft“ gepfropft hat. Unter den mannigfachen Dienstzweigen, die in Friedenszeiten an Bord unserer Kriegsschiffe betrieben worden sind, spielte auch der sogenannte Landungsdienst eine gewisse, wenn auch nur bescheidene Rolle. Er wurde von dem Landungskorps ausgeführt, dessen Aufgabe es war, hauptsächlich bei kolonialen Unternehmungen zu wirken. Das Landungskorps eines Schiffes war nun aber nicht nur aus Schützenzügen zusammengestellt; es traten vielmehr Signaltrupps, Pioniere, in Gestalt von Zimmerleuten und Heizern, Krankenträger und vor allem Artillerie hinzu. Die Waffe der Landungsartillerie war eine 6-cm-Kanone; und diese kleinen, handlichen Geschütze waren es, die unsere Leute in Flandern, wenn irgend möglich innerhalb der Schützenlinien, mit sich führten, Von Menschenkraft gezogen und geschoben haben sie den Sturm auf Antwerpen mitgemacht. Erst wurden sie bespöttelt, später gewann auch die Armee Interesse an ihnen, und mit dem Widerstand der belgischen Infanterie war es allemal schnell vorüber, wenn die 6-cm-Granaten oder Sprenggranaten unter kurzem Geblaff ihre Grüße sandten. Der Gedanke des mit der Infanterie vorgehenden leichten Geschützes ist später erheblich erweitert worden. Wir wissen aus den letzten gewaltigen Kämpfen an der Westfront, dass die Artillerie sich nicht mehr damit begnügte, der Infanterie den Weg zu bahnen. Überall wurde Angriffsartillerie bereitgestellt, die zusammen mit der Infanterie vorbrach, um ihre Stoßkraft zu verstärken.
Wie bereits erwähnt, gelang es den schwachen Einschließungstruppen vor Antwerpen schon aus räumlichen Gründen nicht, den Abmarsch eines größeren Teils der belgischen Armee einschließlich der Engländer zu verhindern. Mit äußerster Kühnheit durchgeführte Versuche, den Feind in der Gegend von Melle und Quatrecht am Weitermarsch zu verhindern, scheiterten infolge der zahlenmäßigen Unterlegenheit der auf unserer Seite verfügbaren Truppen. Die Landwehrbrigade Jung hatte hierbei schwere und heiße Tage. Beim Generalgouvernement in Brüssel ging die Sorge um sie um. Der Generalfeldmarschall von der Goltz fuhr persönlich zur Front, dorthin, wo es am heißesten herging. Der alte Herr schonte sich nicht. Wenn irgendwo in erreichbarer Nähe der Kampflärm tobte, dann hielt es ihn nicht hinterm Schreibtisch. Trotz seinem Äußeren, das ihn einem Gelehrten ähnlich machte, war er eine Kampfnatur; nicht hitzig und stürmisch, sondern ruhig und abgeklärt, aber von jener Art, die in jedes Soldatenherz den Zauber vollsten Vertrauens goss. Und vom selben Schlage war Generalmajor Jung. Mitten im Häuserkampf um Quatrecht überbringt ihm ein Mann eine Meldung. Im Sprechen sinkt er getroffen zur Erde und ist tot. Da nimmt der General seine Mütze ab und betet für den Gefallenen ein Vaterunser, vom ersten bis zum letzten Wort. Dann erst ergehen seine weiteren Befehle. In Brüssel sorgte man sich, wie gesagt, um das Schicksal der tapferen Brigade Jung. Was an Truppen verfügbar war — man harkte die Kasernen bis zum letzten brauchbaren Mann aus, trotzdem kam nicht viel zusammen — wurde zur Unterstützung geschickt. Von der Marinedivision befand sich in Brüssel eine Etappenformation, die mit der Aufstellung von Fuhrparkkolonnen beschäftigt war. Auch hier ließ man alles stehen und liegen, und wer konnte, griff zum Gewehr. Eine kriegsstarke Kompagnie kam zusammen. Sie sollte so schnell wie nur irgend möglich mit der Bahn nach Quatrecht befördert werden. —
Auf dem Nordbahnhof in Brüssel herrscht Hochbetrieb, kaum dass die einzelnen Züge sich noch entwirren lassen. Nachschub über Nachschub kommt von der Heimat angerollt, tausenderlei Dinge und Sachen, Wenn es trotzdem gelingt, die Ordnung leidlich aufrechtzuerhalten, so bewähren sich auch hier deutsche Gründlichkeit und Tüchtigkeit.
„Ich brauche für 250 Mann einen Zug in Richtung Quatrecht, Befehl vom Generalgouvernement!“ In der Annahme, dass sich nunmehr der gesamte Nordbahnhof mit allen seinen Einrichtungen ihm zur Verfügung stellen würde, schwenkt der Führer der zusammengestellten Matrosenkompagnie einen Zettel mit dem für ihn gültigen Befehl.
Kopfschüttelnd sieht der diensttuende Beamte den Kapitänleutnant der Seewehr an. „Gern“, sagt er, „das soll wohl so sein, wagen gibt es genug, auch Lokomotiven. Aber Personal, Zugführer und Heizer —“
„Wenn's weiter nichts ist!“ Lachend wendet sich der Kapitänleutnant seinen Leuten zu. „Wer will Zugführer spielen? wer will Lokomotivführer sein?“
Im Handumdrehen sind ein Maschinistenmaat und zwei Heizer ausgesucht. Lokomotive und Wagen werden zusammengestellt. Das Bahnpersonal braucht sich um nichts mehr zu kümmern. Und nach denkbar kürzester Frist verläßt der Marinezug unter eigener Regie den Bahnhof. Den Leuten lacht nur so die Freude aus dem Gesicht. Denn immer, wo es etwas Besonderes gibt, sind unsere Blaujacken gern dabei.
Merkwürdig, mit Halloh und lautem Jubelgeschrei, mit Tücherschwenken und freundlichem Augengruß kommt überall die belgische Bevölkerung entgegen. Die Fahrt wird zum reinsten Triumphzuge, je weiter man nach Westen vordringt. Niemand vermag sich einen rechten Vers daraus zu machen, bis ein einziges Wort die Aufklärung bringt. „Les Anglais, les AngIais!“ hört man rufen. Unsere Blaujacken, die niemand hier vermutet, werden für Engländer gehalten. Man gönnt den Einheimischen ihr Vergnügen und zieht beim Rangieren des Zuges seinen Vorteil daraus.
Als die Kompagnie nach verhältnismäßig schneller Fahrt am Ziel ankommt, besteht für die tapfere Brigade Jung keine Gefahr mehr. Sie hat sich eingegraben, der Feind zieht ab. Einen neuen Angriff wagt er nicht mehr.
In dem eroberten Antwerpen gab es für die Marinemannschaften eine Fülle zu tun, aber doch nicht so viel, dass alle volle Beschäftigung fanden. Werftpersonal wurde zurückgelassen, um die Antwerpener Hafenanlagen nutzbar zu machen. Die Kampftruppen unter Admiral von Schröder drängten aber auf der Rückzugslinie des Feindes nach Westen nach. Brügge und Ostende war ihr Ziel, an der flandrischen Küste wollte man sesshaft werden, um dort seine besten Kräfte zu zeigen, angesichts der See, auf der man heimisch war.
Und es wurde eine wahre Feierstunde, als man zum ersten Male vom Dünenrande aus das graue Nordseewasser erblickte, als man den rauschenden Meeresatem vernahm und britische Kreuzer und Torpedoboote erspähte, die mit langsamer Fahrt, in der Ferne nur wie Schatten wirkend, auf und ab patrouillierten. Ja, wie eine Feierstunde überkam es uns! In den langen Jahren unserer Dienstzeit waren wir älteren zu vielen Malen, auf der Ausreise oder Heimkehr begriffen, in eben jenen Gewässern gefahren. Nun stand man an der Küste und war ihrer Herr geworden als Sieger im Kampf um die gerechte Sache. Das musste feierlich stimmen!
Lange vor Kriegsausbruch hatte die englische Lügenpropaganda gegen uns eingesetzt. Angedichtet wurde uns die Geschmacklosigkeit, die unverfälscht den Stempel britischer Geistesverfassung trägt, wir ließen an Bord der deutschen Schiffe keine festliche Gelegenheit vorübergehen, ohne auf den Tag des blutigen Zusammenstoßes mit England unsere Gläser zu leeren. „To the day“, so lautete der für uns erfundene Trinkspruch. Und wie sehr man darauf aus war, die Anschwärzung unters eigene Volk zu bringen, lehrte ein Vorfall echt chauvinistischer Art, der sich in dem weltentlegenen Hafenstädtchen Pembroke Dock im Jahre 1912 abspielte. Deutsche Marineoffiziere, die zur Besatzung eines auf Reede liegenden Schulkreuzers gehörten, begaben sich damals in Uniform an Land, um der Einladung eines Offizierkasinos der britischen Armee Folge zu leisten. Raum hatten sie die Dampfpinasse verlassen, als schmutzige, verwahrloste Gassenjugend sie umschwärmte und ihnen immer wieder aufreizend und frech, „to the day, to the day“ entgegenbrüllte.
Gewiss, sachlich und ernst haben wir deutschen Marineoffiziere oft genug darüber gesprochen, dass der Gegensatz zu England zum Austrag mit den Waffen führen könnte. Lehrmeisterin war uns dabei die Geschichte, die an drei monumentalen Beispielen, an der Vergewaltigung Spaniens, an der Erdrosselung der Niederlande und an der Mattsetzung Frankreichs lehrt, dass das eigennützigste und hochmütigste aller Völker jeden ernsthaften Nebenbuhler auf See zu vernichten wusste, um mit kaum zu überbietender Dreistigkeit der Menschheit das Dogma einzubläuen, es sei von der Weltenordnung bestimmt, dass Großbritannien die Meere beherrsche. Wir von der Marine waren in anderen Anschauungen groß geworden. Wir sagten uns, dass das große geeinte deutsche Reich seine Lungen mit Seeluft füllen musste, wollte es so weiter bestehen, wie es der Reichsschmied Bismarck zusammengeschweißt und zurechtgehämmert hatte. Uns war heilige Überzeugung, dass auch deutsche Art und Tüchtigkeit dazu berufen seien, Übersee zu wirken. Und hätten wir es nur geglaubt, wir hätten es bald als Wissen in uns aufgenommen, denn auf jedem Meere grüßte uns die schwarz-weiß-rote Handelsflagge, in jedem Hafen war sie vertreten, und was man über sie hörte, war immer wieder eitel Preisen und Rühmen. Und nun war zur Tatsache geworden, worüber man so oft gesprochen hatte, die Kräfte des Krieges waren entfesselt! Deutschland und England rangen miteinander, der eine um die Freiheit der Meere, der andere um die seit Jahrhunderten angemaßte Seeherrschaft.
Wir standen lange auf den Dünen und starrten über die See hinweg; in dem Gedanken, dass die Stunde gekommen war, die die Entscheidung bringen sollte, ob britische Anmaßung noch weiterhin zu dulden wäre oder nicht, schlug uns das Herz höher.
Am Leuchtturm von Ostende hatten unsere Leute ein paar belgische Geschütze kleinsten Kalibers aufgestellt, die irgendwo erbeutet waren. In den Dünenkamm hatte sich eine Batterie Feldartillerie eingegraben. Unten scharrten die Rosse. Und von Gent her war Fußartillerie aus Swinemünde mit 10-cm-Geschützen im Anmarsch. Das war alles, womit wir in den ersten Wochen die flandrische Küste artilleristisch deckten. Aber ein Angriff seitens der Engländer unter dem Schutze ihrer Flotte erfolgte nicht. Damals war jene Überlegenheit an der Masse technischer Kriegsmittel noch nicht eingetreten, die später die Wage der Kräfte zur Schwebe brachte. Damals stand noch Mann gegen Mann, und da wagten sie es nicht, sich angriffsweise mit uns zu messen. Durch Belgien hatten wir sie vor uns hergetrieben wie die Spreu vorm Winde. Just zur rechten Stunde war die Marine in Flandern eingesetzt worden. Wer noch Zweifel im Herzen tragen mochte, ob es ein rechter Schritt gewesen war, Blaujacken im Landkriege zu verwenden, dem blies die Seebrise an der flandrischen Küste die letzte Besorgnis aus dem Sinn.
Doch nun möchte ich eines Mannes gedenken, mit dem mich ein besonderes Erlebnis verband. Eines Mannes, dessen Drang, zur Front zu kommen, kennzeichnend war für die Stimmung jener Tage.
Ich war nach manchem Hin und Her am 7. November 1914 Stadtkommandant von Ostende geworden. Es gab dort eine Menge zu tun. In einem Schulhause befand sich die Kommandantur. Gewaltige Vorräte, die in den Gasthöfen der eleganten Welt lagerten, mussten verwaltet werden, durchziehende Truppen heischten Quartier, unzählig waren die Spionagefälle. Zwei Tage versah ich erst meinen Dienst, als am Abend die Hauptstütze meines Bureaupersonals, ein Maschinistenmaat der Reserve, durchaus nicht aus meinem Zimmer weichen wollte. Der Unteroffizier, ein junger, stattlicher Mensch, hatte offenbar etwas auf dem Herzen. So fragte ich ihn: „Haben Sie noch etwas für mich?“
Er stellte sich kerzengerade hin: „Ich bitte, Herrn Kapitän in einer persönlichen Angelegenheit sprechen zu dürfen.“
„Nun, was gibt es?“
Der Maschinistenmaat würgte am Wort. Sichtlich war ihm seine Anfrage peinlich. Fast rauh stieß er hervor: „Ich bitte Herrn Kapitän, mich zur Front zu entlassen!“
Auf ein solches Ansinnen war ich nicht vorbereitet. „Ich begreife Ihren Wunsch“, entgegnete ich. „Aber sehen Sie — auch die Kommandantur will leben. Sie sind im Bureaudienst eingearbeitet, die anderen Hilfskräfte verstehen nicht viel davon —“
„Das ist ja mein Unglück!“ klagte er. „Kaum war ich in Flandern angekommen, da nahm mich auch schon die Kommandantur Mecheln wahr. Und von dort bin ich hierhergeschickt. Ein Gewehr habe ich überhaupt noch nicht in der Hand gehabt —“
„Wohl, weil Sie technischer Unteroffizier sind“
„Das bin ich gar nicht!“
Nun wuchs mein Erstaunen. „Sie tragen doch das Abzeichen!“
Da erzählte er mir, dass er vor Jahren Fähnrich bei der Armee gewesen sei und einer Handverletzung wegen seinen Abschied habe nehmen müssen. Schiffbau habe er studiert, worauf ihn das Bezirkskommando als zur Marine gehörig betrachtet und ohne viel Federlesen zu machen zum Maschinistenmaaten der Reserve umgestempelt habe. Er verfüge aber über keinerlei Kenntnisse im praktischen Maschinenwesen, jedoch ein Gewehr, das könne er noch immer handhaben, und auch eine Gruppe von Mannschaften wolle er zur Zufriedenheit führen . . . Seine Augen leuchteten: „Ohne das Eiserne Kreuz mag ich nicht nach Hause kommen!“
Ich sagte ihm Erfüllung seines Wunsches auf Abkommandierung zu, sobald ich nach ein paar Tagen besser eingearbeitet wäre, worauf er mich verließ.
Am nächsten Abend — es war der 10. November 1914 — erhielt ich den schriftlichen Befehl, aus allen kampffähigen Truppen, die in Ostende lagen, ein Detachement zu bilden und mich mit ihm am nächsten Morgen beim Obersten Lessing, dem Führer des 1. Marineinfanterieregiments, in der Nähe von Middelkerke, zu melden. Das Detachement setzte sich aus einem Bataillon Matrosenartillerie, einen Bataillon Matrosen, vierzig Radfahrern, acht Bootskanonen und acht Maschinengewehren zusammen. In der Kommandantur gab es bis Mitternacht mit den Vorbereitungen zu tun. Und mein Schreiber, der Maschinistenmaat, musste seinen Eifer verdoppeln, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Und er tat es gern, denn als erstes hatte ich ihm zugerufen: „Sie nehme ich mit als meine Gefechtsordonnanz. Schneller als Sie gehofft, kommen Sie vor den Feind!“
Die taktische Lage verhielt sich so: Am 4. November hatte die 38. Landwehrbrigade einen Ausfall überlegener belgischer Truppen aus Nieuport und Lombardzyde abgeschlagen. Die Brigade war dem weichenden Feinde bis Palingbruk nachgedrängt, wurde jedoch nachts von ihrem Führer aus dem schwierigen Gelände zurückgenommen, weil die einzelnen Verbände im Übereifer durcheinander geraten waren. In den folgenden Nächten hatte der Feind stärkere Ausfälle aus Nieuport wiederholt, die zwar an unseren Stellungen östlich Lombardzyde abprallten, den Gegner aber Wieder in den Besitz des Dorfes brachten. Hierdurch war ihm die Möglichkeit geboten, sich mit starken Kräften östlich des Yserkanals festzusetzen. Admiral von Schröder, dem mittlerweile der gesamte Gefechtsabschnitt an der flandrischen Küste und vor Nieuport unterstellt worden war, beschloß, Lombardzyde wiederzunehmen und den Feind auf Nieuport zurückzuwerfen, um auf diese Weise jedem weiteren Vordringen und auch der Anhäufung neuer feindlicher Kräfte östlich des Kanals nachdrücklich entgegenzutreten.
Generalmajor von Wichmann übernahm die Leitung des rechten Angriffsabschnittes, der sich nördlich der Straße Ostende— Westende ausdehnte, den Südabschnitt befehligte Oberst Lessing. Im Nordabschnitt lagen Seesoldaten und Matrosenartilleristen, im Südabschnitt nur Seesoldaten. Sie wurden durch das unter meinem Befehl stehende Detachement verstärkt.
Der Angriffsbefehl lautete: „Die Marinedivision greift morgen (am 11. November) den Gegner zwischen Meer und Poter Dyk an, setzt sich in Besitz seiner Stellungen und stößt bis zum Westrand der Dünen und Südrand von Lombardzyde vor.“ Mit wenigen Sätzen war ein klares Ziel gesteckt.
In der dem Angriff vorangehenden Nacht wurden im Dünengelände mehrere Patrouillen vorgetrieben, die vor Lombardzyde starke feindliche Infanteriestellungen erkundeten. Nieuport wurde während der Dunkelheit durch vier 12-cm-Geschütze unter langsamem Feuer gehalten. Am nächsten Morgen entbrannte um 9 Uhr vormittags auf beiden Seiten ein heftiger Artilleriekampf. Auf unserer Seite waren unter Befehl des Kapitäns zur See Mörsberger insgesamt sieben Batterien verschiedener Stärke in Tätigkeit. Der Feind war uns jedoch an Kaliber und Geschossmenge erheblich überlegen. Außerdem waren seine Batterien so meisterlich verteilt, dass ihre Stellungen nur zum Teil zu erkennen waren. Der für die Vormittagsstunden angesetzte Angriff unserer Fußtruppen wurde deshalb zurückgehalten, bis unsere Artillerie dem Gegner kräftiger zugesetzt hätte.
Um 1 Uhr 15 Minuten nachmittags brach dann der Angriff los. Drei Stunden später war Lombardzyde fest in unserer Hand. Als erster von allen hatte Leutnant Dehning von der Marineinfanterie das Kampfziel, den Südrand des Dorfes, erreicht.
Mein Detachement hatte in rückwärtigen Schützengräben gelegen, während des Feuerkampfes hatten unablässig die Spaten gewühlt. Wie die Maulwürfe waren wir unter die Erde gekrochen. Als das vor uns liegende Bataillon Marineinfanterie stürmte, rückten auch wir befehlsgemäß vor, in weit auseinandergezogenen, aber in sich fest geschlossenen Schützenlinien.
Voraus das Knattern lebhaften Schützenfeuers. In den Lüften surrt und faucht es, als führe ein Schwarm unsichtbarer Geister umher. Platzende Schrapnelle in Hülle und Fülle. Ihre Garben überkrallen die Felder. Aus dem Ackerboden brechen Geiser von schwarzem Rauch und krumiger Erde empor. Schwere Granaten hauen ein. Sprengstücke klingen und singen. Ringsum ein Hämmern und Schüttern, Flirren und Schmettern . . . hindurch, hindurch — dem Feind an die Kehle! Unbeugsamer Mut und eiserne Manneszucht geben einen festen Ritt.
Als erster von meinen Leuten, unmittelbar vor mir, sinkt meine Gefechtsordonnanz, der Maschinistenmaat Bernhards aus der Kommandantur, lautlos vornüber. Ein flüchtiger Blick — aus Kopf und Brust sickert warmes Blut. So hat der tapfere Mann sein Leben lassen müssen. Ihn hatte die Schreibstube nicht halten können. Kämpfen wollte er und dem Vaterlande vorm Feinde helfen. Doch sein erster Kampf hatte sein letzter sein müssen, weil das Schicksal es nicht anders gewollt. Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben!
Unaufhaltsam geht es weiter. Stärker werden die Verluste. Bei den Seesoldaten vor uns setzt plötzlich das Gewehrfeuer aus. Für ein paar Sekunden atemlose Stille — dann braust es auf: ein stürmisches Hurra, drei-, viermal wiederholt, ein Kriegsruf schmetternd und jubelnd, vor dem das Lärmen des Kampfes verklingt. Mit blanker Waffe wird gestürmt. Rasselnd hämmert der Trommelschlag. Französische Hörner gellen. Und immer wieder ertönt das siegessichere deutsche Hurra!
Meine Leute drängen nach. Es geht über Knicks und Dämme hinweg, über Wassergräben und durch Strauchwerk hindurch, ein Laufen, Kriechen, Sichwinden, Stürzen, die Pulse hämmern, der Atem fliegt. Die Vordersten haben die Seesoldaten erreicht. Die „schwarzen Jäger“ haben ganze Arbeit getan. Franzmänner hatten die Belgier abgelöst, Franzmänner in blauen Röcken und roten Hosen. Die 81. Territorialdivision, bestehend aus fünf Regimentern Infanterie und zwei Regimentern Artillerie, war aus der Gegend südlich Arras herbeigeholt worden. Nun bleibt von den frischen Ankömmlingen nur wenig übrig. Achthundert werden zu Gefangenen gemacht. Zusammengeschossene Haufen weichen. Und die Gräben des kunstvoll ausgebauten Verteidigungssystems haben sich buchstäblich mit Leichen gefüllt. Südlich der Straße bis hin zum Poter Dyk ist der Gegner völlig geworfen.
Im nördlichen Gefechtsabschnitt hat das Gelände den tapferen Sturmtruppen gewaltige Schwierigkeiten bereitet. Bis an die Knöchel sind dort die Füße im Dünensand versunken, der, vom böigen Winde hochgefegt, sich festsetzt in Auge, Nase und Mund und Sehen und Atmen verhindert. Noch schlimmer ist aber, dass der Sand Lauf und Schloß der Gewehre verstopft, so dass die Schusswaffen wertlos werden, während der Feind in nichts behindert ist.
Das I. Bataillon der Marineinfanteriebrigade hat über diesen Gefechtsabschnitt wie folgt berichtet: „Vor der 2. und 3. Kompanie stand der Angriff etwa anderthalb Stunden, bis Leutnant von Keyserlingk mit Teilen beider Kompanien zu einem Flankenangriff auf die bei Polder befindlichen Stellungen des Gegners ausholte. Der Flankenangriff glückte, so dass die ganze Linie mit mächtigem Stoß vorankam. Die Angriffsfreudigkeit der Truppen lebte dadurch zur vollen Höhe auf, dass die 4. Kompanie die Fahne enthüllte und weithin sichtbar vortragen ließ.“
Im Weltkriege haben Millionen von Kämpfern gegeneinander gestanden. An Heldentaten hat es wahrlich nicht gefehlt, nur dass sie in der Masse der Ereignisse zum großen Teil verloren gegangen sind. Unser Geschlecht soll nicht glauben, dass es höchsten Ruhmes weniger würdig gewesen wäre als unsere Vorfahren. Uns Überlebenden erwächst die heilige Pflicht, allen jenen Tapferen ein Denkmal zu setzen, sei es auch nur mit schlichtem Wort, die zu denen gehören, für die vergangene Jahrhunderte die Weihe ewiger Verherrlichung gefunden hätten.
Vizefeldwebel Lessing war es, der seiner Kompanie, seinen schwarzen Jägern, damals zum ersten Mal in Feldgrau gekleidet, die Fahne vorantrug. Von fern würgte der Tod mit schwerer und leichter Artillerie, vom Ramm der Dünen mit unablässig ratterndem Maschinengewehrfeuer. Aus dem sprungweisen Vorgehen der Seesoldaten ward ein wildes, kühnes Stürmen, die lockeren Dünen hinauf und hinab, durch Geschoss und Sandgestiebe hindurch.
Die Haare kleben am Nacken, der Gaumen brennt vor Trockenheit, blutrot die Augen, keuchend der Atem, die Anstrengung ist schier übermenschlich. Doch der Wille zum Sieg und die prächtige, stahlharte Manneskraft — sie lassen keine Erschöpfung zu, sie reißen vorwärts, stacheln den Müdesten und Lahmsten auf. Mag auch der Fuß hundertmal gleiten, mögen Schenkel und Arme beben, es geht weiter — weiter — weiter
In einer Dünenmulde ist‘s, voraus überhöht, von den Seiten flankiert, wo die Menschenwelle zum Stehen kommt. Eine wahre Wand aus Stahl und Eisen fällt den Stürmenden entgegen und gebietet Halt. Doch Vizefeldwebel Lessing — hoch schwingt er den Fahnenschaft. Mit harten, straffen Schlägen knattert das schwere Tuch im Winde. Über ostasiatischem Boden hat es geweht, hat Südafrikas Wüste erschaut, ist sieggewohnt und ruhmbedeckt. Reiner läßt die Fahne im Stich. Alle folgen ihrem Träger, wenn auch der weiße Dünensand über manches Opfer rieselt, doppelt bleich im Schmuck der neuen Uniformen mit den leuchtenden gelben Gardelitzen.
Schon flattert die Fahne auf der nächsten Höhe. Frohlockend schwingt sie ihr tapferer Träger — da stürzt der Brave und sinkt zusammen, vom Sichelhieb des Todes getroffen.
Sergeant Jürgensen bückt sich und reißt das Banner hoch. Auch ihm liegt der Schaft fest in der Hand. Er weiß — nun blitzen hundert Läufe gegen ihn. Was ficht‘s ihn an! Im Sturm die Fahne zu tragen, gibt es auf Erden eine stolzere Lust?
Über die letzte Düne hinweg brandet die Welle der schwarzen Jäger. Der Feind gibt seine Stellung verloren. In regelloser Flucht sucht er sein Heil. Nur wenige Beherzte halten stand. Sie werden zu Gefangenen gemacht. Und zur Befehlsstelle bei Middelkerke geht die Meldung zurück, dass auch im Nordabschnitt das Ziel erreicht sei.
Während der Nacht gruben sich die siegreichen Truppen ein, Blaujacken und schwarze Jäger, im Angriffsschwung zum Teil durcheinander gemischt. Regendurchweicht und geschosszerpflügt war der Boden, und von See her brauste der Wind, als sollte die Welt aus den Angeln gehoben werden. Und mit den wütenden Streichen des Windes kamen noch immer schwere Granaten geflogen. Der Franzmann hielt die Anmarschstraßen unter Feuer, um für die müde gekämpften Truppen die Proviantzufuhr zu sperren.
Beim Morgengrauen stießen die in den Dünen stehenden Kompanien bis dicht an den Kanal vor, wobei sie zahlreiche Gefangene machten; Franzmänner, die sich nicht mehr hatten bergen können, nachdem der Brückensteg westlich Passerelle durch unser Artilleriefeuer planmäßig zerstört worden war. Bei diesem Vorstoß glückte es auch, sich an der Mündung des Kanals festzusetzen.
Die Verluste der Marinedivision betrugen hier 14 Offiziere tot, 23 verwundet, 175 Mannschaften tot, 553 verwundet. Die Verluste auf feindlicher Seite waren unverhältnismäßig größer. Das lag zum Teil an unserem, wenn auch zahlenmäßig unterlegenen, so doch trefflich geleiteten Artilleriefeuer, dann vor allem aber daran, dass der Franzmann sich uns an mehreren Stellen zum Nahkampf stellte. Er hat sich wacker geschlagen. Man soll auch am Gegner rühmen, was rühmenswert ist. Falls die Franzosen jedoch geglaubt haben sollten, mit Mannschaften der Kaiserlichen Marine wäre leichter fertig zu werden als mit Truppen der Armee, so hatten sie sich grausam getäuscht. Ein heißes Ringen war es gewesen. Unter blutigen Opfern hatte es stolze Erfolge gebracht. Mit Belgiern und Engländern hatte man sich vor Antwerpen herumgeschlagen, nun auch zum ersten Male mit Franzosen. Und die Gewissheit, allen, wer auch kommen mochte, überlegen zu sein, sie verlieh ein eigenes ruhiges Gefühl selbstsicherer Zufriedenheit. Der Tag von Lombardzyde wird allen unvergeßlich bleiben, die ihn mitgemacht haben. An ihm haben die „blauen Jacken“ die „roten Hosen“ gründlich vermöbelt. Es war ein Ehrentag für die einst so stolze Marine des Kaisers. Und wenn auch jetzt nur diejenigen laut von ihm reden, die die Treue zum Vaterlande, wie es einstens war, nicht gebrochen haben, so wird doch die Stunde kommen — ob bald, oder später, ganz sicher, sie kommt! —, wo der Name Lombardzyde auch in weiteren Kreisen unserer Volksgenossen wieder aufleben wird. Wo eine deutsche Bataillonsfahne siegreich den Stürmenden vorangeflattert hat, wird deutscher Geist die Erinnerung pflegen. Heilig und hehr war uns von alters her die Waffenehre. Heilig und hehr wird sie uns auch künftig wieder sein. Durch den Sumpf fremdartiger Verweichlichung wird sich das deutsche Volk hindurcharbeiten. Es wird die Nebel des Pazifismus, jenes eitlen Schaumgebildes, das uns den klaren Blick für des Lebens harte Wirklichkeit zu trüben sucht, zerstreuen. Und dann wird es sich zurückfinden zur Quelle seiner Tüchtigkeit, die dort ihren Ursprung hat, wo Kraft des Körpers und Reinheit des Willens einträchtig beisammen wohnen.
Wir haben Wort gehalten,
Wir Jungen und wir Alten.
Getreu dem Eid, den wir geschworen,
Dem Lande treu, das uns geboren,
Und treu dem Raiser bis zum Tod,
So gingen wir getrost zu Gott.
(Auf dem Grabstein in Ostende; verfaßt von Walther Uthemann.)