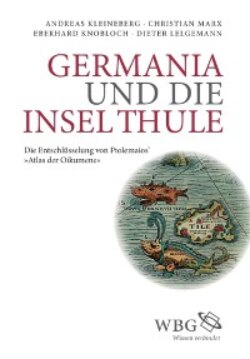Читать книгу Germania und die Insel Thule - Eberhard Knobloch - Страница 9
1.2.1.2 Die von Ptolemaios verwendeten Quellen
ОглавлениеFür die Identifizierung der von Ptolemaios genannten Orte ist es wichtig zu fragen, woher er Informationen über sie erhalten konnte. Zwar berichtet Ptolemaios davon, dass seine Darstellung der oikumene auch auf eigener Anschauung basiere (GH VII, 5, 1), jedoch dürfte seine Reisetätigkeit nicht allzu umfangreich gewesen sein. Auch Germanien, Gallien und die römischen Provinzen an der Donau hat er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht selbst besucht, so dass seine Beschreibung dieser Gebiete nicht auf eigener Ortskenntnis, sondern ausschließlich auf fremden Quellen beruht.
Grundlage der gesamten ”Geographie“ bildet das Werk des Marinos von Tyros, eines Geographen des 1./2. Jahrhunderts, über den wir unsere Kenntnis – abgesehen von einigen Hinweisen bei dem arabischen Geographen al-Mas`ūdī (gest. 956) – allein Ptolemaios verdanken. Im ersten Buch der ”Geographie“ würdigt er einerseits die wissenschaftliche Leistung des Marinos, andererseits setzt er sich auch kritisch mit ihm auseinander. Marinos sammelte nicht nur eine gewaltige Fülle geographischer Informationen, wobei er ”nahezu alle Berichte seiner Vorgänger mit Sorgfalt betrachtet hat“ (GH I, 6, 1), sondern er verfasste auch zahlreiche Schriften, wozu beispielsweise Verzeichnisse von Orten gleicher geographischer Breite oder gleicher geographischer Länge gehörten (GH I, 18, 4). Von besonderer Bedeutung ist der von Marinos angefertigte und mehrfach überarbeitete Entwurf einer Weltkarte.
Ptolemaios verglich jedoch, wie er selbst sagt (GH I, 17, 2), die Angaben des Marinos auch mit neueren, d. h. nach dessen Arbeiten entstandenen Dokumenten. Leider macht Ptolemaios in seinem Ortskatalog keinerlei Angaben zu diesen Materialien. Anhand einiger Hinweise, die er selbst im ersten Buch der ”Geographie“ gibt, sowie anderer antiker Zeugnisse lassen sich jedoch verschiedene Arten von Quellen, wie er sie benutzt haben dürfte, ermitteln:
Itinerarien: Hierbei handelt es sich um Straßenverzeichnisse, die Etappen und Entfernungen von Landwegen angeben (vgl. OLSHAUSEN, S. 87–90). Die bedeutendsten erhaltenen Itinerarien, die allerdings erst aus nachptolemäischer Zeit stammen, sind das Itinerarium provinciarum Antonini Augusti (Anf. 3. Jh.) und die im Mittelalter entstandene, aber auf einer antiken Vorlage beruhende Tabula Peutingeriana; diese stellt ein Beispiel für ein Itinerarium in Kartenform dar. (Eine Übersicht über die erhaltenen antiken Itinerarien findet sich bei LÖHBERG, S. 3–5.)
Periploi (Sing. Periplus): Dies sind Beschreibungen von Seerouten mit Angaben zum Küstenverlauf, von Distanzen, Geländemarken wie Flussmündungen oder Vorgebirgen und anderen nautischen Informationen. Periploi waren für Ptolemaios bei der Darstellung der Küsten von Bedeutung (vgl. GH I, 18, 6; zu den Periploi s. GÜNGERICH; MEYER; OLSHAUSEN, S. 81–87).
Einzelkarten: Ptolemaios erwähnt ausdrücklich, dass er Einzelkarten verwendet habe (GH I, 19, 1), um die Fehler in der Darstellung des Marinos zu verbessern.
Reiseberichte: Im Zusammenhang mit seinen theoretischen Ausführungen zur kartographischen Darstellung der oikumene (Buch I) führt Ptolemaios selbst mehrere Berichte von Militär- und Handelsexpeditionen zu Land und auf See an.
Astronomisch-geographische Fachliteratur: Diese Literatur stand Ptolemaios in der Bibliothek von Alexandria zur Verfügung. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Werke des Eratosthenes (ca. 276–194 v. Chr.) und des Hipparchos (ca. 160–125 v. Chr.) gewesen. Hipparchos wird in der ”Geographie“ von Ptolemaios zweimal erwähnt (GH I, 4, 2 und I, 7, 4), Eratosthenes wird im Almagest (I, 12 p. 68 Heiberg) genannt (zu Eratosthenes s. LELGEMANN 2010).
Für die römischen Provinzen bildete insbesondere die Raumerfassung durch Militär und Verwaltung die Grundlage der geographischen Informationen. Neben (militärischen) Karten und Itinerarien dürfte Ptolemaios hier auch Materialien nach Art der dimensuratio provinciarum, einer Lagebeschreibung der Provinzen, oder der Notitia dignitatum, eines Verwaltungshandbuches, verwendet haben. Von beiden vermitteln uns aus der Spätantike erhaltene Exemplare eine Vorstellung. Bedeutsam ist sicherlich auch die Chorographia des M. Vipsanius Agrippa (64 oder 63 – 12 v. Chr.) gewesen, die einerseits ein Distanzenverzeichnis, die sog. Commentarii, andererseits eine bildliche Darstellung der oikumene umfaßte, die in Rom in einer Säulenhalle ausgestellt war.
Auch die topographischen Kenntnisse über Germania Magna dürften zu einem nicht unbeträchtlichen Teil auf die Erkundungen der römischen Armee zurückgehen, deren Ergebnisse in Form von Kriegsberichten und sicherlich auch von Karten festgehalten wurden. Daneben werden die Berichte von Händlern Informationen, beispielsweise über die Siedlungsgebiete der einzelnen Stämme, geliefert haben (zu den Informationsquellen für Germania Magna s. Abschnitt 2.1.2).
Leider ist keine der von Ptolemaios verwendeten Quellen erhalten, so dass ein Vergleich mit den ptolemäischen Angaben nicht möglich ist. Dies gilt nicht nur für Germania Magna, sondern für die gesamte ”Geographie“. Besonders schmerzlich ist der Verlust der erwähnten Karten, auf die es allerdings Hinweise in der antiken Literatur gibt (s. STÜCKELBERGER, S. 132f.). Eine Ausnahme bildet der sog. ”Artemidor-Papyrus“ aus dem 1. Jh., der neben einer Küstenbeschreibung der Iberischen Halbinsel des griechischen Geographen Artemidoros (1. Jh. v. Chr.) eine – allerdings unfertige – Kartenskizze enthält (zum Artemidor-Papyrus s. CANFORA 2008 und SETTIS).
Obwohl Ptolemaios bemüht war, möglichst die neuesten Materialien zu verwenden (GH I, 67, 2), dürfte es angesichts des immensen Umfanges der Aufgabe, die er sich gestellt hat, nämlich die kartographische Erfassung der ganzen damals bekannten Erde, nahezu unmöglich gewesen sein, für alle behandelten Gebiete aktuelle Informationen zu erhalten, zumal diese gewiss eher in Rom als in der Hauptstadt der Provinz Aegyptus zur Verfügung standen. Ptolemaios und auch Marinos stützten sich also häufig auf Quellen, die damals bereits mehrere Jahrzehnte, in einigen Fällen sogar mehrere Jahrhunderte alt sein konnten. Dies erklärt beispielsweise das Fehlen wichtiger Orte oder Lokalisierungen von Volksstämmen, die im Widerspruch zu den Angaben anderer Quellen stehen; auch können so Orte oder Militärstützpunkte bei Ptolemaios verzeichnet sein, die in der Mitte des zweiten Jahrhunderts bereits aufgegeben worden waren.