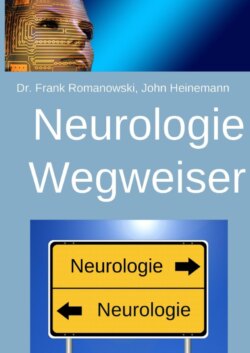Читать книгу Neurologie-Wegweiser - Frank Romanowski - Страница 7
Оглавление5. Messtechniken:
5.1. EEG (Elektro EnzephaloGramm)
Das EEG ist eine Messung der Hirnströme.
Die Nervenzellen funktionieren mit elektrischem Strom. Allerdings viel schwächer als in der Steckdose und auch noch viel schwächer als die elektrischen Impulse des Herzens, die beim EKG abgeleitet werden. Das EEG ist quasi ein EKG vom Gehirn. Nervenzellen senden elektrische Impulse aus, wenn sie aktiv sind. Diese Impulse lassen sich auch durch die Haut und den Schädel messen, da sie sich auch bis an die Oberfläche hin ausbreiten. Mit den Elektroden, die auf die Haut aufgeklebt werden, lassen sich diese elektrischen Impulse messen.
Was kann man aus den elektrischen Impulsen ablesen?
Gedanken lesen, wie viele vermuten, kann man mit dem EEG nicht.
Es lassen sich aber Unterschiede zwischen den beiden Hälften des Gehirns ableiten. So kann man Stellen des Gehirns sichtbar machen, die zum Beispiel nicht richtig funktionieren.
Auch gibt es eine Überfunktion der Gehirnzellen, die auch im EEG sichtbar werden. Dies ist zum Beispiel der Fall bei epileptischen Anfälle, so genannten Krampfanfällen. Dabei ist das Gehirn übermäßig aktiv, sendet Impulse aus, die nicht beabsichtigt sind und zum Beispiel zu Bewegungen am ganzen Körper führen, die dann wie ein epileptischer Anfall aussehen.
Um die Hirnströme zu messen, bekommt der Patient eine Haube oder ein Netz mit 20 Elektroden übergestülpt. Die Elektroden sind in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet, damit die einzelnen EEGs vergleichbar bleiben.
Ein Standard-EEG dauert zusammen genommen etwa eine halbe Stunde. Die Krankenschwester bzw. medizinisch-technische Assistentin bringt die Elektroden auf dem Kopf an. Die eigentliche Elektroenzephalografie dauert meist nur 20 Minuten.
Das EEG ist nicht gefährlich. Es werden auch keine Stromstöße versetzt, da nur gemessen wird.
Wichtig für ein gutes Ergebnis ist, dass man sich entspannt. Deswegen wird das EEG auch die meiste Zeit mit geschlossenen Augen abgeleitet. Auch ist es wichtig, dass störende Einflüsse aus der Umwelt ausgeschlossen sind. Besonders störend ist ein eingeschaltetes Handy, da die elektrischen Wellen des Handys viel stärker sind als die Impulse des Gehirns.
5.2. Ultraschallmessung der Durchblutung (Dopplersonographie):
Die Dopplersonographie in der Neurologie wird dazu benutzt, um Blutflüsse in den Arterien zu messen. Es lässt sich damit die Durchblutung im und zum Kopf und zum Gehirn bestimmen.
Das Prinzip: Jeder kennt beim Formel-1Rennen das Geräusch, wenn ein Rennwagen an einem vorbeifährt: "Äääääääääähhhhhoooooooooohh"
Die Frequenz des Motorengeräusches wird beim Wegfahren niedriger. Je nachdem wie schnell der Wagen fährt, umso niedriger wird der Ton, umso tiefer brummt der Motor, wenn er an einem vorbei gefahren ist. Dies ist der sog. Dopplereffekt. Das gleiche Prinzip der Frequenzstauchung und Dehnung in Abhängigkeit der Geschwindigkeit, der Blutflussgeschwindigkeit, wird medizinisch beim Dopplersonographieren genutzt:
Der Rennwagen sind hier die roten Blutkörperchen in den Arterien, die am aufgesetzten Mikrofon schnell vorbei fahren. Das Mikrofon steckt in der Ultraschallsonde und funktioniert wie das menschliche Ohr. Je nachdem wie schnell die roten Blutkörperchen vorbei fließen, gibt es ein Signal mit veränderter Frequenz. So lassen sich die Blutflussgeschwindigkeiten in den Gefäßen messen und der Durchmesser der Gefäße bestimmen.
Auf diese Art und Weise lassen sich auch Gefäßverengung oder Kalkablagerungen auf den Gefäßwänden feststellen. So können Durchblutungsstörungen gefunden werden.
Auch diese Untersuchung ist ganz ungefährlich, da nur mit einem Mikrofon die Gefäße abgehört werden und dieses keinen Einfluss auf den Körper hat.
5.3. Nervenleitgeschwindigkeitsmessung (NLG):
Die Nerven an Armen und Beinen lassen sich vermessen. Sie liegen vergleichbar mit Stromkabeln teilweise direkt unter der Haut.
Die Nerven an Armen und Beinen sind hauptsächlich für das Gefühl, besser gesagt für die Sensibilität und die Bewegung der Muskeln in Armen und Beinen zuständig. An bestimmten Stellen lassen sich z.B. am Handgelenk die Nerven mit einem Stromimpuls reizen und die Bewegung des Muskels, der dazu gehört messen.
Oder es wird die Haut gereizt und der Stromimpuls, der dann durch den Nerv geht, über den Nerv gemessen. Auch die Geschwindigkeit, mit der sich diese Stromimpulse ausbreiten, lassen sich messen. Bei bestimmten Veränderungen an den Nerven sind diese verlangsamt.
Oft ist es auch wichtig, festzustellen, wo die Verzögerung, also der Schaden am Nerv liegt.
Die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit ist mit Stromimpulsen verbunden, die mancher als Kribbeln, andere als leicht schmerzhaft empfinden.
Auf jeden Fall ist das unangenehme Gefühl, die Missempfindung durch den Strom nach dem Abschalten wieder vorbei. Die Messung ist ungefährlich, es sei denn, man hat einen Herzschrittmacher, der sich verstellen kann, dann sollte die Messung nicht ohne weiteres durchgeführt werden.
5.4. Somatosensibel evozierten Potentiale (SEP):
Ausgelöste Hirnreaktion durch einen Stromreiz: sogenannte evozierte Potentiale:
Wenn man die Ausbreitung des Stroms zum Beispiel nach einer Reizung der Nerven an den Fingern bis zum Gehirn verfolgt, nennt man diese Messung evozierte Potenziale. Dabei wird der Stromimpuls als Reaktion des Gehirns, wie beim EEG an der Stelle des Gehirns abgeleitet, wo er ankommt.
Man kann so auch die Nervenleitgeschwindigkeiten der Nerven messen, die hinter den Nerven an Armen und Beinen im Rückenmark und Gehirn kommen.
Die Nerven des Gehirns und Rückenmarkes werden als Zentrales Nerven System (ZNS) bezeichnet und die Nerven an Armen und Beinen als peripheres Nervensystem.
Man kann mit dieser Methode auch die sogenannten Hirnnerven messen, zu denen z. Bsp. der Gehörnerv zählt. Dazu wird der Gehörnerv mit Tönen über einen Kopfhörer gereizt und die ankommenden Impulse über dem Gehirnteil durch die Haut gemessen, das für das Hören zuständig ist.
Der Sehnerv lässt sich ähnlich vermessen, indem er durch die intensive Betrachtung eines wechselnd schwarz-weißen Schachbrettmusters gereizt wird (siehe Kapitel 5.5. „VEP“).
Beide Messmethoden sind völlig ungefährlich, da weder das Licht noch die Geräusche schädlich sind. Allerdings kann einem etwas schwindelig werden, weil die Orientierung bei der Messung etwas abgelenkt ist.
5.5. Visuell evozierte Potentiale (VEP):
Mit den visuell evozierten Potentialen (VEP) lässt sich die Sehbahn beurteilen. Der Patient bekommt dazu auf einem Bildschirm ein Schachbrettmuster mit schwarzen und weißen Feldern gezeigt. Die Darstellung des Bildes wird dabei bis zu 250 Mal wiederholt, wobei die Kontraste wechseln. Die zeitlichen Abstände sind so groß, dass das Gehirn immer wieder in den Ruhezustand zurückkehrt, um dann auf ein neues Bild wieder mit einem Aktionspotential zu reagieren.
In aller Regel misst man diese evozierten Potentiale über der Sehrinde am Hinterkopf, prinzipiell lassen sich aber auch die anderen Zentren der Sehbahn untersuchen. Normalerweise vergehen etwa 100 Millisekunden bis das Signal von der Netzhaut im visuellen Kortex ankommt und an der Kopfhaut abgeleitet werden kann. Bei Erkrankungen des Auges, der Netzhaut oder der Sehbahn verlängert sich diese sogenannte Latenzzeit.
Mit den VEP lassen sich viele Störungen des Sehapparats nachweisen, von Netzhautschädigungen über Entzündungen des Sehnervs bis hin zu schweren degenerativen Hirnerkrankungen wie der Multiplen Sklerose.