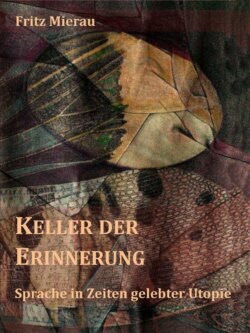Читать книгу Keller der Erinnerung - Fritz Mierau - Страница 13
Glanz und Ohnmacht des Scharfsinns
ОглавлениеDu kennst meinen Wahn. Ich biete Wissenschaft nicht feil,
ich tanze Wissenschaft. Sei mein Richter, Roma.
Viktor Schklowski an Roman Jakobson
Viktor Schklowski behauptete 1923, sein Scharfsinn sei die Folge einer fatalen Gleichzeitigkeit. Im ersten Vorwort zu einer Sammlung von kunstkritischen Feuilletons aus den Jahren 1919 – 1921, die er als Emigrant in Berlin unter dem Schachtitel „Rösselsprung“ herausgab, findet sich diese Passage:
Manche sagen: In Rußland sterben die Menschen auf der Straße, in Rußland ißt man Menschenfleisch oder könnte es zu essen gezwungen sein …
Andere sagen: In Rußland sind die Universitäten in Betrieb, in Rußland sind die Theater voll.
Entscheiden Sie, was Sie glauben.
Entscheiden Sie lieber nicht.
In Rußland gibt es das eine wie das andere.
In Rußland ist alles so widersprüchlich, daß wir alle, ob wir wollen oder nicht, scharfsinnig geworden sind.
Wer mit „wir alle“ gemeint war, bleibt undeutlich. Zu den Regeln des Scharfsinns, nach denen Schklowski diesen Ursprungsmythos schuf, gehört der generalisierende Gestus. Daß er aber durchaus Mitbetroffene im Auge hatte, läßt er an einer Stelle im „Rösselsprung“ durchblicken. Man müsse als einer, der auf Größeres aussei, gelegentlich auch einmal etwas Kleineres schreiben – so wie bei Mark Twain Tom Sawyer, König von England geworden, mit dem mächtigen Staatssiegel Nüsse knackt – etwas Kleineres, und sei es, damit kein anderer an deiner Stelle schreibt und „dich mit seinem Scharfsinn“ quält.
Schklowski hielt sich auf seinen Scharfsinn viel zugute und beklagte sich, wenn einer aus der Zunft ihm den absprach. Das war freilich die Ausnahme. Eher bot er des Guten zuviel. So meinte Jewgeni Samjatin anzüglich, Schklowski drücke sein Scharfsinn offenbar derart, daß er ihn kaum halten könne. Zu seiner Verteidigung pflegte Schklowski anzuführen, Scharfsinn sei das Instrument für seinen Umgang mit sich und der Welt und wenn das noch zu sehr auffalle, dann habe er das Instrumentale dieses Umgangs nicht virtuos genug gehandhabt. Daß er selber jemanden mit diesem Scharfsinn quäle, daß er scharfsinnig tief verstörende Entscheidungen treffe und seine Freunde vergraule, ist Schklowski schmerzlich und bis zu Tränen bewußt gewesen wie zuletzt noch im Zwist mit seinem Jugendfreund und Bruder im Geiste, dem Rivalen in der „Zoo“-Liebe zu Alja/Elsa – Roman Jakobson.
Mit dem Verweis auf das Instrumentale des Scharfsinns banalisierte Schklowski freilich seinen Fall. Die Sache war viel radikaler, sie war physiologischer Natur. Sentimentalist, der er war, fürchtete er durchaus, in den Ereignissen, die er zu bewältigen hatte, nicht richtig vorzukommen. Nicht Instrument, sondern Element und Elixier war ihm dieser Scharfsinn.
„Ich berichte von Ereignissen und stelle aus mir ein Präparat für die Nachwelt her“, hatte es 1919 in dem ersten Erinnerungsbuch des 26jährigen geheißen. Später, 1926, als die Hybris der Selbstschöpfung allmählich dem Terror der Selbstverleugnung, der Selbstverstümme-lung unterlag, hörte sich das anders an. Etwa in der Flachs-Parallele, die Schklowski für sich zog: „Ich bin Flachs in der Rotte. Schaue in den Himmel und fühle den Himmel und den Schmerz“, heißt es in einem Brief an Roman Jakobson. Und an anderer Stelle zur gleichen Zeit: „Wenn der Flachs eine Stimme hätte, würde er bei seiner Bearbeitung schreien. Man zieht ihn aus der Erde, am Kopf. Mit der Wurzel. Man sät ihn dicht, damit er sich selbst unterdrückt und kümmerlich wächst, sich nicht weiter verzweigt. Der Flachs braucht die Unterdrückung.“ Ungedruckt blieb damals der Satz über den Selbstmord des Dichters Sergej Jessenin: „Jessenin hat die Bearbeitung nicht überstanden.“
Diese betonte, besessene Körperlichkeit im Aufbau seiner Personnage, diese vertraute Nähe zu seiner Lektüre, dieses auf Teufel komm raus erzwungene Anwesendsein in den wechselnden Zeiten hat die Unheimlichkeit behalten, die sie für die Zeitgenossen hatte.
Sergej Eisenstein begrüßt Schklowski als einen „unverbesserlichen Literaturvoyeur“. Juri Tynjanow glaubte, sein Leben wäre nicht geglückt, wäre er Schklowski nicht begegnet. Boris Eichenbaum bescheinigte ihm den ausgesprochenen „Appetit“ auf Literatur und lobte ihn als einen Heißsporn, der „nicht nur ein russischer Jude, sondern dazu noch ein russischer Deutscher“ sei: „In dir kocht das Blut.“ Roman Jakobson sehnte sich in Prag nach Schklowski „bis zum physischen Schmerz“.
Der Gegenseite erschien Viktor Schklowski als Extremist, als Freibeuter, als „homo novus“ im Sinne des Parvenus, als gefährlich und verrückt, bestenfalls – wie bei Leo Trotzki – als verantwortlich für eine mißliche „Frühgeburt“ – den russischen Formalismus. Die Kukryniksy, die Karikaturisten des Pandämoniums der russischen revolutionären Literatur, zeichneten diesen „Formalisten“, wie er sich sogar an Lew Tolstoi vergriff: mit der Lupe in Tolstois Bart ein Haarkräuselchen betrachtend oder Tolstoi beim Pflügen im Genick sitzend und aus seinem Tolstoi-Buch rezitierend. Ein Gaukler also, ein Hasardeur, der den „Tristram Shandy“ genüßlich zerlegte, ohne Englisch zu können, und den „Don Quijote“, ohne Spanisch zu können. Manche wollten auch herausgefunden haben, daß in „Zoo“ die Anatomie der Hyäne falsch beschrieben sei.
Das Unheimlichste an dieser Existenz war vermutlich die rasende Gier nach Gegenwart, nach dem Gegenwärtigsein, eine Gier, die zu befriedigen Viktor Schklowski nicht müde wurde, selbst um den Preis skandalöser Kapitulationen. Alles um dabei zu sein? Alles um gut zu gedeihen? Oder am Ende doch, um die große Familie zu ernähren? „Der Flachs braucht Unterdrückung.“ Garantie für die Unversieglichkeit des Scharfsinns? Immer wieder das Paradigma des „Rösselsprungs“: Kannibalismus und Kunstrausch? Ließ sich Wissenschaft nur auf diese Weise weiter tanzen? Ein nie endendes Puschkinsches „Gelage während der Pest“?
Der Glücksrausch kommt uns in der Schlacht
Und vor des Abgrunds dunklem Schacht …
Ganz gleich, wo Untergang uns droht,
Das Herz des Menschen reizt der Tod
Mit unerklärlichen Genüssen …
Die Kapitulationen.
1923 die Kapitulation des Berliner Emigranten, eines rechten Sozialrevolutionärs, vor den Bolschewiki im Schlußbrief von „Zoo“.
1932 die Kapitulation des reuigen „Formalisten“ vor einer – wie er hoffte – aufgeklärten Soziologie im „Denkmal eines wissenschaftlichen Fehlers“.
1933 die Kapitulation des gegenwartsversessenen Journalisten vor der gegenwartsvernichtenden Macht des NKWD in dem Gemein-schaftswerk zum Lob des Weißmeerkanals „J. W. Stalin“, in dem Schklowskis Name als Autor am häufigsten auftaucht.
1934 die Kapitulation des geschichtskundigen revolutions-erfahrenen Russen, eines Mannes, der es besser wußte, vor einer verunsicherten Parteiführung, die Dostojewskis Ahnungen vom Gang der Gesellschaftsumstürze am liebsten ungeschrieben gesehen hätte: Wenn Dostojewski auf dem Schriftstellerkongreß auftauchte, erklärte Schklowski, müßten „wir, die Erben der Menschlichkeit“, ihn als „Verräter“ vor Gericht stellen.
1958 im Streit um den Nobelpreis für Boris Pasternak die Kapitulation vor einer Verbandsbürokratie in Schklowskis Beschimpfung des Dichters als geschichtsblind, dem er in „Zoo“ (1923) das Empfinden für den „Zug der Geschichte“ bescheinigt hatte.
Endlich die Kapitulation vor einem bornierten Ost-West-Denken im Streit mit Roman Jakobson um Majakowskis Rang.
Einen Monat bevor Schklowski im Oktober 1923 nach Verkündung der seit Monaten beantragten Amnestie nach Moskau fuhr, schrieb er im letzten Berliner Brief an Maxim Gorki:
Ich breche auf. Ich werde lügen müssen, Alexej Maximowitsch.
Ich weiß, ich werde lügen müssen.
Ich erwarte nichts Gutes.
Die Kapitulationen – Lüge? Ein Lügendach für die Arbeiten in kommenden Gegenwarten? Nennt man das Schicksal spielen oder Willenskraft beweisen?
Immerhin.
„Zoo oder Briefe nicht über die Liebe“ durfte 1924 in Rußland erscheinen, um die meisten Briefe von Alja/Elsa gekürzt und vor allem gekürzt um die aufsässig-dreiste Bitte dessen, der sich hier ergibt, man möge ihn nicht töten wie jene Kämpfer im kaukasischen Erzerum, die ihre Kapitulation dadurch anzeigten, daß sie den rechten Arm hoben: Man fand sie alle tot mit Säbelhieben in Arm und Kopf. Schklowski hat das Erscheinen seines alten Texts nicht mehr erlebt. Er starb 1984. Die Berliner Ausgabe von „Zoo“ erschien erst wieder 1990.
Immerhin.
Im „Denkmal eines wissenschaftlichen Fehlers“ überlebte die Erinnerung an die prinzipielle Nützlichkeit morphologischer und evolutions-dynamischer Studien.
Immerhin.
Als er sich auf das GULAG-Buch des NKWD über den Weißmeer-Kanal einließ, wußte er Bescheid. Mit einer Empfehlung des NKWD-Volkskommissars Jagoda war er zuvor schon seinen Bruder Wladimir besuchen gefahren, der dort zu Zwangsarbeit verurteilt war. Von den Lagerbehörden gefragt, wie er sich fühle, habe er geantwortet: „Wie ein Silberfuchs zu Besuch im Pelzgeschäft.“ Schklowski hat den Silberfüchsen, die dort nicht nur zu Besuch weilten, zu helfen versucht. Mit Eingaben, mit Bürgschaften.
Vor allem seinem Bruder, der zwar nach drei Jahren freikam, einer neuen Verbannung aber nicht entging und sie nicht überlebte. Später seinen alten Freunden Emmanuel German (Emil Krotki) und Leonid Wolkow-Lannit, dem Fotojournalisten, und dem Literarhistoriker Arkadi Belinkow, der sich als Schklowskis Schüler verstand. Mußte einer gesellschaftspolitisch so unberechenbar bleiben, um sich seinen literarischen „Appetit“ auf Speisen zu bewahren, die sonst nicht auf den Tisch kamen, wenn es um das neue Erzählen ging? Schklowski liebte den „Tristram Shandy“ und den „Don Quijote“ für ihre Episodenstruktur, für ihre Abschweifungssuada. Und recht gesehen, ist er ja geradezu dem Redefluß dieser Bücher entsprungen. Noch im Alter nannte er Sancho Pansa seinen Lehrer.
Schklowskis Briefroman „Zoo“ bezieht sich mit dem Untertitel der ersten Fassung „Die dritte Héloïse“ auf Abaelards und Héloïses Liebesgeschichte, wie sie in den Briefen der beiden aus dem beginnenden 12. Jahrhundert überliefert ist, und auf die „Neue Héloïse“, den Briefroman „Julie“ von Rousseau – beides Briefwechsel angesichts verbotener Liebe. Allerdings ein eher parodistischer Bezug, und es wäre auch nicht zu vergessen, daß Alja, die Adressatin der Briefe und Autorin der Antworten, ja Triolet hieß, Elsa Triolet, was schon vom Namen her die Dreizahl aufruft.
Mit diesem geschwinden Blick über die Zeiten hat Viktor Schklowski viele Male Vorschläge gemacht, die er, wenn Zweifel an ihrer political correctness aufkamen, auch sofort wieder zurückzog – soll man sagen: kapitulierend korrigierte?
Völlig ungeschützt und unbekümmert um Begriffsgeschichte wie seinerzeit bei der Erfindung seines „Scharfsinns“ kreierte Schklowski ein sowjetisches Barock und definierte es als das „Leben des intensiven Details“, zu entdecken in Eisensteins Filmen „Oktober“ und „Mexico“, vorher in der Prosa Babels und Mandelstams. Groß ausgeprägt finde es sich in der südrussisch-ukrainischen Schule – Odessa als geistige Lebensform. Dieser Üppigkeit folge nun eine neue Einfachheit. Doch damit nicht genug. Kurz darauf verkündete Schklowski auf dem Schriftstellerkongreß 1934 einen neuen Sentimentalismus. Nicht daß das unbedingt zutraf. Immerhin attackierte er eine falsche Einfachheit und nach Schklowskis Partisanenstückchen verstummte die Debatte darum nie ganz.
Mit dem phänomenalen Blick für Parallelen, Vorläufer, Matrizen erkannte Schklowski in neuen Texten sofort die entsprechenden Anleihen. Oksana Bulgakowa hat in ihrer Eisenstein-Biografie auf eine schöne Episode aus dem Jahr 1941 aufmerksam gemacht. Schklowski, der ursprünglich für Eisenstein das Libretto zum „Iwan Grosny“ schreiben sollte, fand, nachdem der Regisseur es in kirchenslawisch stilisierten Versen selbst verfaßt hatte, unmittelbar die Muster aus „Rigoletto“ und Dumas’ „Musketieren“. Auch fand er das Schema der Propagandafilme zur Bekämpfung der Parteiopposition wieder.
Was Schklowskis letzte Kapitulation angeht, so verbarg sich dahinter natürlich jene erste grundsätzliche Entscheidung, in die er 1923 „Zoo“ münden ließ: „Das russische Berlin fährt nirgendshin … Es hat kein Schicksal … Es ist falsch, daß ich in Berlin lebe …“ Zwar ging es in der Debatte mit Roman Jakobson zunächst um Majakowskis Rang und die Gründe für seinen Selbstmord sowie um die Bedeutung einer subtilen Linguistik für die Poetik; biographisch war das mit dem Scheitern seiner vierzigjährigen Freundschaft mit Roman Jakobson verbunden – die letzte zweimalige Umarmung verband die beiden 1956 auf dem Moskauer Flugplatz, Jakobson würde ihrer sehnsüchtig gedenken. Doch worum es eigentlich ging und was Viktor Schklowski nicht wahrhaben wollte, war dies: Das russische Berlin, die russische Emigration hatte sehr wohl ein Schicksal, ein bedeutendes Schicksal, wovon Roman Jakobsons Werk das beredteste Zeugnis ablegte. Daß die Antwort auf die Bitte: „Sei mein Richter, Roma“ so ausfallen könnte, war nicht vorauszusehen gewesen.
Nur einer unter all seinen Zeitgenossen hat bei größter Nähe die entschiedene Distanz gewonnen, die es braucht, um diesen Mann in die Ewigkeit zu projizieren: Ossip Mandelstam. Mandelstam gehörte zu den frühen Bewunderern Schklowskis in Petrograd und während der Verfolgungen der dreißiger Jahre waren die Schklowskis diejenigen, bei denen die Mandelstams immer Zuflucht fanden und Gelegenheit, seinen Geist frei walten zu lassen, nicht nur weil beide Familien in der Nastschokinski pereulok wohnten.
„Sein Kopf“, schrieb Mandelstam in einem Text der letzten Jahre, „erinnert an den weisen Schädel eines Säuglings und eines Philosophen. Ein lachendes und denkendes Schilfrohr. Ich stelle mir Schklowski dozierend auf dem Theaterplatz in Moskau vor. Die Menge umringt ihn und lauscht ihm wie einer Fontäne. Der Gedanke strömt ihm aus Mund, Nase und Ohren, strömt in gleichmäßigem Strom – immer neu und sich immer gleich. Alles verändert sich, auf dem Platz entstehen neue Gebäude, aber der Strahl strömt immer gleich aus Mund, Nase und Ohren. Die Fontäne war für das fünfte Jahrhundert nach Christi Geburt, was für uns der Kinematograph ist. Der Auftrag ist der gleiche. Schklowski steht auf dem Platz zur Unterhaltung der Zeitgenossen, doch sein Lächeln zeugt von der sprühenden kynischen Gewißheit, daß er uns überleben wird.
Er braucht eine Umrandung aus leichtem porösen Tuff. Er hat es gern, wenn man ihn stört, mißversteht und sich zurückzieht. Schklowskis Lächeln sagt: es geht alles vorüber, nur ich versiege nicht. Denken ist ein fließendes Gewässer.“