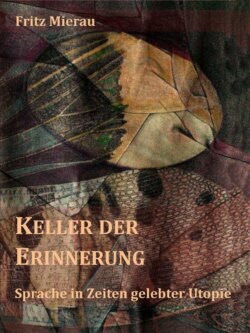Читать книгу Keller der Erinnerung - Fritz Mierau - Страница 16
„Russisches Fieber, fang an...“
ОглавлениеVergeltung und Vergebung bei Alexander Blok
Drei vorliterarische Begegnungen mit Alexander Blok
Verehrte Freunde, als mich die freundliche Einladung der „Limlingeröder Diskurse“ erreichte, ein Wort über Alexander Blok zu sagen, wollte es der Zufall, daß ich gerade wieder mit der deutschen Herkunft des Dichters befaßt war, und zwar aus folgendem merkwürdigen Grunde. Eine Cousine meines Schulfreundes, Gertraude Block, war, noch in der DDR, in den Zeitschriften Sowjetfrau und Sowjetunion auf Fotos des Dichters gestoßen und hatte die frappierende Ähnlichkeit ihres Mannes, Fritz Block, mit Alexander Blok bemerkt.
Auch in dem Gedicht „Ich bin genagelt an die Theke“ fand sie Gedanken ihres Mannes wieder. Daraufhin reiste sie nach Leningrad, besuchte das Blok-Museum und fand sich in ihrer Annahme bestätigt. Nun ist ja aus Bloks Autobiographie bekannt, daß sein Vater, Alexander Blok, aus einer norddeutschen Familie stammte, aber wie genau der Zusammenhang sein könnte, blieb unaufgeklärt und ich habe eben mich im Landeshauptarchiv Schwerin angemeldet, um der Sache noch ein wenig nachzugehen.
Würde sich der Zusammenhang bestätigen, so hätte es in meiner frühesten Jugend über die Verwandten meines sächsischen Schulfreunds eine erste unbewußte Begegnung mit Alexander Blok gegeben.
Jeder, der sich Blok zuwendet, stößt auf den Namen des Anwesens Schachmatowo, das den Beketows, der Familie der Mutter, gehörte, wo Blok seine Jugend verbrachte und das in der Revolution ein Opfer der Flammen wurde. Daß es bei Moskau lag, wußte man aus dem Briefwechsel Bloks, in dem Besuchern der Weg dahin beschrieben wurde. Das war vor dem ersten Weltkrieg. Aber ob das in den 60er Jahren noch eben so vor sich ging, war fraglich.
Man fahre, schrieb damals Blok, mit der Vorortbahn bis nach Podsolnetschnaja und dann müsse man sich weiter durchschlagen bis Tarakanowo, von dort sei es nur noch 1km.
Tatsächlich fuhr im Sommer 1970 ein Bus, in dem außer mir noch zwei Frauen saßen, die, wie sich zeigte, auch das ehemalige Schachmatowo suchten. Es waren die Schriftstellerinnen Margarita Aliger und Lidija Libedinskaja. Wir kamen glücklich an. Boblowo gibt es noch, woher Bloks spätere Frau stammte, Ljubow Dmitriewna Mendelejewa. Da waren die Wiesen, die Kornfelder, der Hafer, der rote Klee, die Feldraine. Von Schachmatowo war nichts mehr zu sehen außer dem Flieder und den Heckenrosen und darunter Reste von Ziegelsteinen. Ein Bröckchen nahm ich mit und bewahre es bis heute – 4/3/4 cm.
Die dritte Begegnung mit Blok vor der Literatur ist die, die uns heute zusammenführt, die Begegnung mit Sarah Kirsch. Wir kannten uns seit 1964, seit der Zusammenarbeit am „Mitternachtstrolleybus“, einer Anthologie neuester sowjetischer Lyrik. Aber Alexander Blok war eine Aufgabe ganz anderer Art, die auch ganz anders verband. Eine Karte Sarah Kirschs vom 10. Februar 1969 spricht beredt davon:
Lieber Fritz,
schönen Dank für die Blok-Texte. Ich war schon in der Metzer-Str., um darüber zu reden, doch nowbody was there. Aber habe ich nun Telefon, 4492435, ruf doch mal an. Wieviel ich übernehmen kann, richtet sich nämlich nach dem Ablieferungstermin, weil ich doch Anfang März ein feines Kind kriege und dann wahrscheinlich erst mal etwas beansprucht bin. Es sind natürlich sehr schöne Gedichte, vor denen man aber auch alle Hochachtung &. Manschetten hat. Man braucht etwas Zeit dazu. Karl hat schon aus reiner Freude 3 Stück übersetzt, sind ganz gut. Laß was von Dir hören und sei schön gegrüßt
von
Sarah
Sarah Kirsch hat dann Bedeutendes nachgedichtet. Wenn es erlaubt ist, aus ihren deutschen Fassungen eine besonders zu lieben, dann liebe ich „Geigenstimmen“.
Geigenstimmen
Aufsteigt der Mond aus langen Gräsern
Der rote Heldenkupferschild
Ins rotgemalte Meer klatscht gläsern
Musik wie eine Welle wild.
Was kreischst du wütend, Geigenbogen
Zu dieser Stunde, die jäh flieht
Ins Weltorchester einbezogen –
Was soll das aufgeregte Lied?
Lern du ins Abendrot dich fügen
Wie es die langen Gräser tun.
Die Stimme laß nach großen Flügen
Im Reich der luftgen Geigen ruhn.
Und nun: Russisches Fieber
Russisches Fieber, fang an …
Greises Bild im Sarkophage,
Hunde vor ihm belln die Klage,
Sterne, Orden, Kreuz am Frack …
Rollt der Karrn die Spur entlang,
Knarrt der Pfaff den Meßgesang ...
Etwas ist, das starb in ihm
Unersetzlich,
Doch verwehrt ist uns die Klage,
Uns verwehrt, es zu verehren,
Wutgeheul belln hier wie dort
Spießer, stumpf verkeilt zu Klumpen,
Um den Hort,
Bauch an Schwartenbauch, schrein Lumpen
Hier wie dort,
Hier wie dort …
Schwirre Zorn, ein Pfeil im Nebel,
Mein Gedicht, sing Seufzer Zorn.
Tot ist tot, wer fügt Gesichte
Fiebernden …
Februar 1918 – 8. April 1919
Deutsch von Elke Erb
Für die geistige Atmosphäre seiner Zeit so empfänglich geboren zu sein, wie Alexander Blok sich als Jüngling vorgefunden hatte, war ihm, dem Sproß der europäischen Jahrhundertwende, Quelle des Jubels und Entzückens, ewige Qual und tiefster Grund seines Untergangs.
Blok nannte diese Empfänglichkeit sein „inneres Gehör“. Gabe und Verhängnis des Dichters sei es, sein inneres Gehör so schärfen zu können und so anstrengen zu müssen, daß er die Musik des „Weltorchesters“ vernehme, des „Weltorchesters der Volksseele“, wie Blok sich zu sagen nicht scheute; nur im Einklang mit ihr gelinge das leichte Spiel der Kunst.
Die Kunst – Last, auszutragen, die die Schultern drückt.
Und doch – wie halten wir, die Dichter, uns im Schweben
Von Bagatellen, die das Leben tauscht, entzückt.
Unerschrocken hat der Dichter aufgenommen, was das „Weltorchester“ ihm zutrug – „das Klopfen ans Tor, das Knirschen, Pfeifen und Kreischen der Straße, das peitschende ‚Lied der Faïna’, die ‚Schritte des Komturs’, der Vergeltung üben kam, den Schicksalsgesang vom kommenden Grauen des weissagenden Vogels Gamajun, den Donnerflug des Sternenlichts und das Wutgeheul des ‚Russischen Fiebers’“. Daß ihm auch zugetragen wurde, was ihm unsagbar schien, schreckte den Dichter nicht. Erschrecken, zu Tode erschrecken würde ihn am Ende nur eins: das Verstummen der Musik.
Was Alexander Blok von früh an zu empfangen glaubte, waren Zeichen eines geistigen Gestaltwandels des Menschen, der „kosmische Entsprechungen“ haben und mit den größten inneren und äußeren Katastrophen verbunden sein würde, eines Gestaltwandels, der unweigerlich in eine neue Geschlechterauslese münden müsse, nach der dann das männliche „Prinzip“ und das weibliche „Prinzip“ im Menschen harmonischer verteilt sei als bisher.
Als im Dezember 1908 ein Erdbeben auf Sizilien hunderttausend Menschenleben forderte und die Gelehrten erklärten, die Erdkruste sei eben dort noch nicht fest genug, da fragte Blok mit einer seiner gewohnt kühnen Wendungen des Problems: „Sind wir aber sicher, daß die ‚Kruste’ über einer anderen, ebenso furchtbaren, nicht unterirdischen, sondern irdischen Elementarkraft, der des Volkes, fest genug geworden ist? ... Die Menschen der Kultur ... bauen wutschäumend Maschinen, bringen die Wissenschaft voran, voll geheimen Grimms bemüht, das Tosen der irdischen und unterirdischen Elementarkräfte, die bald hier, bald dort erwachen, zu vergessen und zu überhören. Und nur manchmal, wenn sie einhalten und um sich blicken, sehen sie jene Erde und betrachten sie wie eine Theatervorstellung, wie ein törichtes, aber unterhaltsames Märchen. Es gibt andere Menschen, für die die Erde kein Märchen, sondern eine wunderbare wahre Geschichte ist und die die Elementarkräfte kennen und selbst aus ihnen hervorgegangen sind – ‚Menschen der Elemente’. Sie sind ruhig, wie die Elementarkräfte, vorerst, und ihr Wirken gleicht, vorerst, leichten, warnenden Erdstößen.
Sie wissen [mit dem Prediger Salomo]: ‚Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausrotten, das gepflanzt ist, würgen und heilen, brechen und bauen...’“
Im Rußland des beginnenden 20. Jahrhunderts bedeutete Bloks Befund mehr und anderes als die allgemeine Zivilisationskritik der europäischen Moderne. In Rußland herrschte mit den Bauernaufständen, den politischen Morden vor der Revolution von 1905, mit der Gefährdung des Zarenhofs durch den Einfluß Rasputins eine Atmosphäre der Unruhe, des latenten Aufruhrs. Hier rief Kritik nicht nach Abhilfe, hier rief Kritik nach Umsturz, nach geistigem Umsturz, zu dem der politische lediglich den Anstoß gab. Die Phase nach dem politischen Umsturz von 1917 bedenkend, schreibt Alexander Blok:
„Der Mensch – ein Tier, der Mensch – eine Pflanze, eine Blume. Züge einer unerhörten, wie nicht menschlichen, animalischen Grausamkeit; Züge einer ursprünglichen, genauso nicht menschlichen, vegetativen Zärtlichkeit. All das – Gesichte, Masken, das Flirren unzähliger Gesichte; dieses Flirren bedeutet, daß der ganze Mensch in Bewegung gekommen ist, sein Geist, seine Seele, sein Leib ganz erfaßt sind von Wirbelbewegungen ...“
Alexander Bloks Gedicht spricht von den ersten Versen her die Sprache dieses geistigen Maximalismus. Trifft sie uns heute weiter so unmittelbar, weil wir uns immer noch am Anfang der von Blok beschriebenen Phase befinden?
1902
Eine Säule aus Feuer ging vor mir her.
Ich zählte der Schritte unendliches Meer.
Ich hört’ das Geknirsch und das schleppende Schreiten
Und bebte vor Glück, einem uferlos weiten.
1907
Das pfeift und quält und wirbelt: jeden
Kristall bewohnt die kalte Schrift.
Und meiner Seele Spinnwebfäden
Sie reißen, wo die Botschaft trifft.
1910/12
Mit festen, ruhigen Schritten auf das Haus zu
Kommt, tritt ein der Komtur.
Als schlüg die Nachtuhr rauh, aus wilder Kälte –
Die Tür steht sperrangelweit –
Ein Stundenschlag: „Du ludst mich ein zum Essen.
Da bin ich. Bist du bereit?“
1913
Dieser Blick, ob bös, ob gut gesinnt –
Besser wärs, er nähm uns nie zum Ziel!
Zu viel fremde Kraft, die in uns spricht,
Unerforschter Energien Spiel ...
Und die Trauer, ach! Dezennien nicht
Messen unsre Seele bis zum Grund –
Hören werden wir das Sternenlicht,
Seinen Donnerflug im schweigenden Rund!
1918/19
Russisches Fieber, fang an ...
Schwirre Zorn, ein Pfeil im Nebel,
Mein Gedicht, sing Seufzer Zorn.
Der dissonanten Musik des Weltorchesters so hingegeben und verpflichtet, hat Alexander Blok die Gemüter der Russen aufgerührt wie vor ihm vielleicht nur Alexander Puschkin. Er wurde bis zur Selbstverleugnung bewundert und bis zur Verweigerung des Handschlags verachtet. Frauen und Männer waren von der Begegnung mit ihm erschüttert wie nie wieder in ihrem Leben. Sergej Jessenin brach der Schweiß aus, als er Blok gegenüberstand. Anna Achmatowa habe am ganzen Leibe gezittert, als sie ihn zum erstenmal sah. Marina Zwetajewa hat sich gar nicht getraut, dem Dichter unter die Augen zu treten. Blok geriet in die Träume, in die Briefwechsel, in die großen russischen Künstlerromane des 20. Jahrhunderts – Pasternaks „Doktor Shiwago“ und Nabokovs „Gabe“ – und natürlich in die Gedichte: Seinem ersten Liebesgedicht für seine spätere Frau Vera setzte Nabokov einen Vers aus Bloks „Die Unbekannte“ voran – „Gebannt von einer Nähe sonderbar …“
Alexander Blok ist nicht nur als russischer Orpheus, als Dämon, als Seher, als Magier, als „Tenor“, tragende Stimme der Epoche, gefeiert worden, vielen erschien er als Ritter ohne Furcht und Tadel, als Gewissen Rußlands, als ein „Gerechter Gottes“. Pasternaks Doktor Shiwago erlebt Blok als eine „weihnachtliche Erscheinung“ im russischen Leben – „im nördlichen Stadtalltag und in der neuesten Literatur, unter dem Sternenhimmel der gegenwärtigen Straße und rund um die Lichtertanne im Salon dieses Jahrhunderts“. Und er ist geschmäht worden – als Verräter an Rußland, als Verräter an sich selbst, ein Verräter, dem nur vergeben werde, weil er ein Dichter sei. Verräter für die einen, weil er versuche, das Rußland des Irtysch, das Rußland, das Sibirien umgreife, mit Paris und Deutschland zu versöhnen. Verräter für andere, weil er in seinen Pakt mit den Elementarkräften die Bolschewiki einbeziehe. Er solle sich die zwölf Mordgesellen seiner Dichtung, die er in seiner apokalyptischen Vision durch Petrograd ziehen sehe, ziehen höre, in seine Wohnung gesetzt vorstellen, da werde er erleben, was das für „Volk“ sei.
Nikolai Gumiljow, der so etwas wie der Präzeptor, der Gesetzgeber der russischen Poesie der Jahrhundertwende war, hielt Alexander Blok für einen guten Menschen, aber schlechten Dichter, während Vladimir Nabokov, der seinerseits Gumiljow von allen russischen Dichtern der Jahrhundertwende am meisten schätzte, meinte, Blok sei einer der größten Lyriker, aber ein ganz schwacher Denker und Mensch.
Das Nachdenken über Alexander Bloks Rang und Gestalt war früh mit einem aufschlußreichen Passus eröffnet worden. Zur gleichen Zeit wie Bloks Essay über den Umgang mit den Elementarkräften erschien in Petersburg eine Studie über zeitgenössische Lyrik, in der es hieß: „Der Champion unserer Jungen ist zweifellos Alexander Blok.“ Er sei ganz im Sinne des Wortes und ohne alle Ironie – „die Zierde der kommenden Poesie, was heißt Zierde! – ihr Zauber. Er ist nicht nur ein wirklicher, ein geborener Symbolist, sondern selber ein Symbol. Seine auf Ansichtskarten gedruckten Züge zeigen uns einen eleganten Androgynen, aber seine absichtlich kokett-leidenschaftslose, feine Stimme verfügt natürlich über die zartesten und zärtlichsten Modulationen“. Das Androgyne – eine Maske natürlich, hinter der sich „ein ganz männlicher Typ von Liebe“ verberge. „Aber ich liebe Blok“, fährt der Verfasser fort, „durchaus nicht da, wo er im Vers von Liebe spricht. Das paßt gar nicht so zu ihm. Ich liebe Blok, wenn er nicht mit Kunst – was heißt schon Kunst? – sondern mit Zaubersprüchen die Liebe umkreist – ganz Andeutung, schmachtender Blick, kaum vernehmliche, aber schon bannende Melodie, zu der kein Wort von Liebe paßt.“ Man denke an das Gedicht „Die Unbekannte“:
Am Abend sind über den Restaurants
Die heißen Lüfte wild und taub...
Diese ganz banale Szenerie des Restaurants am Kanal: draußen die Brezelreklame des Bäckerladens, der Geck mit Melone, das Knarren der Ruder, drinnen die Flasche „Nuit“ und die Trinker – kaninchenäugig. Alles aufreizend häßlich. Doch genauso müsse es sein, um für das Nahen einer Gottheit empfänglich zu machen:
Und langsam, still durch die Betrunknen gehend,
Niemals von wem geführt, allein,
Parfüm verströmend und den Duft von Nebeln,
Setzt sie ans Fenster sich und schweigt.
Was die Gemüter bewegte, was sie mit tiefer Unruhe wie mit tiefer Befriedigung erfüllte, war diese unerhörte Intimität mit den Elementarkräften – wie wenn, sagt Boris Pasternak, „jemand den Mund auftut nicht aus Neigung zur Schönen Literatur, sondern, weil er etwas weiß und sagen will ... als ob man die Türen aufreiße und der Lärm des draußen laufenden Lebens dringe ein durch sie, als rede nicht ein Mensch davon, was in der Stadt geschieht, sondern die Stadt selbst gebe mit den Lippen eines Menschen zu wissen von sich“.
So auch hat der russische Umsturz von 1917/18 durch Blok in seiner Dichtung „Die Zwölf“ von sich „zu wissen“ gegeben – als „Russisches Fieber“ – als „Seufzer Zorn“ – Stimmen aus dem „Weltorchester der Volksseele“. Die Dichtung besteht ganz aus Redefetzen von Straßenpassanten und Rotgardisten-Stakkato, gehetzt, atemlos, blasphemisch und obszön, Sturmgesang und Maskenspiel, Sprache der Straße bis in die Namensform des am Schluß im Schneewind erscheinenden Jesus Christus: Isus Christos – volkstümlich (in der Tradition der russischen Altgläubigen) mit einem I, wo die geheiligte Form lisus ist – mit zwei I. Ununterscheidbar in diesem „Russischen Fieber“, ob da das Wüten, das Wutgeheul der Vergeltung vergeben wird, oder Vergebung verlacht, verhöhnt und zynisch abgewiesen. Ununterscheidbar, ob es sich um einen Exzeß handelt oder um den Vorschein einer neuen Existenz.
Es sind „Die Zwölf“, die Marina Zwetajewa zu ihrer Notiz über den Grad von Bloks Empfänglichkeit für die geistige Atmosphäre seiner Zeit anregte: „Bloks ‚Zwölf’ entstanden unter Zauber. Der Dämon dieser Stunde der Revolution (Bloks ‚Musik der Revolution’) war in ihn gefahren und hat ihm das diktiert.
Später rätselte eine naive Moralistin lange, ob sie Blok die Hand geben sollte oder nicht, während Blok geduldig abwartete. Blok schrieb ‚Die Zwölf’ in einer Nacht und war völlig erschöpft, als er wieder zu sich kam – wie einer, auf dem wie wild herumgeritten worden war.“
Marina Zwetajewa hat Blok das Höchste zugebilligt, die Gabe des Volkslieds. Daß dem Dichter ein Volkslied gelinge, „muß das Volk in den Dichter fahren. Volkslied heißt nicht Verzicht auf das ‚Ich’, sondern organischer Zusammenfluß, das Zusammenwachsen, der Zusammen-klang eines ‚Ich’ mit dem Volk (gegenwärtig, sage ich, nicht Jessenin, sondern Blok)“.
Blok hat sich von der Bezauberung durch „Die Zwölf“ nie wieder erholt. Das „Russische Fieber“, das an „Die Zwölf“ anschloß und möglicherweise seinen neuen Band „Schwarze Nacht“ eröffnen sollte, blieb Fragment. Blok war unzufrieden mit den „Zwölf“, weil er sie für zu fiebrig hielt – „neurotisch“, wie er sagte. Die „Musik der Revolution“ war verstummt, der heroische Augenblick der Revolution war vorüber. Bloks letzte Gedanken galten Alexander Puschkin und der „Bestimmung des Dichters“, der er nicht mehr gerecht werden zu können glaubte. Er sah sich der Freiheit und des Friedens beraubt – „nicht des äußeren, sondern des inneren, schöpferischen Friedens, nicht der kindlichen Freiheit, der Freiheit, liberal zu schwätzen, sondern der schöpferischen, der geheimen Freiheit. Und der Dichter stirbt, weil er nicht mehr atmen kann; das Leben hat seinen Sinn verloren“.
Sechs Monate darauf, am 7. August 1921, 11 Uhr morgens, starb Alexander Blok in Petrograd. Am 11. August wurde er auf dem Friedhof an der Smolenka begraben. Er war 41 Jahre alt geworden.
War der Anspruch zu hoch gewesen? Hatte er sich einer Überhebung schuldig gemacht? Ein neuer Mensch, eine neue Geschlechterauslese? Das Männliche vom Männchenhaften befreien, damit Zorn nicht zu Bosheit entarte? Das Weibliche vom Weibchenhaften befreien, damit Güte nicht in Gefühlsseligkeit schlage? Alles vergebens? Sein Untergang die Vergeltung für eine Anmaßung?
Auf der Suche nach einem Weg aus der Fiebrigkeit hatte Blok nach den „Zwölf“ den Plan zu einer epischen Dichtung wieder vorgenommen, die er „Vergeltung“ nannte. Er beabsichtigte nicht, sie fortzuführen, wollte sich aber noch einmal klarmachen, was ihm da vorgeschwebt hatte, nämlich eine Dichtung vom geistigen Zusammenhang einer Familie. Jedes ihrer Glieder entwickle sich bis zu der ihm gesetzten Grenze und werde dann von seiner Umgebung wieder aufgesogen. Jedes aber bringe etwas Neues, Auffallendes hervor, erkauft freilich durch Verluste, persönliche Tragödien, Zusammenbrüche. So sauge der Strudel der Welt den Menschen in seinen Trichter, von seiner Persönlichkeit bleibe nicht mehr als ein welker Leib und eine schwach glimmende Seele. Aber der Same sei ausgebracht und im nächsten Sproß wirke das Neue verwandelt fort, wirke auf seine Umgebung, übe Vergeltung für den Untergang seines Vorläufers, bis auch dieses Glied aufgesogen werde. Seine eigene Familie stand ihm hier vor Augen. Vielleicht ist ihm das schmerzlich-frohe Bild von Herkunft und Dasein eines Dichters im Epos entglitten und endlich nicht geglückt, weil er viel früher im Gedicht es gültig entworfen hatte – in dem Gedicht „Letztes Geleit“:
Du liegst, ins Dunkel eingeschlossen
Unter dem Lid – da trat sie ein!,
Die Stille, mit kristallnen Tönen;
Und Hoffnung leis ist aufgesprossen
In Lichtes zauberischem Schein.
Hörst dus im Dickicht deiner Qualen?
Als ob dein Freund, dein Jugendfreund
Dein Herz mit zarter Geige rühre!
Die Träume, siehst du sie erstrahlen
Am Ziel, befriedet und vereint?
Ruhm, Arglist, Gold, das blutbefleckte,
Dahin, dahin für alle Zeit!
Der Menschen ewig dumpfe Stumpfheit,
Ach, alles, was nur Schmerzen weckte,
Und manchmal, selten, Heiterkeit.
Und wieder Arglist, Ruhm und Ehre,
Neid, Lüge, Gold und Schmeichelein,
Der Menschen ewig stumpfe Dumpfheit,
Die Majestät, die große Leere …
Das soll die Welt gewesen sein?
Nein! – Sind nicht Lichtungen und Wälder?
Der Weg am Rain und die Chaussee,
Die Straße Rußlands in das Weite,
Und Nebel, Rußlands Nebelfelder,
Der Hafer, raschelnd, rot der Klee ...?
Doch wenn, was je dich wollte rühren,
Vergeht, und schwinden Bild um Bild,
Wird, die du liebtest, als Geleite,
Dich die geliebte Hand entführen
In das Eleusische Gefild.
Deutsch von Elke Erb