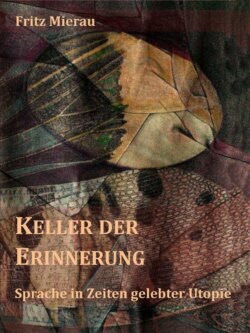Читать книгу Keller der Erinnerung - Fritz Mierau - Страница 8
Unser Jung-Journal
ОглавлениеJung als ein Vordenker für die Auflösung
des Totalitären, was alle erfaßt.
Journal, 25. März 1989
In der Zeit des Zusammenbruchs der DDR geisterte Franz Jung durch unser Tagewerk wie nie zuvor. Vielleicht sollten wir in ihm unseren heimlichen Begleiter durch die Gefahren und Verführungen erkennen, die bei der schleichenden Auflösung eines Staatswesens drohen. Auf jeden Fall hat er uns mit seinen Erfahrungen aus mehreren ähnlichen Zusammenbrüchen im 20. Jahrhundert nach Kräften beigestanden.
Eingesetzt hatte das suggestive Geleit mit unserer Jung-Lesung anläßlich seines 100. Geburtstags. Veranstalter war die Majakowski-Galerie am Kurfürstendamm. Der Ausflug vom Prenzlauer Berg (Berlin, DDR) nach Charlottenburg (Besondere politische Einheit Westberlin) war nur möglich, weil wir in unserem Reisepaß über ein, wie das damals hieß, „Dienstvisum gültig für mehrmalige Ausreise“ verfügten, das wir auf Betreiben des Reclam-Verlags Leipzig für unsere Londoner Jung-Recherchen ausgestellt bekommen hatten. Mit kritischem Blick auf die Korrekturversuche der Perestroika, einer Revolution von oben, nannten wir unsere Lesung „Ist der Mensch fertig? Die russische Perspektive 1920. 1960. 1988“. Die Texte entnahmen wir dem Band „Briefe und Prospekte 1913-1963“, den wir eben für die Jung-Ausgabe in der Hamburger Edition Nautilus betreut hatten.
Den Ausgang dieses einjährigen Jung-Geleits bildete ein Vorfall, der nicht weniger symptomatisch war wie sein Einsatz: Franz Jung sorgte dafür, daß wir den Augenblick des Mauersturms im November 1989 verpaßten. Bis in die Abendstunden des 9. November, über die geschichtliche Zäsur 1853 Uhr hinaus, als Günter Schabowski auf die Frage eines italienischen Journalisten hin die Reisefreiheit für DDR-Bürger – „ab sofort“ – verkündete, hielt Jung uns in der Schaubühne am Lehniner Platz fest. Ahnungslos verfolgten wir die Proben zu seinem Stück „Heimweh“ von 1926.
Noch in Charlottenburg, wo wir auf dem Rückweg in den Prenzlauer Berg die S-Bahn nahmen, deutete nichts auf den Eklat. Kaum aber erreichte unser Zug Zoo, da stürmte eine Menge aufgeregter Leute ins Abteil, die in eigentümlich gleicher Hochstimmung wie trunken einander kurze Sätze zuriefen oder vor sich hin lächelten und alle miteinander bekannt zu sein schienen. Diskreter und zugleich vertrauter als eine Fan-Gemeinde, so als kenne man sich zwar erst kurz, sei sich aber in einem entscheidenden Punkt einig. Eine Gesellschaft, die etwas verband, wovon wir nichts wußten. Wir hörten nur von Hämmern reden. Von was für Hämmern wohl?
Der Tonus stieg von Minute zu Minute, bis sich am Bahnhof Friedrichstraße der ganze Zug auf einen überfüllten Bahnsteig entlud. In die unterirdischen Kontrollgänge gepreßt, gerieten wir in ein heilloses Gewühl. Man hielt sich mit Mühe auf den Beinen. Kein Gedanke mehr an Paßkontrolle. Es mußten die Auswirkungen eines ungeheuren Bebens sein. Zurück am Prenzlauer Berg, hörten wir dann über alle Sender und Kanäle die Botschaft, die das Schicksal der totalitären Regimes in Rußland und Osteuropa besiegelte.
Der Rausch des Augenblicks – wegen Jung verpaßt. Als bedürfte es angesichts einer weiteren Sicht nicht dieses kurzen Rauschs. Als verschleiere der Rausch des Augenblicks nur den größeren Triumph, den Menschen wieder einmal aus seinen totalitären Perfektionsträumen geweckt und auf sich selbst zurückverwiesen zu sehen. „Heimweh“ in der Schaubühne statt Freudentaumel am Brandenburger Tor. Kein Zufallscoup, sondern ein von langer Hand vorbereiteter Tausch?
Obwohl wir von Franz Jung seit über 30 Jahren wußten und 20 Jahre bei Jungs zweiter Frau, Cläre Jung, verkehrt hatten, muß die geistige Präsenz des Mannes 1988/1989 noch einmal so stark gewesen sein, daß wir beschlossen, ein Journal über Jungs einzelne „Auftritte“ zu führen. Erste Eintragung am 8. November 1988, letzte Eintragung am 18. Oktober 1989. Reichlich 100 Seiten eines DIN A4-Diariums.
Heute liest sich der Auftakt unseres Journals 1988/1989 wie der Entwurf unseres Jung-Bildes, das sich von den sonst gezeichneten Jung-Bildern immer noch ziemlich unterscheidet:
Einheitsauffassung: Nicht das Aufeinanderhocken, sondern Ausweichen, Abtrennen; positiv: Bewegungsfreiheit, Ausfüllen des Raumes; Verbundenheit im Denken;
Gewinnen der eigenen Ordnung, Wertehierarchie und Topographie = Zeitlosigkeit gegen Beschleunigung und Abschnürung …
Kreativität ist das unablässige Ausweichen.
Die folgenden Aufzeichnungen im „Journal“ befragten und gliederten den Entwurf, prüften ihn an Begegnungen mit Leuten aus Jungs wechselnden Lebenskreisen in Berlin, Stuttgart, Hamburg, London und Paris, erwogen neue Jung-Editionen, bis sie sich am Ostersonnabend 1989 in einigen Sätzen konzentrierten, die sich als ihre geistige Mitte erweisen würden:
Jung als ein Vordenker für die Auflösung des Totalitären, was alle erfaßt.
Polyzentrismus: Formen sehr verschieden/gleichberechtigt, dies von Jung durchprobiert.
„Lebensformen“ statt Experimente.
Ob uns die Doppelbedeutung des Relativanschlusses damals bewußt war, ob wir mit der Notiz wirklich meinten, das Totalitäre erfasse alle, seine Auflösung aber auch, ist nicht mehr festzustellen. Erfahren haben wir es jedenfalls so. Tatsächlich haben wir es Franz Jung zu verdanken, daß die gefährlichste Wahnidee totalitären Denkens im Nachkriegsdeutschland nicht von uns Besitz ergriff – die Idee von den zwei Deutschlands, dessen eines, das bessere kleine, Vorbild und Experimentierfeld für das künftige ganze Deutschland sei. So wenig Jung selber sich aus Deutschland machte, so sehr er Italien, die USA, Frankreich oder gar die Oaxaca-Wüste als Arbeitsstätte vorzog, er war seiner geistigen Herkunft und lebenslangen literarischen Anstrengung nach ein deutscher Dichter. Er war weder „Ost“ noch „West“. Den Bau der Berliner Mauer hat er nirgends erwähnt, als lohne es sich nicht, ein so ephemeres Ereignis überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Will man es paradox, so sei daran erinnert, daß er vom Bundespräsidenten Theodor Heuß eine 1000-DM-Ehrengabe entgegennahm und kurz darauf mit dem Gedanken spielte, „nach Hause“, nämlich in die eingemauerte DDR zu gehen. Oder unter größerem Aspekt: Von einer kleinen USA-Rente lebend schrieb er seine dezidiert prorussische Autobiographie, die er ursprünglich „Deutsche Chronik“ nannte.
Wer sich auf diesen Mann verwiesen fand, war gegen die beiden Arten deutscher Borniertheit gefeit, die einander in nichts an Unfruchtbarkeit nachstehen – gegen die Selbstüberhebung wie gegen die Selbstunterschätzung. Im Ernst auf zwei Deutschlands bestehen zu wollen, war doppelt borniert, Hybris und Minderwertigkeitskomplex in einem Wechselspiel, das alles Selbstbewußtsein und alle Kreativität tötete.
Praktisch funktionierte Jungs Geleit denkbar einfach. Man mußte nur entschlossen jede Gelegenheit wahrnehmen, die mit Jung befaßten Leute zu treffen. Cläre Jung und ihr Archiv boten da die schönsten Möglichkeiten. Bei ihr lernten wir nicht nur alte Freunde Jungs kennen, sondern mehrere Generationen von Jung-Lesern und Jung-Forschern, die sich Lektüre oder Rat holten. Entscheidend war Ende der siebziger Jahre die Begegnung mit Walter Fähnders, Helga Karrenbrock und Martin Rector, die sich seit Anfang der Siebziger um die Wiederherausgabe Franz Jungs bemühten. 1974 veröffentlichten Fähnders und Rector ihre Arbeit über „Linksradikalismus und Literatur“. Walter Fähnders hat in seinem Engagement für Jung über dreißig Jahre nicht nachgelassen. Mit Rembert Baumann hatte Walter Fähnders wesentlichen Anteil an der von Lutz Schulenburg als Editor betreuten 14bändigen Jung-Ausgabe der Hamburger Edition Nautilus, die jetzt abgeschlossen wurde. Und erst kürzlich hat er mit der Herausgabe der verschollen geglaubten Budapest-Novelle „Die Verzauberten“ und der Dokumentation „Vom ‚Trottelbuch’ zum ‚Torpedokäfer’“, einer Gemeinschaftsarbeit mit Andreas Hansen, die Jung-Lektüre und Jung-Debatte neu angeregt.
Durch Walter Fähnders lernten wir auch Wolfgang Storch kennen, 1977 war es wohl, der fortan Franz Jung in alle seine Arbeitsbücher hineinkomponierte; 1979 etwa nahm er den Text „Die Tochter“, eine Montage zum Schicksal von Franz Jungs Tochter Dagny aus seiner ersten Ehe mit Margot Jung, in den Geländewagen I Berlin auf, ein Lesebuch zu Heiner Müllers fünfzigstem Geburtstag.
Walter Fähnders und Wolfgang Storch haben viele Male zu Gesprächen und Vorträgen eingeladen, die Reisegenehmigung der DDR-Behörden blieb bis 1986 immer aus. Glücklicherweise gehörte die DDR aber dem Weltpostverein an, so daß, wenn bekanntlich auch sicherheitspolitisch überwacht, der Austausch nicht abbrach. Endlich ergab sich doch eine schöne Zusammenarbeit mit Wolfgang Asholt und Walter Fähnders, als die beiden sich für ihren Band „Arbeit und Müßigang 1789 bis 1914“ einen Text über Iwan Gontscharows „Oblomow“ vorstellen konnten. Unter dem 27. Juli 1989 im „Journal“ die Notiz: „Oblomow: Müßiggang in Rußland. Verlangen und Befugnis.“
Im Laufe dieses Austauschs, vor allem bei der gemeinsamen Arbeit an der Franz-Jung-Ausgabe der Edition Nautilus, stießen wir auf eine Fülle von Jung-Bildern, die unserem Jung-Bild nicht ähnelten.
Wir folgten nicht dem Projektemacher, Parteigründer, Abenteurer, Schiffsentführer, dem Trinker und Seelenexperimentator, nicht dem Mann hinter den Kulissen, nicht dem Mann, der irgendwelche Lernprozesse nicht durchgehalten hatte, kaum auch dem geheimnisvollen, immer abwesenden, schwierigen, am Ende aber doch besorgten Vater, wie ihn gerade sein Sohn Peter aus der Ehe mit Harriet Jung in dem mit Annett Gröschner zusammen verfaßten Buch „Ein Koffer aus Eselshaut“ darstellt. Und wir folgten schon gar nicht dem großen Versager, als den er sich seit je her gern selber gesehen hatte.
Wir fanden in Jung den schlesischen Romantiker aus dem katholischen Neisse, der Joseph von Eichendorff liebte; wir fanden in ihm den „initiateur“ Fouriers, den ewigen Beginner, der überall bei der Hand ist, wo es einen gefährlichen oder unangenehmen Schritt zu tun gibt, der sich aber zurückzieht, sobald ihm Führerschaft aufgenötigt wird; wir fanden in ihm den „Lastträger“ Nietzsches, der nach langem Warten auf ein entlastendes Entgegenkommen schließlich jedermann erträgt und damit noch mehr trägt als er bisher schon getragen hat; und wir fanden in ihm Rimbauds Unerschrockenheit: „Nehmen wir alles auf, was an Lebenskraft und echter Zärtlichkeit naht.“
Da war bei aller aggressiven Strenge gegen sich selbst ein eher stiller, ein sanfter Jung, der Jung der Exerzitien des Spandauer Gefängnistagebuchs, der Jung des „Erbes“, seiner Auseinandersetzung mit dem Vater, der Jung der „Revolte gegen die Lebensangst“ und seiner „Deutschen Chronik“, die als „Der Weg nach unten“ erschien.
Dieser Jung begleitete uns bis in unsere Träume:
Traum von Franz Jung. Ich war bei ihm zu Gast. Warum weiß ich nicht. Überlegte gerade, daß ich ihm nicht zu lange zur Last fallen dürfte und sagte ihm, ich wolle – wahrscheinlich morgen – abreisen. Vielleicht auch nicht abreisen, sondern einfach nur bis morgen bleiben. Er hörte ruhig zu. Er war im ganzen heiter und gelöst. Sagte dann, Margot komme. Er freute sich darüber. Fügte hinzu, er möchte sich von Margot verführen lassen, lächelte. Ich merkte, er war schon woanders. Fürchtete wohl, aus einem Gespräch mit ihm könnte nichts werden. Daher sagte ich, ich hätte gern mit ihm gesprochen. Mir seien seine Gedanken vertraut aus dem, was er geschrieben hätte, aber ich möchte hören, wie es in seinem Munde klinge. Wo die Akzente liegen, wenn er spricht. Er stimmte zu, das schien ihm ein verständlicher Wunsch zu sein. Ich wollte ihn über die Religion befragen, das sagte ich aber nicht.
Manchem unserer Freunde schien der vertraute Umgang mit Jung zu weit zu gehen. Als wir die Impressionen von unserer ersten Englandreise 1988 – „Hausbauen in London“ – verschickten, in denen wir neben Jungs Häusern die „lindernden Häuser der Lehrer“ nannten: Swedenborg-Hall, Rudolf Steiner Bookshop, Linnean Society, die Tate-Gallery mit William Turner und das Teilhard-Centre, da verhehlte einer unserer Freunde nicht, daß er „davor warnen möchte, dem Franz auf allen Wegen in seinen mystischen Spiritualismus zu folgen …“. Er jedenfalls wolle, schrieb er am 25. Januar 1989 – „zumal in diesem Jubiläumsjahr – doch die ungelösten Ansprüche der Aufklärung nicht vergessen“.
Solchen von früh an gehegten Bedenken, die Jung unterstellten, er verweigere sich im entscheidenden Moment und ziehe sich ins Irrationale zurück, begegneten wir in unserem Entwurf mit einem Begriff, der Jungs Vorarbeit bei der „Auflösung des Totalitären“ genau faßte, mit dem Begriff des „Übersetzens“. Am 15. Dezember 1988 taucht er zum ersten Mal auf:
Das Arsenal der [von Jung] erarbeiteten Umgangsformen = Übersetzungsangebote befreien von dem Verdacht, Flucht, Rückzug, Ausweichen zu sein, und zwar aus Gründen der Bequemlichkeit oder Verantwortungslosigkeit.
Ins Positive gewendet ergibt sich dagegen: Umwege, um Distanz zu schaffen.
Jede Umgangsform hat ihre Akme …: als Korrespondenz, einmalige Begegnung, Blicke, Widmung. Daher Abbruch auf Höhepunkt keine Brüskierung.
Übersetzung in diesem Sinne meinte das gleichberechtigte Nebeneinander vieler Sprachen, meinte Autonomie der Sprachen bei prinzipieller Durchlässigkeit, meinte die Sprache wechseln als Gewähr für Kreativität, meinte den „Polyzentrismus“ aus der Notiz vom Ostersonnabend 1989.
Es stellte sich bald heraus, daß dieses Jung-Bild nur in einem Buch zu zeichnen sein würde. Ursprünglich war an eine Parallel-Biographie Walter Serner – Franz Jung gedacht. Als daher Elisabeth Wolken von der Deutschen Akademie Villa Massimo uns Anfang Mai zum Jahreswechsel 1989/1990 für drei Monate nach Rom einlud, dauerte es nicht lange, bis wir uns festlegten. Am 2. Juli 1989 trugen wir ins „Journal“ ein: „Am 1. Juli 1989 Entschluß, das Jung/Serner-Buch in Rom zu schreiben.“ Das geschah dann auch, geriet allerdings etwas anders als geplant. Immerhin: Das 1998 erschienene Buch „Das Verschwinden von Franz Jung“ ist zehn Jahre zuvor in unserem „Jung-Journal“ entworfen und in Rom begonnen worden.
Eine der letzten Eintragungen in unserem „Journal“ galt dem Bühnenbild zu „Heimweh“. Es schien uns zu massig, zu bunt, zu naturalistisch für dieses tänzerischste Stück Jungs. Reden hatte nichts genutzt. Oder doch? Im August war der Bescheid vom Ministerium für Kultur der DDR gekommen, wir sollten, wörtlich – „in Gottes Namen nach Rom fahren“. Wir starteten am 30. November. Klaus Metzger, der Dramaturg der Schaubühne, brachte uns für die Gespräche über Jung und „Heimweh“ ein Honorar an die Bahn. Es erlaubte uns, im Februar 1990 weiter in den Süden nach Foggia und San Giovanni Rotondo zu fahren, wo Jungs letzte Gefährtin, Anna von Meissner, wohnte. Jung hat von ihr in seinen Novellen „Die Verzauberten“ und „Sylvia“ erzählt. Wir fanden sie leicht. Sie wohnte noch in der Gegend, wo Jung sie vor dreißig Jahren zurückgelassen hatte, als er nach New York ging. Sie erschien uns wie eine Figur aus „Heimweh“.