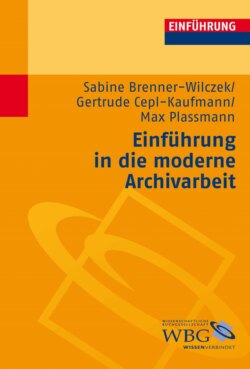Читать книгу Einführung in die moderne Archivarbeit - Gertrude Cepl-Kaufmann - Страница 11
4. Die deutsche Archivlandschaft – monstro simile?
ОглавлениеÖffentliche vs. nicht-öffentliche Archive
Zusammenfassend fällt es schwer, die Grundzüge der deutschen Archivlandschaft in nur wenigen Sätzen treffend zu umreißen. Dazu ist sie zu bunt und vielgestaltig. Entscheidend bleibt die Unterscheidung zwischen einem systematisch anhand der Verfassungs- und Verwaltungsstrukturen aufgebauten öffentlichen Archivwesen, neben das ein unsystematisches, nur dort vorhersehbares nicht-öffentliches tritt, wo es sich wie bei Kirchen und Parteien dem öffentlichen in den äußeren Formen annähert. Vielfalt ist ein großer Vorteil, weil sie die Bildung einer stromlinienförmigen, nur auf einen Auswertungszweck konzentrierten Gesamtüberlieferung verhindert und so das Überdauern auch solcher Quellengruppen sichert, denen der Mainstream keine Beachtung schenkt. Der Benutzer hat allerdings den bisweilen schweren Nachteil, dass Recherchen schwierig und zahlreiche Hilfsmittel zu benutzen sind, sobald der sichere Boden des öffentlichen Archivwesens verlassen wird.
Abgrenzung von Zuständigkeiten
Insbesondere die Aufbewahrungsorte von Nachlässen sind oft nicht leicht zu ermitteln, weil es kein genuin zuständiges Archiv gibt oder das, das der Sache nach am ehesten zuständig wäre, vom Nachlasser aus welchen Gründen auch immer nicht berücksichtigt wurde. Das Beispiel des Nachlasses des Schriftstellers Heinrich Böll zeigt jedoch anschaulich die Problematik, überhaupt ein solches der Sache nach zuständiges Archiv zu ermitteln: Er war ein Literat von nationaler Bedeutung – zuständig sein könnten daher das Deutsche Literaturarchiv in Marbach oder auch das Bundesarchiv als Nationalarchiv. Er stammte aus Köln, war also Nordrhein-Westfale – zuständig sein könnte also das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf als zentrales nordrhein-westfälisches Archiv, oder das Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf, das sich als rheinisches Literaturarchiv versteht. Diese Aufzählung potenziell zuständiger Archive ließe sich unter verschiedenen Aspekten fortführen. Alle diese Archive und Einrichtungen hätten gute Gründe für sich, den Nachlass zu verwahren. Unter einem übergeordneten Gesichtspunkt hätte keines den Vorzug zu erhalten. Den Ausschlag gab aber schließlich, das Böll Kölner war. Das Historische Archiv der Stadt Köln konnte den Nachlass eines bedeutenden Sohnes der Stadt erwerben. Allerdings – und das verkompliziert die Lage weiter – gegen Zahlung einer beträchtlichen Summe Geldes. Auch das muss bei Nachlässen berücksichtigt werden: dass sie verkauft werden und dort landen, wo das notwendige Geld aufgebracht wird. Weiterhin gibt die Existenz eines „Heinrich-Böll-Archivs“ bei der Stadtbibliothek Köln Anlass zur Verwirrung, da es sich um kein Archiv, sondern um eine Bibliothek und Dokumentationsstelle handelt. Zusätzlich existiert ein offenbar privates „Archiv der Erbengemeinschaft Heinrich Böll“.
Probleme der Recherche
Die Suche nach Nachlässen und verwandten Sammlungen erfordert also mehr Beharrlichkeit als die nach anderen Archivgutarten. Oft kommt man mit einer begründeten Vermutung weiter, weil sie natürlich doch in das Archiv gelangen, das wegen seiner territorialen oder sachlichen Zuständigkeit am ehesten dafür in Frage kommt. Ansonsten sind verschiedene Hilfsmittel zu Rate zu ziehen, wie sie in dem Kapitel über die praktische Archivarbeit beschrieben werden.
Abhängigkeit von den Verfassungsstrukturen
Dem Benutzer, der mit viel Mühe die von ihm benötigten Quellen in zahlreichen Archiven der verschiedenen Archivträger aufspüren muss, mag die Struktur des deutschen Archivwesen als irregulär, unsystematisch oder ineffizient erscheinen, als viel undurchschaubarer jedenfalls als die von Ländern mit zentralisiertem Archivwesen. Das Archivwesen ist jedoch stets abhängig von der Verfassung des Staates und der Gesellschaft, in deren Rahmen es arbeitet. So ist es legitim, das deutsche Archivwesen mit den Worten Samuel Pufendorfs als monstro simile zu bezeichnen, der so im 17. Jahrhundert die Verfassung des Alten Reiches beschrieb. Er wollte damit aber nicht die Reichsverfassung in Verruf, sondern zum Ausdruck bringen, dass sie sich nicht in gängige staatsrechtliche Klassifikationsschemata pressen ließ, sondern in ihrer Einzigartigkeit gesondert zu würdigen sei. Das deutsche Archivwesen insgesamt ist wie die Reichsverfassung als Produkt einer historischen Entwicklung von Jahrhunderten, die noch längst nicht beendet ist und die nicht zielgerichtet verläuft, zu würdigen und zu erklären. Da Archive und Archivare Teil der Geschichte sind, die ihre Benutzer untersuchen wollen, kann es auch gar nicht anders sein.