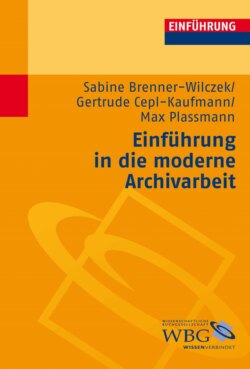Читать книгу Einführung in die moderne Archivarbeit - Gertrude Cepl-Kaufmann - Страница 8
ОглавлениеI. Die Entstehung der deutschen Archivlandschaft
1. Was ist ein Archiv?
Archivstruktur und Föderalismus
Die Prozesse, die seit dem Mittelalter zur Entstehung des deutschen Archivwesens im heutigen Sinne geführt haben, sind alles andere als zielgerichtet verlaufende Entwicklungen. Sie sind vielmehr Teil der wechselvollen deutschen Geschichte und können daher nicht angemessen ohne Berücksichtigung dieses Zusammenhangs beschrieben werden.
Schon die diversen Bezeichnungen für Archive wie zum Beispiel von Staats-, Landes-, Stadt-, Kreis-, Kirchen- oder Wirtschaftsarchiven verweisen auf ein Grundthema, das die deutsche Archivgeschichte mit der allgemeinen deutschen Geschichte teilt: Der Föderalismus führte zu Vorgehensweisen in den einzelnen Staaten, die sich zwar überall der Natur der Sache nach ähnelten, die aber nicht immer gleich waren und sind. Man mag daher einen Mangel an Koordination beklagen, der bisweilen die Benutzung historischer Quellen erschwert. Auf der anderen Seite hat die Vielfalt jedoch auch immer befruchtend gewirkt und manche Idee gefördert, die es in einem strikt zentralistischen System schwer gehabt hätte.
Bedeutung der Verwaltungstraditionen
Die Wurzeln und die weitere Entwicklung des Archivwesens sind eng verknüpft mit der der jeweiligen öffentlichen Verwaltung und ihrer speziellen Traditionen, etwa bei der Art und Weise der Aktenbildung: So, wie die Unterlagen in den Verwaltungen angelegt worden waren, so gelangten sie in der Regel auch in die Archive. Entsprechend mussten hier für Erschließung und Aufbewahrung Arbeitsweisen gefunden werden, die zum jeweiligen Archivgut passten. So erfordert eine chronologisch geordnete Serie von Sitzungsprotokollen einer kollegial verfassten Behörde ein anderes Herangehen als eine nach sachlichen Rubriken geordnete Registratur.
Berufsbild des Archivars
Unterschiedliche Arbeitsweisen ergaben sich jedoch auch daraus, dass sich das Berufsbild des Archivars und das Selbstverständnis der Institution im 19. Jahrhundert erst entwickeln mussten. Es macht schon einen Unterschied aus, ob sich der Archivar als Hüter der verlängerten Altregistratur der Verwaltung im engeren Sinne versteht, also in Denken und Handeln verwaltungsnah ist, oder ob er sich als Historiker oder Wissenschaftler versteht, der sich den Unterlagen eher unter dem Aspekt der Auswertung nähert. Im 19. Jahrhundert war nach einer gewissen Anlaufzeit v. a. dieser zweite Typ des Archivars verbreitet, was zu einer deutlichen Bevorzugung der mittelalterlichen Bestände führte, denen man als Historiker eine höhere Wertigkeit einzuräumen geneigt war. So prägte bis in das späte 20. Jahrhundert hinein ein deutliches Übergewicht an Mediävisten das staatliche Archivwesen.
Es gehört zum Wesen der Wissenschaft und damit auch zum wissenschaftlichen Archivwesen, dass keine allgemeingültigen, ewigen Gesetze herrschen, sondern dass ein stetiger Wider- und Wettstreit der Meinungen vorherrscht, dass jeder letztlich so arbeitet, wie er es als Wissenschaftler vor sich selbst und der Fachwelt verantworten kann. So war von Beginn des modernen Archivwesens an eine Vielfalt der Methoden und der Terminologie angelegt, die sich nicht wesentlich von der vergleichbaren Vielfalt in anderen wissenschaftlichen Arbeitsgebieten unterschied und unterscheidet. Diese Vielfalt ergab sich nicht nur zwischen den Archiven, sondern manchmal auch innerhalb eines Hauses etwa in seinen Abteilungen oder nach personellen Wechseln.
Potenzielle Archivbenutzer sind mit dieser historisch gewachsenen Vielfalt konfrontiert und müssen sich mit ihr auseinander setzen, um sinnvoll arbeiten zu können.
Definition des Archivbegriffs
Was ein Archiv genau ist und was dem zufolge ein Archivbenutzer dort erwarten kann, ist nicht ganz leicht zu definieren. Denn der Begriff „Archiv“ wird im Sprachgebrauch so vielfältig verwandt, dass keine einheitliche, griffige Formel gefunden werden kann, ihn zu beschreiben. Das gilt sogar dann, wenn man alle Zeitschriften, die sich etwa „Archiv für Kulturgeschichte“ oder „Archiv für Begriffsgeschichte“ nennen, und alle Computerprogramme, die eine „Archivfunktion“ anbieten, außer Betracht lässt. Denn ein Staatsarchiv ist doch etwas ganz anderes als ein „freies Archiv“ einer lokalen Geschichtswerkstatt oder eine „Archiv“ genannte Sammlung eines Forschungsinstituts. Und umgekehrt gibt es Archive, die dieses Wort nicht im Namen führen – zu erinnern ist da nur an zahlreiche Handschriftenabteilungen großer Bibliotheken. Der Archivbenutzer steht so vor dem gleichen Problem wie die Verfasser einer kurzgefassten Einführung in die Archivbenutzung: Die Facetten des deutschen Archivwesens sind so schillernd, dass es nicht möglich ist, alle Feinheiten zu berücksichtigen. Auch kann man nicht den Überblick über dieses sich aller Homogenität entziehende Feld behalten, wenn man nicht weiss, wie, warum, wann und mit welchen Zielen das unsystematische Netz von tausenden von Archiven in Deutschland entstanden ist. Allein eine Stadt wie Düsseldorf zählte im Rahmen einer spartenübergreifenden archivischen Zusammenarbeit im Jahr 2003 19 Archive, die am „Tag der Archive“ teilnahmen, wozu noch ein gutes Dutzend hinzugekommen wäre, wenn sich denn alle Archive und archivähnlichen Institutionen der Stadt beteiligt hätten.
So soll hier einleitend nur eine ganz vage Definition von „Archiven“ angeboten werden, die im Folgenden durch eine Beschreibung der Entstehung und Ausformung der deutschen Archivlandschaft präzisiert wird:
Archive sichern, verwahren, ordnen, erschließen Unterlagen (v. a. Schrift, aber auch Bild- und Tonträger sowie neuerdings digitale Daten) und stellen sie für eine Benutzung bereit.
Benutzerperspektiven
Das Benutzungsinteresse ist so vielschichtig wie die Art der verwahrten Unterlagen. Gemeinhin wird es mit historischer Forschung im weitesten Sinne (unter Einschluss der stets boomenden Genealogie) gleichgesetzt, doch auch andere Nutzungsformen spielen im Arbeitsalltag eine große Rolle, etwa die Erbenermittlung oder andere praxisbezogene bzw. rechtssichernde Anliegen, aber auch die nichtwissenschaftliche journalistische Recherche. Der Unterschied zu Bibliotheken und Museen, die auf verwandten Feldern tätig sind, liegt neben den zum Teil stark unterschiedlichen Methoden v.a. in der Art der verwahrten Medien: Während Bibliotheken hauptsächlich Druckschriften verwahren, die in mehr oder minder großen Auflagen entstanden sind, verwahren Archive in der Regel Unikate oder in kleinsten Auflagen entstandene Vervielfältigungen. Das teilen sie mit vielen Museen, die jedoch oft dingliche Gegenstände und/oder Kunstobjekte aufbewahren, während es sich bei klassischem Archivgut um „Flachware“ handelt, d. h. um Schriftstücke, die von einer Verwaltung, einer Institution oder einer Privatperson verfasst worden sind. Auch die Ziele unterscheiden sich stark: Während Museen präsentieren, stellen Archive für die Benutzung bereit.
Strukturgenese der Archivlandschaft
Wenn im Folgenden also ein historischer Rückblick auf die Entstehung und Entwicklung des deutschen Archivwesens genommen wird, so handelt es sich um keine institutionengeschichtliche Nabelschau, sondern um eine Möglichkeit der Systematisierung: Aus ihrer Genese heraus lassen sich die Arbeitsweisen und Funktionen der verschiedenen Archivtypen oft besser erklären und verstehen als aus ihren heutigen Aufgaben.
Es geht dabei jedoch ausdrücklich nicht darum, Archivgeschichte im engeren Sinne zu betreiben. Das heißt, es werden keine Daten aneinander gereiht, und es wird auch kein einzelnes Archiv mit seiner speziellen Entwicklung präsentiert. Stattdessen wird idealtypisch die Entwicklungsgeschichte des deutschen Archivwesens beschrieben. Dass die Verhältnisse im Einzelfall ganz anders lagen, der Entwicklung vorauseilten oder hinterherhinkten, das wird nicht mehr im Einzelnen erwähnt, sollte aber immer berücksichtigt werden. Einen wichtigen Grundgedanken sollte man dabei nicht aus den Augen verlieren: Die Struktur des Archivwesens korrespondiert immer mit der der Verfassung der Gesellschaften, Staaten oder Körperschaften, die Archive einrichten und unterhalten. Eine dezentralisierte Verfassungsstruktur verträgt sich nicht mit einem zentralisierten Archivwesen und umgekehrt.