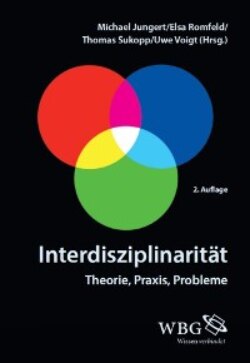Читать книгу Interdisziplinarität - Группа авторов - Страница 22
3. Disziplinarität, Interdisziplinarität, Transdisziplinarität: Terminologische Abgrenzungen und Zusammenhänge 3.1. Fächer, Disziplinen und Disziplinarität
ОглавлениеNach einem verbreiteten und naiven Bild, das wir uns vom Wissenszuwachs machen, gleicht das Wissen der Luft in einem aufgeblasenen Luftballon. Diese Metapher ist sicher nicht sehr belastbar, sie kann aber z.B. zeigen, dass die Grenzflächen des Nichtwissens mit anwachsendem Wissen größer werden. An solchen Grenzen, sozusagen im Anflug an die Innenseite des Ballons, entstehen neue Fächer (Joos 1987, S. 146ff.). Beispiele dafür sind Psycholinguistik, Neuroethik, Neurolinguistik, Neuroökonomie, Historische Soziologie oder Verwaltungswissenschaften.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Fächern und Disziplinen (Heckhausen 1987, S. 130f.) besteht nun darin, dass es innerhalb einer Disziplin, etwa der Physik, viele, methodisch und experimentell ähnlich vorgehende Fächer gibt. Heckhausen schätzt die Anzahl der Disziplinen – oder „Disziplinaritäten“, wie er es nennt – auf 20 bis 30. Es seien hier nur wenige Fächer genannt, die jeweils einer Disziplin zugeordnet werden können. Bereits im Ausbildungsgang und wegen des rasant anwachsenden technisch-wissenschaftlichen Wissens erscheint eine innerdisziplinäre Ausdifferenzierung in verschiedene Fächer unumgänglich.
Innerhalb der Medizin gibt es z.B. – als Subdisziplin – die Klinische Medizin. Ausschließlich für die Diagnose und Therapie der Erkrankungen einzelner Organe zuständig sind Nephrologen, Pulmologen, Kardiologen etc. Ähnliche Aufzählungen lassen sich in anderen etablierten Wissenschaften machen, seien es Natur- oder Geisteswissenschaften, wenn wir diese alte Unterscheidung gebrauchen wollen. Man denke z.B. an Physik, Chemie oder Soziologie.
Es liegt nahe, dass gute Disziplinarität eine Voraussetzung für gute Interdisziplinarität ist (Krüger 1987, S. 108f.). Mit guter Disziplinarität ist zunächst gemeint, dass etwa die oben genannten medizinischen Fächer in diagnostischen und Therapiefragen zusammenarbeiten, wie es – bei bestimmten Krankheitsbildern – üblich ist oder mindestens üblich sein sollte. Krüger gibt eine – in meiner Sicht plausible – Erklärung dafür, warum wir uns mit Disziplinen und mit Interdisziplinarität so schwer tun, d.h. warum es uns bereits schwer fällt, Disziplinen voneinander abzugrenzen (siehe 3.1.). Wenn das so ist, dann dürfte es noch schwerer sein zu sagen, was (gute) Interdisziplinarität ausmacht. Welche Elemente zeichnen Disziplinarität also aus? Alle vier Charakteristika (Krüger 1987, S. 108f.) sind hoch problematisch, wie anhand der kurzen Kommentare deutlich wird.
1. Gegenstand9: Das ist offenbar falsch, denn mit Phänomenen des Lebens bzw. mit lebendigen Systemen beschäftigen sich beispielsweise mehrere Disziplinen, etwa Biologie, Medizin oder auch Soziologie; hier wäre eine Präzisierung hinsichtlich der Komplexität der betrachteten Forschungsobjekte oder der theoretischen Integrationsniveaus (Immelmann, siehe unten) notwendig.
2. Methoden: Eine Reihe von Disziplinen verwenden gleiche oder ähnliche Methoden; Messungen der Strahlung radioaktiver Isotope bzw. entsprechende Bestrahlung sind für Mediziner, Archäologen oder Chemiker von Bedeutung. Eine Identifizierung von Kernmethoden bzw. eine Feindifferenzierung der Methoden wäre hier hilfreich.
3. Spezifisches Erkenntnisinteresse: Das ist sicher ein heuristisch, erkenntnistheoretisch und wissenschaftstheoretisch interessanter Aspekt, denn die technische Verwertbarkeit naturwissenschaftlichen Wissens im Gegensatz zur geisteswissenschaftlichen Grundlagenforschung ist sicher (immer noch) ein weit verbreitetes Vorurteil und wissenssoziologisch von großer Bedeutung. Allerdings merkt z.B. Krüger (1987, S. 113) an, dass wir Erkenntnisinteressen und Disziplinen „fast beliebig“ (ebd.) kombinieren können und dass hinter vermeintlich feststehenden Erkenntnisinteressen „wandelbare historische Präferenzen“ (Krüger 1987, S. 114) zu finden sind.
4. Theorien und deren systematische und historische Zusammenhänge: Von den Fragen/Problemen einer Disziplin in Kombination mit den Gegenständen einer Theorie und dem Entwicklungsstand einer Disziplin hängt wesentlich die Tiefe und Breite entsprechender Theorien ab. Vereinfacht gesagt könnten Theorieentwürfe10 oder Paradigmen im Sinne von Leitbildern oder Theoriekernen viele der Elemente integrieren, wie sie eben in 1 bis 3 genannt wurden. Da wir es gerade hier mit historisch gewachsenen Strukturen zu tun haben, sollten wir nicht in allzu unverrückbaren disziplinären oder subdisziplinären Strukturen denken. Das berechtigt zur Hoffnung, dass verrückbare disziplinäre Grenzen und disziplinäre Überlappungen Einfallstore für inter- und transdisziplinäre Kooperation bieten.
Als Konsequenz dieser Einteilung können wir, anders als oben beschrieben, einem Fach wie auch einer Disziplin mehrere Disziplinaritäten zuordnen, da dort auf verschiedensten Integrationsniveaus gearbeitet wird. Ein Beispiel bieten Wissenschaften, die sich als „Wissenschaften vom Menschen“ verstehen und die auf verhaltensmäßigen, physiologischen, anatomischen oder molekularen Integrationsniveaus, deren Systeme („Gegenstände“) also z.B. auf molekularer Ebene angesiedelt sind und die entsprechend in einer molekularbiologischen (und chemischen) Theorie beschreiben werden.
Eine umfassende und sowohl für Philosophen als auch für Forscher verständliche Definition findet man bei Defila/Di Giulio (1998, S. 112f.): Danach besteht das Identitätsstiftende einer Disziplin in a) „einem relativ homogenen Kommunikationszusammenhang von […] Forschern (‚scientific community‘)“, b) einem Bestand an Wissen („Aussagen, Erkenntnissen, Theorien“), c) relevanten Forschungsproblemen, d) einer Menge bestimmter anerkannter Methoden und Problemlösungen, e) einer „spezifischen Karrierestruktur mit institutionalisierten Sozialisationsprozessen […]“.
Mit anderen Worten besitzt jede Disziplin spezifische Auffassungen über das „richtige Vorgehen“ zur Strukturierung der Wirklichkeit und über das, was als wissenschaftlich gilt (und was nicht).