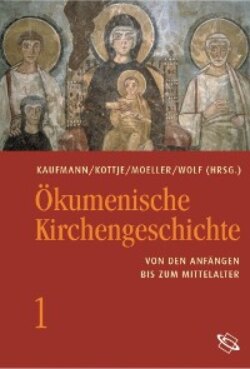Читать книгу Ökumenische Kirchengeschichte - Группа авторов - Страница 12
Die Erzählung von der „Geburtsstunde“ der Kirche und die historische Rückfrage
ОглавлениеLukas wollte erklärtermaßen Geschichte schreiben. Im Rahmen der hellenistischen Konventionen bedeutet das: die Kräfte zum Vorschein bringen, die geschichtliche Abläufe vorantreiben. Was nach dem Desaster der Kreuzigung Jesu zur Geburtsstunde der Kirche führt, ist nach Lukas Gottes Geist. Das erzählt er in seiner Pfingstgeschichte (Apg 2,1–13). In den Bildern von Sturmbrausen und Feuerzungen wird ein neues bzw. neu gedeutetes Sinaigeschehen dargestellt. Zeitlich bindet Lukas dieses Ereignis in das jüdische „Kirchenjahr“ ein und platziert den Neuanfang 50 Tage nach dem Todespascha Jesu aufs Wochenfest (griechisch Pentekoste = 50. Tag), an dem sich Juden an die Sinaiereignisse erinnerten. Anders als am Sinai bedient sich Gott nach Apg 2 in Jerusalem des „Mediums“ der Apostel, um sein Wort für Menschen zu versprachlichen – und zwar sofort in vielen Sprachen, so dass mit den Juden aus aller Herren Länder, die die Apostel in ihren eigenen Landessprachen reden hören, schon die Heidenwelt in den Blick kommt. Der Pfingstpredigt des Petrus (Apg 2,14–41) ist exemplarisch abzulauschen, was der Geist Gottes inhaltlich bewirkt: eine wohlgesetzte Rede, die ihrerseits die Kraft benennt, die Jesus selbst bewegt und im Leidensweg zum Ziel geführt hat, eben Gottes Geist.
Hinter diese Geschichtstheologie zurückzufragen und die historischen Anfänge zu rekonstruieren ist nicht aussichtslos. Denn es gibt auch andere Erzählungen vom Anfang. Bereits Lukas verarbeitet eine ihm vorausliegende Tradition, die statt von einem Sprachen- bzw. Hörwunder (so Apg 2,5–11) von einer gottgewirkten Glossolalie (so ursprünglich Apg 2,1–4), also einem ekstatischen Ereignis, erzählt. In 1 Kor 15,3–7 ist von diversen Erscheinungen die Rede, eine davon vollzieht sich vor 500 Brüdern. Joh 20,21f. erzählt von der Geistmitteilung am Ostertag, wobei die Jünger Jesus „sehen“.
Aufgabe und Chance der Geschichtswissenschaft (historia) ist es, diese verschiedenen Darstellungen (narratio rerum gestarum) miteinander zu vergleichen, nach Überschneidungspunkten zu suchen, sie vom Interpretationsrahmen des jeweiligen Autors zu lösen und sie in den sozialgeschichtlichen und historischen Kontext einzuordnen, auf den diese Traditionen selbst verweisen. Es ergibt sich: Für den Anfang der Jesusbewegung wird in unterschiedlichen Traditionen von visuellen Phänomenen erzählt, wobei zwei Traditionen von einer Geistmitteilung sprechen, ein Detail, das in 1 Kor 15 fehlt. Dafür ist dort, ähnlich wie in Apg 2, ebenfalls von einer größeren Gruppe die Rede, die von einem Initialphänomen erfasst wird. Löst man diese „Daten“ von den Intentionen ihrer Autoren (Paulus: Legitimation seiner apostolischen Autorität; Johannes: Weiterführung des Erbes Jesu; Lukas: Konkretisierung der Äußerungen des Geistes) und stellt sie dagegen in den Interpretationsrahmen, wie er durch das Leben Jesu vorgegeben wird, nämlich die apokalyptische Erwartung der Zeitenwende, dann können die Anfänge folgendermaßen rekonstruiert werden: Die Jünger, die Jerusalem nach der Kreuzigung Jesu fluchtartig verlassen hatten (vgl. Mk 14,50), wurden mit visuellen Phänomenen konfrontiert. Sie sahen (den getöteten) Jesus – und deuteten dieses Phänomen im apokalyptischen Horizont als Indiz für die Erweckung Jesu aus den Toten, was gleichzeitig das Signal für die Zeitenwende darstellte; denn am Scheidepunkt der Äonen wurde die Erweckung der Toten, aller Toten, zum Gericht erwartet. Die geistgewirkte Glossolalie im Sinn einer Kommunikation mit der göttlichen Welt konnte in apokalyptischen Kreisen als Medium fungieren, um im Lobpreis „Gottes Geheimnisse“ zur Sprache zu bringen (vgl. TestHiob 48–51; 1 Kor 14,2). Konstruktiv eingebunden lassen sich dann die glossolalischen Verzückungen bei den christlichen „Anfängen“ einerseits ebenfalls als Indiz für den Anbruch der neuen Zeit, andererseits als lobpreisende Offenlegung des Sinns der Erscheinungen bzw. Visionen verstehen: „Wir preisen Gott, der Jesus aus den Toten erweckt hat“, ist eine mit dem Kern der ältesten Credo-Formel des Neuen Testaments identische Aussage (vgl. Röm 4,24).
Eine derartige Rekonstruktion der „Anfänge“ besagt: (1) Die für sich genommen vieldeutigen Phänomene, wie etwa die Erscheinung eines Toten, werden im Sinn Jesu gedeutet – und zwar im Rahmen seiner Grundüberzeugung, dass die Zeitenwende bereits angebrochen ist und Gott seine Herrschaft auf Erden unwiderruflich herbeiführt. Seine Anhänger, die sich nach seiner Kreuzigung von ihm entfernen, glauben ihm diese Botschaft.
(2) Die Phänomene des Anfangs, die zur Deutung der Erscheinungen bzw. Visionen als Signal für die beginnende Totenauferweckung führen, werden in allen Traditionen auf eine Kraft von außen zurückgeführt: Die Initialzündung kommt von Gott.
(3) Das Bewusstsein, unmittelbar an der Zeitenwende zu leben, erklärt auch, weshalb Jesu Jünger wieder nach Jerusalem zurückkehrten. Nach jüdischer Tradition werden nämlich dort die Endereignisse erwartet: „An jenem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen, wegen all deiner schändlichen Taten, die du gegen mich verübt hast … Und ich lasse in deiner Mitte übrig ein demütiges und armes Volk, das seine Zuflucht sucht beim Namen des Herrn. Der Rest von Israel wird kein Unrecht mehr tun und wird nicht mehr lügen, in ihrem Mund findet man kein unwahres Wort mehr …“ (Zef 3,11–13). Die Gruppe der Rückkehrer sah sich offensichtlich als dieser „Rest Israels“. Sie hielten „den Platz der Parusie besetzt …, gleichsam als eschatologische Vorposten, als die Wächter auf den Zinnen der Stadt, die der Welt und insbesondere den Zerstreuten das Kommen des himmlischen Königs künden sollten, wenn es soweit war (Jes 52,8)“ (Georgi, 27). Aber nicht alle Jesusanhänger vollzogen diesen Schritt mit: Die Q-Gruppe, also die Trägerin der so genannten Spruchquelle, blieb in Galiläa. Gegen die gefährliche Stadt Jerusalem schleuderte sie harte Worte (vgl. Q 13,34)*. Sie war überzeugt, dass die Endereignisse überall wahrnehmbar seien, wie ein Blitz von einem Ende der Erde zum anderen (vgl. Lk 17,24).
Haben diese Gruppen, die trotz ihrer unterschiedlichen Einstellung gegenüber Jerusalem ihre eschatologische Erwartung auf Israel konzentrierten und Heiden allenfalls im Rahmen der Völkerwallfahrt (vgl. Jes 2,2–4; 60) als umkehrwillige (weiterhin unbeschnittene) Gäste des Gottesvolkes sahen, Jesus besser verstanden als die anderen Gruppen, die in seinem Namen Heiden tauften und Gemeinden in den großen Städten der Mittelmeerwelt gründeten? Hat Jesus das alles nicht gewollt?