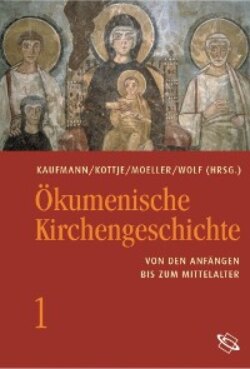Читать книгу Ökumenische Kirchengeschichte - Группа авторов - Страница 20
Paradigmatische Tendenzen bei der Ämterentwicklung
ОглавлениеInstitutionalisierung. Mit der Umstellung auf die Konzeption „Ekklesia als Haus“ in den Pastoralbriefen sind gleichzeitig Merkmale der Institutionalisierung verbunden. Aus Funktionen werden Ämter. Bisher erwuchsen bestimmte Funktionen „von unten“. Der Hausvater stellte Ressourcen zur Verfügung, Presbyter wurde man wegen seines Ansehens in der Gemeinde. Es kam auf das persönliche „Charisma“ an, wie die jeweilige Rolle ausgefüllt wurde. In den Pastoralbriefen erfolgt die institutionelle Legitimation „von oben“. Rollen werden vorgegeben, Aufgaben festgeschrieben und gleichzeitig die Respektsstellung abgesichert. Der Episkopos wird durch Handauflegung des Presbyterkollegiums auf Lebenszeit ordiniert (vgl. 1 Tim 6,14). Durch diesen Akt werden ihm das Amtscharisma (1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6) und eine gewisse Immunität (1 Tim 5,19) verliehen. Öffentlich wird er auf eine bestimmte Tradition verpflichtet (1 Tim 6,12), nämlich die „gesunde Lehre“ bzw. das „anvertraute Gut“ (παϱαθήκη/depositum fidei: vgl. 1 Tim 1,10; 6,20; 2 Tim 1,12–14). Damit dürfte das gesamte Corpus Paulinum gemeint sein, als dessen Ausführungsbestimmungen die Pastoralbriefe konzipiert sind. Folgerichtig muss man sich für die Gemeindeämter bewerben, für das des Episkopen genauso wie für das des Diakons/der Diakonin oder der Witwe. Kriterienkataloge sind formuliert (1 Tim 3,1–13; 5,3–16). Allerdings bleibt unklar, wer die Auswahl trifft.
Monopolisierung. Bis weit ins 2. Jahrhundert hinein gab es ein Wechselspiel zwischen Wanderpredigern vom Typ der Q-Missionare oder des Paulus und Gemeinden vor Ort. Allerdings waren Konflikte vorprogrammiert. Denn auch vor Ort etablierten sich Leitungsfiguren. Während uns die Spruchquelle, 2/3 Joh sowie Paulus in seinen Briefen die Konflikte aus dem Blickwinkel der Wanderprediger schildern, sprechen das Matthäusevangelium und die Didache aus der Sicht der Ortsgemeinden. Die Q-Missionare sind bestürzt über die jüdischen Kommunen, die ihnen nicht eilfertig genug ihre Türen öffnen (vgl. Q 10,10–15). Paulus ist geradezu von der Vorstellung besessen, dass andere Wanderprediger seine Bemühungen unterlaufen und seine theologischen Grundlegungen torpedieren (vgl. 2 Kor 10–13; Gal). Umgekehrt erscheinen aus der Sicht des Matthäusevangeliums Wandermissionare als Wölfe im Schafspelz („Pseudopropheten“: Mt 7,15–23), vor denen der Theologe Matthäus zu warnen sich bemüßigt sieht. Auch die Didache baut vor, präzise gesprochen: die ortsansässigen Episkopen und Diakone bzw. Propheten und Lehrer. Wandernde Apostel sollen nicht länger als zwei Tage bleiben, sonst disqualifizieren sie sich selbst. Aufgenommen sollen sie nur werden, wenn ihre Lehre inhaltlich mit den ortsüblichen Standards übereinstimmt (Did. 11,1–6). Wie konkurrierende Wanderpredigergruppen sich gegenseitig schachmatt setzen und dabei die Autorität vor Ort zum Gewinner machen konnten, zeigt plastisch 3 Joh: Der „Alte“ beklagt sich darüber, dass ein gewisser Diotrephes die von ihm ausgesandten Wanderprediger abgewiesen habe. Die Tragik des Geschehens liegt darin, dass der Gescholtene dabei lediglich die Anweisungen des Alten in 2 Joh 10f., ja nicht die Wanderprediger der Irrlehrer ins Haus zu lassen, besonders peinlich befolgt und generell die Schotten dicht gemacht, also überhaupt keine Wanderprediger aufgenommen hat. Seinen Gemeindemitgliedern droht er bei Zuwiderhandlung mit dem Ausschluss. Der Alte wirft ihm deshalb vor, den Platzhirsch spielen zu wollen (ϕιλοπωτεύων). Es geht also immer auch um Einfluss und Verteidigung des theologischen Reviers.
Wanderprediger konnten eine heilsame Befruchtung von außen sein, aber sie konnten auch – von der anderen Seite aus betrachtet – für Unruhe sorgen und den „häuslichen Frieden“ stören. Die Stellung des örtlichen Leiters blieb unangefochten, sein Wort galt mehr, wenn er sich nicht der Konkurrenz von theologischen Gästen zu stellen brauchte, sei es hinsichtlich der Persönlichkeitsstruktur, sei es in inhaltlichen Debatten.
Professionalisierung. Von Beruf war Paulus Zeltmacher (vgl. Apg 18,3), seine Passion aber war, Apostel Jesu Christi zu sein. Das war keine freiwillige Entscheidung, sondern ein Zwang, der auf ihm lag (vgl. 1 Kor 9,16). Deswegen nahm er für seine Verkündigung kein Geld. Bei den Korinthern hat das für nicht wenig Verwirrung gesorgt. Denn das entsprach durchaus nicht den Gepflogenheiten urchristlicher Wandermissionare – jedenfalls in der Prägung der Q-Leute. Man hat es Paulus vorgehalten: Petrus, die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn haben nicht nur ihre Frau auf ihrer Missionsreise mit dabei, sondern sie lassen sich auch von den Gemeinden unterstützen (vgl. 1 Kor 9,4f.). Ganz nach dem bekannten Motto: „Der Arbeiter ist seines Lohnes wert“ (Q 10,7; 1 Tim 5,18). Das ist auch die Devise, die sich durchgesetzt hat.
Zwei Linien sind erkennbar. (1) Die Regelung der Didache differenziert zwischen charismatischen und verwaltungstechnischen Diensten. Propheten und Lehrer, in deren Worten sich göttlicher Geist Bahn bricht, sollen von der Gemeinde mit Naturalien unterhalten werden – analog zu den jüdischen Priestern, an die die Erstlinge abgeführt werden müssen (Did. 13,1–7). Für Episkopen und Diakone dagegen, die für die Einnahme, Verwaltung und soziale Verteilung von Geldern verantwortlich sind und von der Gemeinde in dieses Amt gewählt werden, ist zwar die gleiche Achtung, aber keine finanzielle Entschädigung vorgesehen (Did. 15,1f.). (2) Die andere Linie hält sich an das Modell der Vereine: Für Funktionäre sind mehrfache Anteile an Essensrationen beim Vereinsmahl bzw. an Geldausschüttungen vorgesehen. 1 Tim 5,17f. („die ordentlich vorstehenden Presbyter sollen doppelter Ehre gewürdigt werden …“) ist in dieser Linie zu lesen. Voll ausgebaut erscheint das System in der syrischen Didaskalia, wo an den Proportionen nicht nur der Rang der Funktionäre abgelesen werden kann (in aufwärts steigender Linie von den Witwen über Diakone, Presbyter bis hin zum Episkopos), sondern für Episkopen und Diakone sogar von denjenigen Agapen Pflichtanteile verlangt werden, an denen sie nicht teilgenommen haben (syrische Didaskalia 8f.). Das lässt darauf schließen, dass sie davon ihren Unterhalt bestreiten. Der Kirchenmann lebt von seinem Beruf.
Sazerdotalisierung. Die Praxis und Theorie der urchristlichen Gemeinden hatte ein entscheidendes Manko: Sie wurde – jedenfalls nach der Absonderung von den jüdischen Synagogalgemeinden – nicht als „Religion“ wahrgenommen. Denn es fehlte, was nach antikem Empfinden „Religion“ maßgeblich konstituiert: Tempel, Opferkult und Priester. Der Theologe des Hebräerbriefes hat als Erster die Flucht nach vorn ergriffen und ist gleichzeitig dem Abstand vom Tempelkult jeglicher Couleur treu geblieben: Er schildert Jesus als Hohenpriester, der im himmlischen Tempel agiert. Er ist Opfertier und Opfernder zugleich. Durch seine Vermittlung haben alle Christen allein durch das Hören des Wortes unmittelbaren Zugang zu Gott – eine eindeutige Überbietung aller Anstrengungen des irdischen Tempelkults in Jerusalem. Ein kluger Schachzug, der in der Theologiegeschichte des Urchristentums aber nicht durchgehalten wurde. Auch in diesem Fall hat sich das normale Pattern durchgesetzt.
Die Wende trat bereits mit dem 1. Clemensbrief ein: Der Brief aus der Gemeinde von Rom versucht, einen Autoritätskonflikt in Korinth zu schlichten. Gegen einige nicht näher genannte Presbyter gab es massiven Widerstand. Ohne dass sie sich etwas hätten zuschulden kommen lassen, wurden sie abgesetzt. Um dieses Vorgehen theologisch zu disqualifizieren, greift 1 Clem auf die alttestamentliche Kultordnung zurück: Wie hier alles in geordneten Bahnen verläuft, Priester und Leviten nach vorgeschriebenen Regeln ihren Dienst tun, wobei die Auswahl gerade dieser Personengruppen göttlicher Absicht entspricht, so habe auch Christus zunächst die Apostel eingesetzt, die dann – um späterem Streit vorzubeugen – Episkopen und Diakone eingesetzt hätten mit dem Auftrag, diese Reihe ihrerseits fortzusetzen (1 Clem 42–44). Wohlgemerkt: Episkopen und Diakone werden hier weder „Priester“ noch „Leviten“ genannt. Aber unter dem pragmatischen Ziel der Amtsbegründung werden sie typologisch zueinander in Bezug gesetzt. Damit sind die Geleise für entscheidende Veränderungen im Amtsverständnis gelegt: (1) Der Sukzessionsgedanke wird für die Legitimation des Amtsträgers das entscheidende Kriterium. (2) Kultdiener stehen „Laien“ gegenüber, in 1 Clem 40,5 terminologisch zum ersten Mal. (3) Die Funktion der Episkopen bei der Eucharistiefeier (: 1 Clem 44,4) wird – analog zum alttestamentlichen Kult – vom Vollzug eines Opfers her verstanden, mit der Konsequenz, dass auch die Eucharistiefeier selbst als Opfer aufgefasst werden kann (vgl. Justin, Apol. 1, 65). Das wiederum wird die Basis dafür, ab dem 3. Jahrhundert n. Chr. auch die christlichen Amtsträger ungeniert „Priester“ (ἱεϱεύς/sacerdos) zu nennen. Die Linie endet institutionsgeschichtlich damit, dass unter Konstantin der christliche Klerus den heidnischen Priesterschaften gleichgestellt wird, d.h. an der gleichen Privilegierung (z.B. Steuerfreiheit) partizipiert.
Ent-Feminisierung. In der ersten Phase der Ausbreitung des Christentums spielten Frauen sowohl in der Mission als auch in den Hausgemeinden vor Ort eine führende Rolle. Andronikus und seine Frau Junia nennt Paulus „ausgezeichnet unter den Aposteln“ (Röm 16,7), Priska und Aquila seine Mitarbeiter (Röm 16,3). Wie aktiv sich die Begleiterinnen der Apostel, der Herrenbrüder und des Petrus an der Mission beteiligt haben (vgl. 1 Kor 9,4f.), ist unsicher. Was die Frauenquote vor Ort angeht, ist die Grußliste des Römerbriefes (Röm 16,3–16) eine statistische Fundgrube. Der Anteil der Frauen, die eine aktive Rolle in der Gemeinde spielen, übersteigt den der Männer bei weitem. Für die paulinischen Gemeinden ist insbesondere Phöbe zu nennen, die in Kenchreä, einem der beiden Häfen von Korinth, als „Diakonin“ und „Prostatis“ wirkte (Röm 16,1f.), womit vielleicht konkret auf ihre Hilfe bei der Eingemeindung von Fremden angespielt ist. Einen weniger guten Eindruck hinterließen die beiden Streithennen Evodia und Syntyche in der Gemeinde von Philippi (Phil 4,2f.). Selbst in denjenigen Gemeinden, die durch Presbyterkollegien geleitet wurden, sich also am gängigen patriarchalisch ausgerichteten Verfassungsmodell der Städte orientierten, konnten Frauen – außerhalb des Ratsgremiums – wichtige Positionen übernehmen, wie es gerade durch die Gegenmaßnahmen der Pastoralbriefe bezeugt wird: als Lehrerinnen (1 Tim 2,12), als ehefreie Frauen, die sich „Witwen“ nannten und diakonisch tätig waren (1 Tim 5,3–16). Die Pastoralbriefe schoben hier einen Riegel vor. Sie sprechen ein deutliches Lehrverbot aus (1 Tim 2,12) und schließen Diakoninnen – im Unterschied zu den männlichen Diakonen – vom Aufstieg in das propagierte Episkopenamt aus (vgl. 1 Tim 3,8–13). Fatal hat sich ausgewirkt, dass Frauen in der Führungsriege und im aktiven Verkündigungsdienst zum Kennzeichen für gnostische Zirkel wurden. Dabei ist es historisch betrachtet so gewesen, dass Frauen in gnostischen Kreisen den Platz behalten konnten, auf dem sie in paulinisch geprägten Gemeinden lange Zeit problemlos zu agieren gewohnt waren. Wenn wir von einem institutionellen Amt frühestens ab der Zeit der Pastoralbriefe sprechen können, müssen wir sagen: Frauen wurden nicht aus dem Amt verdrängt, sondern: sie waren längst „draußen“, als kirchliche Ämter konstruiert wurden. Insgesamt ist es für die weitere Entwicklung bezeichnend, dass es ausgerechnet die Gegner des Christentums waren, die – teilweise süffisant, wie etwa Celsus (Frgm. III 55) – die Frauen (und Handwerker) als die eigentlichen Katalysatoren der christlichen Botschaft herausstellten. Zwar gibt es auch noch für das 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. Zeugnisse für Frauen in führenden Rollen, das orthodoxe Christentum jedoch hat sich für die Männer in der Führungsriege entschieden.
Hierarchisierung. Unter „Hierarchie“ wird eine von Gott eingesetzte und legitimierte Herrschaftsstruktur mit klaren Unter- und Überordnungen verstanden. Eindeutig liegt diese Konzeption erst im so genannten monarchischen Episkopat (Schöllgen) vor, erkennbar etwa an den proportional gestaffelten Pflichtabgaben für Episkopen, Presbyter usw. (syrische Didaskalia) oder der abgestuften Amtsvollmacht, was die Vergebung der Sünden und die Vergabe von Ämtern angeht (Traditio Apostolica). Verschiedene Vorstufen lassen sich benennen: Der 1. Clemensbrief hält die göttliche Einsetzung und Legitimierung der Episkopen (und Diakone) klar fest, unterscheidet terminologisch zwischen Amtsträgern und Laien, lässt aber – was das Verhältnis zwischen Episkopen, Presbytern und Diakonen angeht – noch keine deutlichen Unter- und Überordnungen erkennen. Die Pastoralbriefe zielen zwar eine Einzelfigur als „Hausvater“ der Gemeinde an, lassen jedoch ebenfalls seine Zuordnung zu Presbytern und Diakonen unbestimmt („Monepiskopat“). Klare Unterordnungen gibt es vom antiken Hausmodell her nur im Blick auf die Frauen, Kinder und Sklaven.
Auch in den paulinischen Gemeinden gab es bereits das Phänomen der Unterordnung, aber im Sinn von Respekt und Anerkennung (επιγιγνώςκειν; είδέναι). Paulus bittet darum – und zwar für alle, die sich für die Gemeinde abmühen (κο-πιάν). Paulus nennt sie (im Blick auf sich selbst) „Mitarbeiter“ bzw. (im Blick auf die Gemeinde) „Vorsteher“ (προϊςτάμενοι), aber in dem Sinn, dass sie tun, was allen aufgetragen ist: einander auf den richtigen Weg bringen (νουθετεΐν); vgl. 1 Kor 16,16–18; 1 Thess 5,12–15. Diese Art von „Unterordnung“ war funktional und nicht institutionell gedacht, relational und nicht absolut, denn sie basiert auf dem Konzept, dass alle über die gleiche Grundausstattung verfügen: in allen wirkt der gleiche Geist (vgl. 1 Kor 12,1–11).
Es waren vor allem drei Shifts, die zu einer hierarchischen Ämterordnung geführt haben: (1) von der freien Koordination der einzelnen Gemeindefunktionen (1 Kor 12) zur geregelten Ämterstaffel mit Aufstiegsmöglichkeit, wie es sich bereits in 1 Tim 3,13 andeutet; (2) von den Einzelfunktionen, die von unterschiedlichen Personen wahrgenommen wurden, hin zur Aufgabenkulmination, wobei zunächst Leitung und Lehre verknüpft wurden (Pastoralbriefe), dann Gemeindeleitung und Eucharistievorsitz (Ignatius von Antiochien) sowie schließlich Eucharistievorsitz und Zuständigkeit für die Predigt (Justin Martyr). (3) Die dritte Bewegung geht von der kollektiven Leitung (Presbytergremien) hin zur Einzelfigur an der Spitze (Monepiskopos). Die wesentliche Stufe zur Ausbildung des eigentlichen monarchischen Episkopats stellt die klare Ausbildung der Dreierstaffel (Diakone, Presbyter mit einem Bischof an der Spitze) dar, die zusätzlich dadurch gekennzeichnet ist, dass der Bischof nicht nur – seinem Titel gemäß – die Inspektorenaufgaben wahrnimmt, sondern auch andere Funktionen exklusiv an sich zieht. Vermutlich hat diese Entwicklung mehr Auseinandersetzungen ausgelöst, als in unseren schriftlichen Zeugnissen erkennbar wird. Ein Phänomen, das leicht einsichtig ist, weil sich die monarchische Ordnung schließlich durchgesetzt hat. Immerhin ist in der Schrift „Die Himmelfahrt des Jesaja“ (frühe Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr.) von Zwietracht unter Hirten und Presbytern die Rede (3,29). Der Aufruhr in Korinth, den 1 Clem theologisch zu schlichten versuchte, könnte eine Reaktion darauf gewesen sein, dass künftige Episkopen jeweils von ihren Vorgängern eingesetzt werden und die Funktionen nicht mehr „von unten“ wachsen sollten. Für die Hausvaterstellung mit allen rechtlichen Konsequenzen warb 1 Tim, und niemand weiß, wie die Frauen der betroffenen Gemeinden darauf reagierten. Bezeugt ist die dreigestufte Ämterstaffel mit einem einzigen Bischof an der Spitze zum ersten Mal in den Briefen des Ignatius von Antiochien.
Es ist nun verblüffend, dass ausgerechnet Ignatius, der als erster Kronzeuge für die folgenreiche christliche Ämterstaffel gilt, das Konzept der Hierarchisierung durchbrochen hat. Nicht nur, dass Bischof und Presbyter wie die Saiten einer Kithara zusammenklingen sollen (Ignatius, Eph 4,1) oder dass die Einheit zwischen Bischof und den „Vorsitzenden“ in den Hausgemeinden angemahnt wird (Magn 6,2), Ignatius scheint absichtlich die scheinbar klare Parallelstaffelung Gott–Ratsversammlung der Apostel–Jesus Christus bzw. Bischof–Presbyter–Diakone in Unordnung bringen zu wollen (vgl. nur Magn 6,1; Trall 3,1 mit Smyrn 8,2; Magn 2,1; Trall 2,1). Denn ihm schwebt nicht die Idee einer geregelten „Herrschaftsweitergabe“ vor, sondern der Urbild-Abbild-Gedanke im Sinn einer symbolisch-dynamischen Repräsentanz. Die inkarnatorische Christologie, die Ignatius gegen die Irrlehrer in seinen Briefen verteidigt, wird in der Gemeindeverfassung sichtbar vor Augen geführt. Der Glaube an den einen Gott, der sich in Jesus Christus als Mensch gezeigt hat und seinen irdischen Weg bis zum Tod ans Kreuz gegangen ist, inkarniert sich sozusagen in der organisatorischen Trias von einem Bischof mit seinen Diakonen und Presbytern. Zusammen stellen sie den Weg Gottes zu den Menschen sichtbar dar. Weder die göttliche Einsetzung noch die lückenlose Amtsgenealogie bilden nach Ignatius das Rückgrat für einen Bischof. Kriterium ist vielmehr, ob er sich (zusammen mit seinem Mitarbeiterstab) funktional als Abbild der inkarnatorischen Christologie versteht und notfalls – wie Ignatius – bereit ist, für diese Überzeugung auch selbst in den Tod zu gehen (Trall 10,1; Smyrn 4,2).
Brisant wurde diese Konzeption im Blick auf den Umgang mit Irrlehrern, deren Position in den Ignatiusbriefen bereits deutliche Konturen annimmt, jedenfalls was die vertretene doketische Christologie angeht. In der Logik der Urbild-Abbild-Idee wird Einheit nicht organisatorisch bzw. kirchenpolitisch erzwungen, durch die straffe Führung und das Machtwort eines Episkopos etwa, sondern stellt sich von selbst her. Der Geist ist es, der – dem Urbild entsprechend – in die Einheit mit dem Bischof treibt (Phld 2,2; 7,2). Was den Umgang mit theologischen Gegnern angeht, ist diese Konzeption den johanneischen Vorstellungen vergleichbar – mit dem einen Unterschied, dass es der johanneischen Gruppe gelungen ist, ihre eigene Konzeption unangetastet in den Kanon zu retten und sie gleichzeitig unter den „Schutz“ der großkirchlichen Ämterstruktur zu stellen.
Kanonisch verbürgte Widerständigkeit. „Ihr braucht euch von keinem belehren zu lassen“ wird in 1 Joh 2,27 den Christen der johanneischen Gruppe gesagt. Sie alle haben (durch die Salbung) den Geist, sie sind wissend (vgl. 1 Joh 2,20). Die johanneischen Christen verstanden sich vom Grundparadigma her als Schule: Jesus ist ihr Lehrer, der wegen seiner Lehre verurteilt wird und auf seine Schüler als Traditionsträger verweist (vgl. Joh 18,15–27). Dieses Grundparadigma wird jedoch gleichzeitig durchbrochen, insofern es nach dem Tod Jesu keinen Lehrer mehr gibt, sondern der Geist Jesu in allen wirkt: durch den Parakleten (vgl. Joh 14,26; 16,13–15). Von dieser Konzeption her ist jeder und jede, der/die in Jesus bleibt, fähig, als Apostel, als Prophet, als Missionar zu wirken – was natürlich vor allem im Blick auf die Gewinnung neuer Anhängerschaft gilt. Denn innerhalb der Gemeinde braucht sich niemand belehren zu lassen. Diese Gemeindekonzeption „ohne Amt“ schlägt sich in Bildern wie dem vom Hirten und seiner Herde bzw. dem vom Weinstock und seinen Reben nieder (Joh 10; 15). Sie alle signalisieren Jesusunmittelbarkeit. Es braucht keine Vermittler. Und auch keine starke Hand. Selbst in dem Augenblick, als innerhalb der johanneischen Gruppe divergierende Lehren vertreten wurden (eine doketische Christologie deutet sich an: 1 Joh 4,2f.), wurde die Devise von 1 Joh 2,27 durchgehalten. Wer wirklich vom Geist geleitet ist, wird zum Grundbekenntnis, wie es von Anfang an gelehrt worden ist (1 Joh 1,1–3), zurückfinden.
Außer der Praktizierung dieser wagemutig vertrauensvollen theologischen Grundeinstellung ist der johanneischen Gruppe auch noch ein organisatorisches Paradox gelungen: Sie konnte ihre Gemeinde- bzw. (Nicht-)Amtskonzeption retten, ja sich kanonisch verbürgen lassen, und sich trotzdem großkirchlich etablierten Strukturen unterstellen, wie es literarisch im Nachtragskapitel Joh 21 bezeugt ist. Petrus, Symbolfigur für die Großkirche, wird zwar als Hirte installiert und anerkannt (V. 15–19), aber gleichzeitig verfügt Jesus gerade gegenüber Petrus, dass der „andere Jünger“, den Jesus liebt, womit die Identifikationsfigur der johanneischen Gemeinde gemeint ist, bis zur Wiederkunft Christi „bleibt“ (V. 20–23). Wie am sofort abgewehrten Missverständnis einer biologisch unbegrenzten Lebensdauer negativ und am zweiten Buchschluss (V. 24) positiv abzulesen ist, bezieht sich das „Bleiben“ ganz konkret auf das johanneische Schrifttum, in dem das Grundparadigma einer Gemeinde ohne Amt, aber mit Jesu Geist für alle und in allen festgehalten ist.