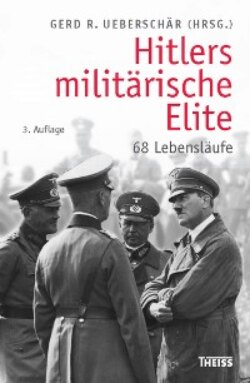Читать книгу Hitlers militärische Elite - Группа авторов - Страница 24
SAMUEL W. MITCHAM, JR. UND GENE MUELLER Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch∗
ОглавлениеWalther von Brauchitsch – der letzte Berufssoldat, der im Dritten Reich Oberbefehlshaber des Heeres werden sollte – wurde am 4. Oktober 1881 in Berlin als Sohn eines preußischen Generals der Kavallerie geboren. Er war von Geburt an für eine militärische Laufbahn bestimmt. Der junge von Brauchitsch wuchs als Mitglied des Pagenkorps am Kaiserhof auf und war eine Zeitlang Leibpage der Kaiserin Auguste Victoria, der Gattin Wilhelms II. Im März 1900 wurde der Achtzehnjährige zum Leutnant im elitären Garde-Grenadier-Regiment Nr.3 ernannt, aber schon ein Jahr später zum 3. Garde-Feldartillerieregiment versetzt, und er blieb fast während seiner ganzen übrigen Laufbahn mit der Artillerie verbunden.
Brauchitsch durchlief eine Karriere, wie sie für einen zukünftigen General durchaus üblich war. Er absolvierte eine Artillerieausbildung, tat Dienst bei der Truppe und wurde 1906 zum Adjutanten einer Artillerieabteilung ernannt. Im April 1909 übernahm er den Posten eines Regimentsadjutanten im 3. Garde-Artillerieregiment. Ein halbes Jahr später wurde er zum Oberleutnant befördert und an die Kriegsakademie kommandiert, wo er zum Generalstabsoffizier ausgebildet wurde. Folgenreich für sein Leben und seine Karriere sollte die Eheschließung mit Elisabeth von Karstedt am 29. Dezember 1910 werden.
1912 wurde Brauchitsch zum Großen Generalstab in Berlin abkommandiert, 1913 zum Hauptmann befördert, und als der Erste Weltkrieg ausbrach, arbeitete er im Generalstab des Heeres.1 Während des ganzen Krieges war er Generalstabsoffizier bei verschiedenen Truppeneinheiten an der Westfront. Bei Kriegsende war er Major und Träger des Hohenzollerischen Hausordens – danach wurde er in das Reichsheer übernommen.
In der Zeit der Weimarer Republik setzte Brauchitsch seinen Aufstieg in die höchsten Ränge des Heeres stetig fort. Er war im Stab des Wehrkreiskommandos II, dann im Stab des Artillerieführers II, bevor er von 1921 bis 1922 Truppendienst als Batteriechef im 2. Artillerieregiment absolvierte. Die folgenden drei Jahre verbrachte er im Truppenamt (d.h. im Generalstab des Heeres); dann tat er wieder zwei Jahre Dienst bei der Truppe, diesmal als Kommandeur der II. Abteilung des 6. Artillerieregiments. 1927 bis 1930 war er Chef des Stabes der 6. Division im Wehrkreis VI in Münster; danach kehrte er ins Truppenamt nach Berlin zurück, wo er zunächst Chef der Heeresausbildungsabteilung und dann von 1932 bis 1933 Inspekteur der Artillerie war. Nach Hitlers Machtübernahme trat er seinen nächsten Posten als Befehlshaber im Wehrkreis I in Königsberg an. Während der Weimarer Republik war Brauchitsch stetig befördert worden: 1925 zum Oberstleutnant, 1928 zum Oberst und 1931 zum Generalmajor. Im Dritten Reich setzte sich sein Aufstieg bruchlos fort: im Oktober 1933 wurde er Generalleutnant, 1936 General der Artillerie.2
Brauchitsch war alles andere als ein NS-freundlicher Offizier; seine Einstellung zu den Nationalsozialisten schwankte zwischen distanzierter Mißbilligung und regelrechter Feindschaft. Selbst nach Hitlers Machtergreifung nahm er gegenüber Erich Koch, dem radikalen Gauleiter von Ostpreußen, eine feste Haltung ein, und er schloß sogar SS-Einheiten, deren Benehmen ihm mißfiel, von den Manövern seines Wehrkreises aus. Als Brauchitsch einmal zu einem Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg eingeladen war, sagte er offen zu General Wilhelm Adam, dem Chef des Truppenamtes, er würde sich wünschen, im Ausland zu leben. Später, als Joseph Goebbels ein diffamierendes Gerücht über sein Privatleben verbreitete, forderte General von Brauchitsch ihn zum Duell. Brauchitsch bekannte sich auch zu seiner evangelischen Religion; man wußte, daß auf seinem Nachttisch immer eine Bibel lag.3 Er galt keineswegs als ein Mensch, der den Nationalsozialisten zu gefallen suchte.
Dafür war er bei der deutschen Generalität als „ein hervorragender Repräsentant aristokratischer preußischer Tradition“ geachtet,4 und General Werner von Fritsch, der Oberbefehlshaber des Heeres, bezeichnete ihn als sein „bestes Pferd“.5 1937 ernannte ihn Fritsch zum Oberbefehlshaber des Gruppenkommandos 4 in Leipzig, womit ihm sämtliche Panzer- und leichten Divisionen, d.h. alle damaligen mobilen Angriffstruppen des Deutschen Reiches unterstanden. Das war eine höchst verantwortungsvolle Aufgabe und ein Anzeichen dafür, daß auf den General noch höhere Ämter warteten.
Brauchitsch aber sah sich keinesfalls kurz vor der glänzenden Krönung seiner Karriere; er hatte vielmehr das Gefühl, seine Karriere nähere sich ihrem Ende. Der Grund für diese düstere Aussicht war eine Frau – genauer gesagt: zwei Frauen.
Elisabeth v. Brauchitsch und der General lebten schon fünf Jahre lang getrennt. Aber als sie noch zusammenlebten, hatte Brauchitsch mindestens ein außereheliches Verhältnis gehabt: mit der bezaubernden Charlotte Rüffer, der geschiedenen Frau eines Offizierskameraden. Brauchitsch hatte sie 1925/26 in Breslau kennengelernt und damals seine Gattin gebeten, in eine Scheidung einzuwilligen; diese aber hatte abgelehnt. Die unerlaubte Beziehung endete, Charlotte heiratete einen Bankdirektor namens Schmidt. Nach dessen frühem Tod war es ihr möglich, die Liaison mit Brauchitsch wiederaufzunehmen, als dieser 1937 aus Ostpreußen zurückkehrte.
Anfang 1938 war Brauchitsch fest entschlossen, die verwitwete Frau Schmidt zu heiraten; aber seine Gattin lehnte eine Scheidung immer noch ab – es sei denn, er würde sie mit einer hohen Summe in bar abfinden. Der General war bereit, ihr einen beträchtlichen Teil seines Gehaltes als Unterhalt zu zahlen, aber damit gab sie sich nicht zufrieden. Es drohte also ein öffentlicher Skandal. Trotzdem entschloß sich Brauchitsch, die Scheidung zu betreiben, selbst wenn ihn das seine Karriere kosten sollte; denn seine Lage schien ihm unerträglich.6 Da kam – aus einer gänzlich unerwarteten Richtung – plötzlich eine Lösung für sein Problem.
Am 26. Januar 1938 wurde Generalfeldmarschall Werner von Blomberg als Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht entlassen. Der nächste Anwärter für sein Amt war Generaloberst Freiherr von Fritsch, der Oberbefehlshaber des Heeres; er war jedoch kein ausdrücklicher Freund des Nationalsozialismus. Man beschuldigte ihn homosexueller Vergehen, was frei erfunden war. Aber diese Vorwürfe lieferten Hitler einen Vorwand, Fritsch seines Postens zu entheben. Am 28. Januar 1938 übernahm Hitler die Aufgaben des Reichskriegsministers selbst, und General Wilhelm Keitel, den er zum Chef des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) ernannte, wurde sein oberster militärischer Büroleiter. Hitler brauchte nun aber einen neuen Oberbefehlshaber des Heeres. Zuerst schlug er den NS-freundlichen General Walter von Reichenau vor; als dieser von Keitel und anderen hohen Generalen abgelehnt wurde, verzichtete Hitler auf seine Ernennung. Rundstedt, der rangälteste Heeresgeneral, wurde verworfen, da er zu alt sei; Stülpnagel galt als „illoyal“ (d.h. als NS-Gegner); Leeb wurde wegen seiner Frömmigkeit abgelehnt – und weil man nicht erwarten durfte, daß er mit den Nationalsozialisten zusammenarbeiten würde. Schließlich nannte Keitel seinen eigenen Kandidaten: Walther von Brauchitsch. Der Chef des OKW empfahl ihn als einen unpolitischen Soldaten, als Könner in Fragen der Organisation und der Ausbildung und als erprobten Truppenführer. Hitler war nicht begeistert; vielleicht erinnerte er sich an Berichte über die skeptische Haltung Brauchitschs gegenüber dem Nationalsozialismus in Ostpreußen. Schließlich erklärte er sich aber bereit, selbst mit Brauchitsch zu sprechen, damit er sich eine eigene Meinung über ihn bilden könne.7
Als Brauchitsch am nächsten Tag, dem 29. Januar, bei Hitler erschien, hatte er bereits von Keitel erfahren, daß seine Beförderung an Bedingungen geknüpft war; er war jedoch willens, Kompromisse zu schließen. Jodl, Keitels Gehilfe, vermerkte in seinem Tagebuch: „Dieser Mann ist zu allem bereit.“8
Dem ‘Führer’ war Reichenau (der den Nationalsozialismus aufrichtig unterstützte) immer noch lieber als Brauchitsch (der das nicht tat). Aber schließlich ernannte er Brauchitsch zum Oberbefehlshaber des Heeres, nachdem auch dessen Scheidungsangelegenheit geregelt werden konnte: Brauchitschs Gattin war mit einer Scheidung einverstanden, falls ihre finanziellen Forderungen erfüllt würden. Zudem stellte Göring Nachforschungen über Charlotte Schmidt an und erfuhr, daß das Objekt der Zuneigung des Generals eine begeisterte Nationalsozialistin war und einen starken Einfluß auf Brauchitsch ausübte. Deshalb empfahl er dem ‘Führer’, Frau von Brauchitsch auszuzahlen und Brauchitschs Ernennung bekanntzugeben.
Von dem Augenblick an, als Brauchitsch Hitler und den Nationalsozialisten erlaubte, sich in sein Privatleben einzumischen, war er in seinem Handeln nicht mehr frei. Seine Wahlmöglichkeiten waren ebenso offensichtlich wie eingeschränkt. Wenn er sich mit Hitler arrangierte, wurden alle seine persönlichen Probleme gelöst; er konnte die Frau, die er liebte, heiraten und gleichzeitig den Gipfel seiner militärischen Karriere erreichen. Die Alternative war: in Schande seinen Abschied zu nehmen oder aber mit einer Frau verheiratet zu bleiben, mit der er nicht mehr zusammenlebte und die er nicht liebte.
So verkaufte sich Brauchitsch an die Nationalsozialisten. Am 4. Februar wurde er zum Generaloberst befördert und zum Oberbefehlshaber des Heeres ernannt. Dafür erklärte er sich bereit, das Heer näher an die nationalsozialistische Weltanschauung heranzuführen, als Fritsch dies bisher getan hatte. Frau von Brauchitsch bekam eine hohe Abfindung in bar, direkt aus der Kasse der NSDAP; am 23. September heiratete Brauchitsch Charlotte Schmidt-Rüffer. Und es kam zu einem umfassenden personellen Revirement, denn Brauchitsch hatte auch erheblichen Personalveränderungen in den höchsten Rängen des Heeres zugestimmt. So wurden zahlreiche Generale versetzt oder verabschiedet, z.B. Generalleutnant Viktor von Schwedler, der Chef des Heerespersonalamtes; der nach Rundstedt rangälteste Heeresgeneral, Wilhelm von Leeb; der Monarchist Ewald von Kleist und der bayerische Freiherr Franz Kress von Kressenstein; ferner Oswald Lutz, der erste General der Panzertruppen, sowie die späteren Generalfeldmarschälle Georg von Küchler, Maximilian von Weichs und Günther von Kluge. Im November wurde auch General von Rundstedt in den Ruhestand versetzt, zusammen mit den Generalen Curt Liebmann, Wilhelm Adam, Hermann Geyer und Wilhelm Ulex. Insgesamt wurden 16 hochrangige Generale des Heeres ihres Kommandos enthoben und 44 weitere auf andere Posten versetzt.9 An ihre Stelle traten überwiegend Männer, die zu diesem Zeitpunkt als NS-freundlich galten.
Der amerikanische Historiker Telford Taylor charakterisierte diese Situation treffend: „Um seinen neuen Posten zu erlangen, fand sich Brauchitsch zu den schändlichsten Zugeständnissen bereit und verpflichtete sich zu ewigem Dank gegenüber Göring und Keitel wie auch gegenüber Hitler. Diese schmähliche Preisgabe der Moral um der Karriere willen kam das deutsche Offizierskorps bald teuer zu stehen.“10
Brauchitsch gelang es nie mehr, sich der Verpflichtung, die er eingegangen war, zu entziehen, und während seiner gesamten Amtszeit als Oberbefehlshaber des Heeres zeigte er im allgemeinen keinerlei Rückgrat. Angewidert von seinem Wankelmut, seiner Gewissenlosigkeit und seiner mangelnden Zivilcourage trat Ludwig Beck, der Chef des Generalstabes, im August 1938 zurück. Sein Nachfolger, General Franz Halder, blieb bis 1942 in seinem Amt, ärgerte sich aber ebenfalls über Brauchitschs Mangel an Zivilcourage.
Brauchitsch selbst mußte sich abfinden mit Hitlers Tiraden und mit den ständigen Eingriffen des Diktators in militärische Angelegenheiten, die sehr bald sogar die Details militärischer Operationen betrafen. Außerdem glaubte Brauchitsch, Deutschland könne einen zweiten Weltkrieg nicht gewinnen; er war jedoch nicht imstande, Hitler davon abzuhalten, sich Hals über Kopf in einen solchen zu stürzen.
Fachlich und taktisch war seine Amtsführung von Operation zu Operation unterschiedlich, im großen ganzen jedoch mittelmäßig. In der Regel bestimmte Generalstabschef Halder die Operationsplanung und -führung, zumal er die stärkere Persönlichkeit in dieser Konstellation war. In die taktischen Operationen des Polenfeldzuges griff Hitler nicht ein, und diese verliefen nach Plan. Die Pläne des OKH für die Eroberung Frankreichs und der Niederlande enthielten jedoch Schwächen, und Hitler tat recht daran, einer weit besseren Alternative – nämlich dem Vorschlag des Generals Erich von Manstein – zuzustimmen. Auf der anderen Seite hätten die deutschen Panzertruppen, wenn es nach dem Willen Brauchitschs gegangen wäre, vor Dünkirchen nicht angehalten, und die britischen Expeditionsstreitkräfte wären fast mit Sicherheit vernichtet worden.
Brauchitsch, nach dem Sieg über Frankreich im Juli 1940 zum Generalfeldmarschall befördert, betrachtete die für Herbst 1940 vorgesehene Landung in Großbritannien mit gemischten Gefühlen. Trotzdem unterzeichnete er am 9. September 1940 eine Anweisung, die vorsah, daß nach der Eroberung der Insel alle männlichen Personen zwischen 17 und 45 Jahren als Zwangsarbeiter auf den Kontinent verbracht werden sollten.11 Dieses Dokument (und es gibt noch weitere ähnlichen Inhalts) beweist, wie weit Brauchitsch zu gehen bereit war, um seinen Herrn zufriedenzustellen und die eigene Stellung zu behalten.
Brauchitsch stellte Hitler oder dem OKW nie die Frage, ob der ab Juli 1940 betriebene Angriff gegen die Sowjetunion ratsam sei – obwohl dieser zu dem gleichen gefürchteten Zweifrontenkrieg führen mußte, der das Kaiserreich nachweislich ins Verderben gestürzt hatte. Als alle drei Oberbefehlshaber der vorgesehenen Heeresgruppen Bedenken gegen Hitlers beabsichtigten rassenideologischen Vernichtungskrieg im Osten äußerten, erwiderte Brauchitsch lediglich, er teile ihre Befürchtungen, könne aber nichts unternehmen. Er erhob auch keinerlei Einspruch, als Hitler direkt befahl, im Osten einen „erbarmungslosen Rassenkrieg“12 zu führen, und wehrte sich nicht einmal gegen den ‘Kommissarbefehl’ vom 6. Juni 1941. Mehrere Offiziere forderten Brauchitsch auf, gegen einen so offenkundig völkerrechtswidrigen Befehl zu protestieren, aber Brauchitsch tat nichts dergleichen. Er hatte aufgegeben. Manstein schrieb später: „Ich bin überzeugt, daß er sich im Kampf mit diesem rücksichtslosen Willensmenschen [Hitler] innerlich aufgerieben hat. […] Brauchitsch fraß seinen Ärger, seine Empörung in sich hinein, zumal er Hitler dialektisch keineswegs gewachsen war.“13
Während der Operation „Barbarossa“ drängte Brauchitsch – zusammen mit Halder – den ‘Führer’, Moskau zum Hauptziel des Feldzuges zu erklären, und erhielt dafür wieder einmal eine scharfe Abfuhr. Schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als sich Hitler zu beugen, nach dessen Willen zuerst Kiev erobert werden sollte. Nachdem die ukrainische Hauptstadt gefallen war, gehörte Brauchitsch mit Halder zu denjenigen, die Hitler dringend aufforderten, doch noch gegen die sowjetische Hauptstadt vorzustoßen, obwohl das OKH praktisch keinerlei Vorsorge für einen Winterfeldzug getroffen hatte. Der ‘Führer’ erklärte sich einverstanden.
Ende 1941 hatte Brauchitsch vier Jahre unaufhörlich von seiten Hitlers Demütigungen, haßerfüllte Zornausbrüche und grobe Verunglimpfungen hingenommen. Am 10. November erlitt er seinen ersten Herzanfall. Im Lazarett erfuhr er, daß er an einer bösartigen Herzkrankheit leide, die wahrscheinlich unheilbar sei.14 Trotzdem nahm er schon Mitte November seinen Dienst wieder auf – mehr als je entschlossen, Moskau einzu nehmen. Das aber war unmöglich – selbst für das deutsche Heer, das fast in Sichtweite Moskaus in Schlamm und Frost steckenblieb. Brauchitsch war psychisch und physisch angeschlagen und ahnte wahrscheinlich, daß man ihn zum Sündenbock für die erste schwere Niederlage der deutschen Wehrmacht machen würde. Am 6. Dezember – genau an dem Tag, an dem Stalin seine große Winteroffensive eröffnete – legte Brauchitsch dem ‘Führer’ sein Rücktrittsgesuch vor. Dieser erwiderte darauf, ein Wechsel im OKH komme im Augenblick nicht in Frage. Brauchitsch erhob sich und verließ den Raum, ohne eine Wort zu sagen.15 Der Generalfeldmarschall hatte richtig geahnt: Man machte ihn zum Sündenbock für das Scheitern des deutschen Heeres vor Moskau – und das mit einem gewissen Recht. Am 19. Dezember entließ ihn Hitler und übernahm selbst den direkten Oberbefehl über das Heer, um ihn nie wieder abzugeben.
Wie viele andere vor ihm zog sich Brauchitsch aus dem öffentlichen Leben zurück. Eine Zeitlang überwachte ihn die Gestapo, aber bald verzichtete man darauf. Der ehemalige Oberbefehlshaber des Heeres war nur noch ein müder, kranker, gebrochener Greis. Nach dem Attentat Stauffenbergs auf Hitler vom 20. Juli 1944 distanzierte er sich öffentlich von seinen früheren Generalstabsoffizieren im OKH und gratulierte „als Nationalsozialist“ dem ‘Führer’ zur Überwindung des Putschversuches. Er begrüßte sogar die Ernennung des Reichsführers-SS Heinrich Himmler zum Befehlshaber des Ersatzheeres.
Im Mai 1945 wurde Brauchitsch in Schleswig-Holstein von den Briten festgenommen. Obwohl er inzwischen fast erblindet war, zwang man ihn, eine Zwei-Mann-Zelle mit fünf anderen Gefangenen zu teilen. Später brachte man ihn nach Hamburg, um ihn dort als Kriegsverbrecher vor ein britisches Militärgericht zu stellen. Er starb jedoch vor Eröffnung des Verfahrens am 18. Oktober 1948 in einem britischen Militärhospital in Hamburg-Barmbek an Herzversagen.