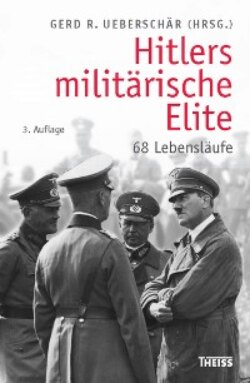Читать книгу Hitlers militärische Elite - Группа авторов - Страница 36
GERD R. UEBERSCHÄR Generaloberst Franz Halder
ОглавлениеGeneraloberst Franz Halder erlebte wie kaum ein anderer Soldat Höhepunkte und Tiefpunkte einer militärischen Laufbahn vom deutschen Kaiserreich bis zum Dritten Reich.1 Während der ersten drei Jahre des Zweiten Weltkrieges war er als Generalstabschef des Heeres in einer der höchsten militärischen Führungspositionen und maßgeblicher Berater Hitlers, zugleich aber in führender Position am Widerstand gegen dessen Regime beteiligt. Ab Sommer 1944 wurde er als Gefangener der Nationalsozialisten in mehrere Konzentrationslager verschleppt. Hätten ihn die Amerikaner nicht im Mai 1945 aus der NS-Haft befreit, wäre er wohl von Himmlers Sicherheitsdienst erschossen worden. In den ersten Jahren nach 1945 galt er als aufrechter Hitler-Kritiker und NS-Gegner. Als seine Verstrickung in die NS-Verbrechen mit Hilfe der von den Westalliierten an die Bundesrepublik zurückgegebenen Akten immer exakter nachgewiesen werden konnte, kam es zu heftigen Vorwürfen wegen seines Versagens und der schweren politischen Irrtümer; denn sie verhinderten, daß Hitler in seiner verheerenden Kriegspolitik und bei seinen verbrecherischen Aktionen aufgehalten werden konnte. Insgesamt schwanken so das Bild von Halder und das Urteil über seine Haltung in der NS-Zeit.
Franz Halder wurde am 30. Juni 1884 in Würzburg geboren. Er stammte aus einer im schwäbischen Allgäu bei Isny beheimateten bayerischen Offiziersfamilie.2 Sein Vater Maximilian Halder brachte es bis zum bayerischen Generalmajor und Festungskommandanten. Wie seine Mutter Mathilde geb. Steinheil wurde Franz Halder im evangelisch-lutherischen Glauben getauft und erzogen.3 Bereits in der Schule zeigte er sehr großen Fleiß, lobenswerte Leistungen und besonderes Pflichtgefühl. Nach dem Abitur an einem humanistischen Gymnasium im Juli 1902 trat er als Offiziersanwärter in das 3. königlich bayerische Feldartillerie-Regiment ein. Dort erhielt er auch im März 1904 seine Beförderung zum Leutnant. Im September 1907 heiratete der junge Offizier Gertrude Erl, Tochter des bayerischen Majors a.D. Rudolf Erl. Aus der Ehe gingen drei Töchter hervor.
Die Generalstabsausbildung absolvierte Franz Halder, ab 1912 Oberleutnant, an der königlich-bayerischen Kriegsakademie von Oktober 1911 bis August 1914. Nach glänzendem Abschlußzeugnis kam er im Ersten Weltkrieg sogleich in mehrere Generalstabsdienststellungen. Zuletzt war er ab Dezember 1917 als Führungsgehilfe (Id-Offizier) im Stab der Heeresgruppe „Kronprinz Rupprecht von Bayern“ eingesetzt. Seit dieser Zeit verband ihn eine besondere gegenseitige Wertschätzung mit dem bayerischen Thronfolger, welche die Kriegszeit überdauerte.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde Halder als befähigter Generalstabsoffizier im Mai 1919 in das bayerische Ministerium für militärische Angelegenheiten übernommen und hatte dort allgemeine Organisationsfragen im Zusammenhang mit dem Neuaufbau der Wehrstruktur des demokratischen Deutschen Reiches zu bearbeiten. Als die bayerische Armee im August 1919 aufgelöst wurde, kam er zur neuen Heeresleitung der vorläufigen Reichswehr nach Berlin. Bereits im folgenden Jahr unterrichtete er wieder in München als Taktiklehrer der 7. Division bei der dezentralisiert durchgeführten Führergehilfenausbildung.
Dem Wirken der politischen Parteien stand Halder reserviert gegenüber, zumal er dadurch eine Schwächung der nationalen Wehrhaftigkeit befürchtete. Er mißbilligte das „Parteiengezänk“ um den Ausbau der Landesverteidigung des Reiches. Nach weiteren Dienststellungen – unter anderem in der Heeresausbildungsabteilung des Truppenamtes in Berlin ab März 1929 – rückte er im August 1931 in die Stelle des Chefs des Stabes der 6. Division im Wehrkreis VI in Münster auf. Hier unterhielt er als Oberst gute Kontakte zu Industriekreisen in Westfalen, Hannover und Oldenburg.
In dieser Zeit erlebte er Hitlers Regierungsantritt als Reichskanzler. Dessen Vorstellungen von der Wiederwehrhaftmachung des Volkes und der Wehrertüchtigung der Jugend entsprachen Halders Ideal einer starken militärischen Macht des Staates. Trotz dieser „Teilidentität der Ziele“ betrachtete er aber die Radau- und Gewaltmethoden der NSDAP mit Distanz. Als Urheber dieser kritisch beobachteten Aktionen erkannte er nicht den Parteiführer Hitler, sondern nachgeordnete, „völlig unzulängliche, z.T. wahrhaft minderwertige Ausführungsorgane“4 der vielen NS-Gliederungen. Halders Berichte als Generalmajor (seit Oktober 1934) und Artillerieführer VII in München an den Chef der Heeresleitung, Generaloberst Freiherr von Fritsch, bezeugen denn auch seine sorgenvolle Betrachtungsweise der Gewalttaten beim Auf- und Ausbau des NS-Staates nach 1933.
Wie viele andere Offiziere hat sich Halder damals über Hitlers Absichten und Ziele gewaltig geirrt. Er erkannte dies erst einige Jahre später.
Im Zuge der raschen Aufrüstung wurde er im Oktober 1935 zum Kommandeur der neu aufgestellten 7. Division und im August 1936 zum Generalleutnant ernannt. Bereits im November 1936 übertrug ihm von Fritsch die Vorbereitung und Leitung der großen Wehrmachtsmanöver von 1937, die er anschließend mit großem Erfolg vor Hitler präsentierte.5 Danach blieb Halder als Oberquartiermeister II im Generalstab des Heeres unter General Beck in Berlin. Er war zuständig für Ausbildungsfragen sowie militärwissenschaftliche und kriegsgeschichtliche Arbeiten.
Die Blomberg-Fritsch-Affäre im Februar 1938 brachte in Halders Einstellung zu Hitler eine Wende. Er suchte die beschämende Behandlung des von ihm verehrten Generalobersten von Fritsch abzuwenden und rückgängig zu machen. Dabei stieß er zum Kreis der zum NS-Regime kritisch und oppositionell eingestellten Stabsoffiziere hinzu und war bereit, die Veränderung oder Abschaffung von Hitlers Herrschaft in seine Überlegungen zur Neuformung der innenpolitischen Situation im Reich einzubeziehen.
Aber erst nach General Becks Entlassung und der eigenen Ernennung zu dessen Nachfolger als Chef des Generalstabes des Heeres und zum General der Artillerie Ende August 1938 gelangte Halder in eine Stellung, aus der er selbst gegen Hitler und dessen Regime handeln konnte. Als Generalstabschef arbeitete er als zuverlässiger und „unermüdlicher Arbeiter“6 eng mit Generaloberst von Brauchitsch, dem neuen Oberbefehlshaber des Heeres, zusammen. Beide verstanden sich gut. Obwohl sich Hitler im Februar 1938 mit dem Oberkommando der Wehrmacht unter General Keitel einen eigenen militärischen Stab geschaffen hatte, verstand sich Halder weiterhin als wichtigster Berater des Staatschefs. Zugleich erfuhr er nun aber die gleichen Schwierigkeiten wie noch wenige Monate zuvor General Beck. Auch er fand nur sehr wenige Generale wie z.B. von Witzleben und Hoepner, die als überzeugte Hitlergegner bereit waren, mit ihm direkt in einer militärischen Oppositionsgruppe gegen den Diktator zusammenzuarbeiten. Als verantwortlicher Generalstabschef des Heeres war es zudem zweifellos nicht einfach, zur gleichen Zeit sowohl höchster Operationschef als auch Spitze und Leitfigur der Militäropposition gegen Hitler zu sein.
Bei allen Widerstandsplänen gegen Hitler war Halder kein blinder Draufgänger. Auf politischem Gebiet fühlte er sich unsicher. Außerdem war er von Hitlers außenpolitischen Erfolgen ab 1938 beeindruckt. Trotz gelegentlich scharfer Kritik an Hitlers rücksichtsloser und rechtswidriger Politik wurde Halders Tatkraft durch sensible Gemütsregungen und Zögern gerade im ungewohnten Bereich des politischen Handelns gebremst. Mehrfach war er während der Sudetenkrise, als Hitlergegner den vom Diktator angestrebten Kriegsausbruch zu verhindern suchten, unsicher, ob hinter den militärischen Widerstandskreisen größere Bevölkerungsgruppen standen und ihn bei einem Putsch unterstützen würden. Nach wie vor ist nicht leicht zu beurteilen, wie weit Halder als Planer des militärischen Widerstandes im September 1938 bei der Sudetenkrise gegen Hitler gegangen wäre, wenn das Münchener Abkommen den Krieg nicht verhindert hätte. Wiederholt zweifelte der Generalstabschef, ob der richtige Zeitpunkt für einen Staatsstreich gegen Hitler gegeben war, denn die militärischen und politischen Erfolge Hitlers durch das Münchener Abkommen und in der Blitzkriegszeit vom Herbst 1939 bis zum Sommer 1941 versprachen einen enormen Machtzuwachs für das Reich und für den eigenen Berufsstand. Auch Halder erhielt dadurch Ehrungen und Beförderungen: Ende Oktober 1939 verlieh ihm Hitler das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz, und am 19. Juni 1940 ernannte ihn der ‘Führer’ nach dem Sieg über Frankreich zum Generalobersten. Letztlich blieben Widerstandsaktionen – trotz einiger Planungen – sowohl bei Kriegsbeginn als auch vor dem Angriff auf Frankreich und die Benelux-Staaten aus. Halder hat es 1938 und 1939/40 nicht vermocht, den Oberbefehlshaber des Heeres von Brauchitsch eindeutig auf die Seite der zum Staatsstreich bereiten Hitlergegner zu ziehen.
Die militärischen Erfolge der Wehrmacht in den Feldzügen gegen Polen, Frankreich, Holland, Belgien und Luxemburg sowie auf dem Balkan hoben Halders Ansehen als Generalstabschef. Erfolgreich hatte er den von Generalleutnant von Manstein entwickelten „Sichelschnitt-Plan“ in Nordwestfrankreich in die Tat umgesetzt und souverän geleitet. Zweifellos hatten diese Siege Auswirkungen, als im Sommer 1940 erkennbar wurde, daß Hitler seinen schon lange beabsichtigten Vernichtungskrieg gegen die UdSSR als den Hort des jüdischen Bolschewismus in Angriff nehmen wollte. Obwohl Halder wie Brauchitsch noch im Januar 1941 der Sinn des neuen Krieges gegen die seit August 1939 mit Berlin verbündete Sowjetunion „nicht klar“ war,7 hat er bereits im Sommer 1940 eigenständig im Generalstab die Planungen für einen Angriff auf die UdSSR aufnehmen lassen, denn er wußte spätestens seit 1938 von Hitlers Eroberungsabsicht im Osten8 und wollte dem Diktator bereits bei konkreter Auftragserteilung einen fertigen Operationsplan vorlegen.9
Halder und Brauchitsch machten sich ferner durch unmittelbare Anweisungen für die Truppe bereitwillig an die Umsetzung der von Hitler ausgegebenen verbrecherischen Befehle. Hatte Halder bis dahin Eingriffe Hitlers in die Operationsführung weitgehend abwehren können, so zeigte sich ab Sommer 1941, daß der Diktator beim ideologisch begründeten Weltanschauungskrieg gegen die Sowjetunion immer häufiger und stärker in den Befehlsbereich des Oberkommandos des Heeres eingriff. Hitler bestimmte nicht nur die allgemeine Kriegführung im Osten, sondern auch Kiev und Leningrad statt Moskau als vorrangige Operationsziele in der ersten Phase des „Unternehmens Barbarossa“, das am 22. Juni 1941 mit dem vertragswidrigen Angriff der Wehrmacht auf die UdSSR begann.
Noch einmal erlebte der Generalstabschef danach aufgrund seiner Operationsplanung gegen die Rote Armee herausragende Schlachtenerfolge und Siege in den großen Kesselschlachten. Fälschlicherweise nahm Halder an, der Feldzug gegen Rußland sei „innerhalb 14 Tagen“ gewonnen.10 Als Mißerfolg endete jedoch die von Halder im September und Oktober 1941 durchgesetzte Angriffsoperation „Taifun“ gegen Moskau. In fataler Weise hatte er dabei ganz im Sinne Hitlers zur letzten Willensanstrengung und zum „äußersten Einsatz“ der deutschen Soldaten aufgefordert, um das Angriffsziel Moskau trotz unzureichender Ausstattung und Versorgung im Winter 1941 zu erreichen. Die Niederlage vor Moskau symbolisierte insgesamt das Scheitern des erhofften Blitzkrieges gegen die UdSSR. Während Generalfeldmarschall von Brauchitsch als Oberbefehlshaber des Heeres im Dezember 1941 um seinen Abschied bat und abgelöst wurde, blieb Halder – mit Zustimmung Brauchitschs – auf seinem Posten.
Er hoffte auf eine neue, fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Diktator, der selbst den Oberbefehl über das Heer übernahm und dem er nun direkt unterstellt war. Mit großer Energie betrieben Hitler und Halder dann auch die neue Sommer-Offensive 1942 („Operation Blau“), die die Wehrmacht bis an die Wolga und in das südrussische Erdölgebiet führte. Die Zweiteilung der Angriffsspitze nach Stalingrad und in Richtung Kaukasus führte allerdings zu neuen fachlichen Auseinandersetzungen zwischen Hitler und dem Generalstabschef. Noch bevor sich die Katastrophe in der Wolgametropole und der Untergang der 6. Armee abzeichneten, wurde Halder nach mehrfachen Auseinandersetzungen mit Hitler am 24. September 1942 als Generalstabschef entlassen.
Halder, der in den letzten Jahren und Monaten Hitler mit voller Arbeitskraft gedient hatte, war durch die abrupte und kühle Ablösung – obwohl er sie selbst mehrfach erwogen hatte – schmerzlich berührt und tief verärgert, denn er hatte trotz kritischer Distanz zur NS-Führung Heer und Generalstab zu beachtlichen Leistungen und Erfolgen geführt. Dies rechnete er sich zweifellos zugute. Seine glanzlose Verabschiedung empfand er als unwürdig und ungerecht. Er zog sich als Pensionär nach Berlin und nach Aschau im Chiemgau zurück.
Als 1943/44 jüngere Offizier um Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Henning von Tresckow und Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim neue Widerstandskreise gegen Hitler aufbauten, kam Halder noch einmal am Rande mit Hitlerkritikern im Kreis um den bayerischen Reichsstatthalter General Ritter von Epp und den früheren bayerischen Gesandten in Berlin, Franz Sperr, in Kontakt. Ein Gespräch mit Stauffenberg hatte offensichtlich bereits im Dezember 1942 zur Erkenntnis geführt, daß der frühere Generalstabschef in seiner resignierten Haltung für weitere Widerstandspläne nicht zur Verfügung stand. Zudem wurde Halder von der Gestapo beobachtet. Von dieser Observierung wußten die Verschwörer in Berlin um Beck, Goerdeler und Stauffenberg, so daß sie den Kontakt zu Halder mieden, um nicht unnötige Spuren zu hinterlassen.
Vom Attentatsversuch gegen Hitler am 20. Juli 1944 wurde Halder überrascht. Im nachhinein kritisierte er dessen organisatorische und führungsmäßige Unzulänglichkeiten, gleichwohl sprach er den Akteuren um Stauffenberg seine besondere Hochachtung aus. Bereits am 21. Juli 1944 wurde Halder unter dem Vorwurf des Hochverrats in Aschau von der Gestapo verhaftet. Er kam ins Polizeigefängnis nach München und in die Konzentrationslager Dachau und Ravensbrück/Fürstenberg sowie in das SD-Gefängnis in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin. Auch seine Ehefrau und die älteste Tochter wurden Mitte August 1944 in Sippenhaft genommen. Noch in der Einzelhaft erfolgte am 31. Januar 1945 Halders Entlassung aus dem aktiven Wehrdienst. Nach weiteren Haftstationen im Konzentrationslager Flossenbürg ab Februar 1945 und im Lager Dachau ab April 1945 sowie der Verschleppung nach Toblach wurden Halder und seine Frau am 5. Mai 1945 in Südtirol durch vorrückende US-Truppen aus der SD-Haft befreit.
Danach erfüllte sich allerdings nicht die Hoffnung, sogleich in Freiheit nach Bayern zurückkehren zu können. Als Kriegsgefangener der Alliierten und ab 1. Juli 1946 als Zivilinternierter kam Halder über Italien und Frankreich in das Lager Falkenstein im Taunus. Als Zeuge trat er im Sommer 1946 im Nürnberger Prozeß und nochmals beim Nürnberger Nachfolgeprozeß gegen das OKW (im sogenannten „Fall XII“) auf. Wiederholt befürchteten Halder und seine Familie, er werde wie andere führende Militärs als Kriegsverbrecher in Nürnberg angeklagt. Mit Zufriedenheit registrierte er dann im September 1946, daß der Generalstab des Heeres von der Anklage, eine verbrecherische Institution gewesen zu sein, freigesprochen wurde.
Wie viele andere Generale und Feldmarschälle wies Halder für sich als Angehöriger der militärischen Führungselite eine persönliche Schuld oder Mitschuld an Hitlers verbrecherischer Politik zurück. Es entsprach der Verteidigungslüge, die Verwicklung von OKW und OKH in die NS-Verbrechen insbesondere im Osten zu leugnen und die von Halder maßgeblich mitgeplante Aggression gegen die UdSSR als angeblich „militärische Notwendigkeit“ im Abwehrkrieg gegen den Bolschewismus zu bezeichnen. Die Nürnberger Prozesse waren für Halder dann auch „keine Stätte des Rechts, sondern der Politik“11.
Das gegen ihn im September 1948 in München im Rahmen der allgemeinen „Entnazifizierung“ in Deutschland durchgeführte Spruchkammerverfahren fand in der deutschen Presse große Beachtung und unter stärkster Anteilnahme der Öffentlichkeit statt.12 Das Ergebnis, ihn als „nicht belastet“ einzustufen,13 wurde überwiegend begrüßt. Nur wenigen blieb unverständlich, daß sich ausgerechnet Halder, der beim Zustandekommen der „verbrecherischen Befehle“ beteiligt war, als uninformiert über das Wüten der SD-Einsatzgruppen hinter der Ostfront 1941/42 bezeichnete. Zudem konnte in seinem wieder aufgetauchten privaten Kriegstagebuch,14 das alsbald zur herausragenden Quelle für die Erforschung des Zweiten Weltkrieges bis 1942 wurde, sein Anteil an Mitarbeit, Mitschuld und Verstrickung bei den völkerrechtswidrigen Befehlen Hitlers überprüft werden.
In dieser prekären Situation kam es Halder zugute, daß er seit Sommer 1946 für die Historische Abteilung der US-Armee als Leiter einer umfangreichen Forschungsgruppe von teilweise mehr als 150 deutschen Offizieren kriegswissenschaftliche Studien über den Verlauf des Zweiten Weltkrieges erstellte. In dieser Funktion setzte der frühere Generalstabschef alles daran, den Alliierten das fachliche Können der deutschen Generalstabsoffiziere und deren ‘saubere’ Denkweise in der Tradition von Clausewitz, Moltke, Schlieffen und Ludendorff ebenso wie die besondere „Kunst der deutschen Truppen- und Operationsführung“ zu beweisen.15 Heeresführung und Generalstabsdienst wurden dabei als von Hitlers verbrecherischer Politik mißbrauchte Institutionen hingestellt. Letztlich hatte er damit Erfolg, so daß eine Revision gegen den Freispruch beim eigenen Entnazifizierungsverfahren verhindert werden konnte. Die US-Regierung unter Präsident Kennedy würdigte sogar im November 1961 den Abschluß der kriegsgeschichtlichen Studien unter Halder als Leiter der Control Group der „Historical Division“ und die langjährige, loyale Zusammenarbeit mit der Verleihung des „Meritorious Civilian Service Award“.
Halder erlangte dadurch in den fünfziger und sechziger Jahren als Doyen der deutschen Kriegsgeschichtsschreibung über den Zweiten Weltkrieg großen Einfluß. Vor dem Hintergrund der erlangten Anerkennung durch den ehemaligen Gegner hatte Halder für Vorwürfe wegen der NS-Verbrechen wenig Verständnis. Er sprach jüngeren Wissenschaftlern und Historikern die Fähigkeit ab, die schwierige Situation in der NS-Zeit erfassen zu können, die sowohl zur Opposition, zum Konflikt als auch in die Verstrickung mit Hitlers verbrecherischen Befehlen und dessen grausamer Politik führen konnte. Gleichwohl kritisierte er sehr deutlich die bekanntgewordenen Verbrechen, die in deutschem Namen und unter Verantwortung der Wehrmacht erfolgt waren. Er unterließ es aber, ein öffentliches Schuldbekenntnis abzugeben oder etwa im Rahmen der Niederschrift von Memoiren das Eingeständnis persönlicher oder institutioneller Verstrickung und Mitschuld zu erklären. So hinterließ er keine Erinnerungen, als er am 2. April 1972 in Aschau/Bayern im 88. Lebensjahr starb. Die Trauerfeier fand mit militärischen Ehren durch die Bundeswehr statt.
Bei aller Anerkennung seiner persönlichen Leistung als Stratege der militärischen Operationen fällt heute das Urteil über Generaloberst Halder erheblich kritischer aus als in den ersten Jahren nach dem Ende des Dritten Reiches. Denn im Spannungsverhältnis zwischen Widerstand und Resignation auf der einen Seite und Anpassung sowie Mitwirkung auf der anderen Seite ist Halder in hohem Maße mitverantwortlich, daß der Soldat an der Front „Zubringerdienste für Henkersknechte“ leisten mußte,16 die nicht selten im Einzelfall zu schweren Gewissenskonflikten der Soldaten und Offiziere führten. Im vertraulichen Gespräch bekannte Halder allerdings, daß es falsch war, sich von Hitlers militärpolitischen Zielen „einfangen zu lassen“17 und daß auch er „auf diesem Gebiet schwere Fehler gemacht“ habe.18 Moralische und kriminelle Schuld beim verbrecherischen Wüten der Nationalsozialisten wies er für sich persönlich jedoch zurück. Er wich damit bis zu seinem Tod der Beantwortung der für die Kriegsgeneration so überaus wichtigen Frage nach der Verantwortung und dem Versagen der militärischen Funktionselite im Dritten Reich aus, so daß sein Bild trotz militärischer und menschlicher Qualitäten und Leistungen von großer Zwiespältigkeit geprägt bleibt.