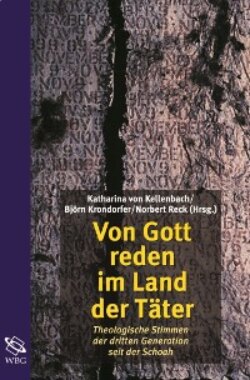Читать книгу Von Gott reden im Land der Täter - Группа авторов - Страница 9
Die Erfahrung des Bruchs in der zweiten und dritten Generation
ОглавлениеWenn wir uns heute als Theologinnen und Ex-Theologen der dritten Generation den uns vorangegangenen Werken der „Theologie nach Auschwitz“ annähern, so geschieht das auch mit Dankbarkeit, aus der heraus sich unsere kritischen Anfragen entwickeln. Zwar sind wir, die in den 60er und 70er Jahren Geborenen, mit unterschiedlicher Intensität der „Theologie nach Auschwitz“ begegnet – u.a. deshalb, weil sie in Deutschland immer eine Randexistenz geführt hat und sich nur schwer gegen den traditionellen Theologiebetrieb Gehör verschaffen konnte –, dennoch müssten wir ohne sie heute erst einmal das leisten, was Theologen der „zweiten Generation“2 geschafft haben: das Bewusstsein in Deutschland für die jüdischen Opfer der Shoah zu sensibilisieren.
Mit dieser Sensibilisierung widersetzte sich die zweite Generation dem mehrheitlichen Diskurs über den Nationalsozialismus in der bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft. Das Verhalten in dem vom Krieg zerstör-ten und im Wiederaufbau begriffenen Deutschland war nicht nur durch die von Mitscherlich beobachtete und seither viel beschworene Mentalität „der Unfähigkeit zu trauern“ geprägt, sondern auch von einem Diskurs, der darauf abzielte, die Deutschen als ein „leidendes“ Volk zu begreifen, das zum Opfer des Hitler-Faschismus geworden war. Die Deutschen waren sehr wohl fähig zu trauern, folgert der amerikanische Historiker Robert Moeller in seinen neuen Forschungen (1996; 2002): Allerdings nicht um die Opfer der NS-Verfolgungen und der Konzentrationslager, sondern um die deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen, ausgebombten Zivilisten und Kriegsgefangenen. Mit Mitgefühl und Selbstmitleid wurde, auch kirchlicherseits, des Schicksals der deutschen Bevölkerung gedacht. Dies schloss die NS-Verbrecher mit ein, die im kirchlichen und politischen Sprachgebrauch verharmlosend Kriegsverbrecher oder gar „Kriegsverurteilte“ genannt wurden.3 Noch 1986 war ein EKD-Beauftragter für die Seelsorge an deutschen Kriegsverurteilten tätig, aber es gab keinen vergleichbaren Beauftragten für die NS-Verfolgten (Klee 1992, 139–151; 1994, 135). Bis weit in die 60er Jahre hinein gab es kaum ein kritisches Bewusstsein dafür, es könne problematisch sein, die Deutschen als Opfer des Krieges darzustellen, während das Mitgefühl für die Opfer der Shoah und der NS-Verfolgungen unterentwickelt blieb.
Als in den 70er Jahren erste Beiträge zu einer „Theologie nach Auschwitz“ veröffentlicht wurden, sprachen sie in eben diese Situation der „kulturellen Amnesie“ (Metz 1997a, 149) hinein, die sich auch im traditionellen Theologiebetrieb widerspiegelte. Metz spricht vom „augenfälligen Apathiegehalt“ der christlichen Theologie und ihrer „erstaunlichen Verblüffungsfestigkeit angesichts der Shoah.“ „Warum“, fragt er, „sieht und hört man der Theologie diese Katastrophe – wie überhaupt die Leidensgeschichte der Menschen – so wenig oder überhaupt nicht an?“ (1997a, 149) Indem die „Theologie nach Auschwitz“ die Wurzeln des Antisemitismus kritisch beleuchtete und das Leiden (vgl. Solle 1973) in den Vordergrund ihres theologischen Suchens rückte, solidarisierte sie sich mit den Opfern und suchte nach neuen Verknüpfungspunkten zum zeitgenössischen Judentum. Sie versuchte, die Sprache des (Selbst-)Mitleids – und damit die emotionale Selbstbezogenheit der Tätergesellschaft – zu durchbrechen, und setzte dieser eine Theologie des Mit-Leidens mit den „Anderen“ entgegen.
Rückblickend fragt sich, warum diese Sensibilisierung nicht früher stattgefunden hat. Es verstrichen mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Nationalsozialismus, bevor sich ein neues theologisches Bewusstsein, und dies gegen den Widerstand etablierter Theologie, durchsetzen wollte. „Erst spät, sehr spät wurden wir uns in der Nachkriegsgeneration der veränderten Situation der Theologie ‚nach Auschwitz‘ bewußt, und es sind bis heute auch nur wenige, sehr wenige in der evangelischen und der katholischen Tradition, die in Deutschland nach Umkehr suchen“, resümiert Moltmann (1997a, 52). Ganz ähnlich drückt es Metz aus: „Ich gehöre zu jener Generation von Deutschen, die langsam – viel zu langsam – lernten, sich als eine Generation ‚nach Auschwitz‘ zu begreifen, und ich suchte dem in meiner Art des Theologietreibens nach Kräften Rechnung zu tragen.“ (Metz 1997a, 149)
Diese rückblickenden Zitate sind in zweierlei Hinsicht aufschlussreich. Zum einen erkennen Metz und Moltmann, stellvertretend für ihre Generation, wie lange sie an einem gesellschaftlichen und theologischen Denken teilgenommen haben, das ihnen den Blick auf die Shoah versperrte. „Wir haben [in Deutschland] mit dem jüdisch-christlichen Dialog auf den Kirchentagen angefangen und die Holocaust-Konferenzen, auf denen die Opfer sprechen, den Amerikanern überlassen“, schreibt Moltmann (1997a, 53). Zum anderen wird deutlich, wie stark diese beiden Theologen eine gemeinsame, generationsspezifische Erfahrung teilen. Als Teil der sog. Hitlerjugendgeneration erlebten sie die letzten Kriegsmonate in Wehrmachtsuniform. Ihre Generation ist sich des Bruchs, die der Nationalsozialismus und Holocaust ins Weltverständnis gerissen haben, erst langsam bewusst geworden.
Für die folgenden Generationen ist diese Situation nicht mehr gegeben. Norbert Reck hat den Unterschied wie folgt formuliert: „In der dritten Generation ist der Bruch, der in der zweiten Generation erst allmählich deutlich wurde, angekommen, endgültig manifest geworden! … Und dementsprechend sehe ich es als Auftrag für meine Generation, den Bruch zu thematisieren, zu untersuchen – jedenfalls nicht davor zurückzuweichen. Die Tradition ist zerbrochen, zerstört.“ (Reck 2000) Als dritte Generation müssen wir, um uns zukunftsorientiert den traumatischen Erinnerungen der Jahre 1933–45 stellen zu können, noch einmal anders ansetzen. Dazu gehört auch, die Unterschiede, die in generationsspezifischen Erfahrungen begründet liegen, zu reflektieren, und zu lernen, die eigene (theologische) Rede kontextuell sowie familien- und autobiographisch zu verorten.
Als dritte Generation haben wir den Vorteil einer größeren zeitlichen und daher emotionalen Distanz zum Geschehen selbst, welches Metz, Moltmann oder Solle noch am eigenen Leib erfahren haben. Und wir können auf ihren gedanklichen und theologischen Vorarbeiten aufbauen. Andererseits kennen wir als dritte Generation, wie Reck es ausdrückt, kein „Vorher“ vor dem Bruch: „Ein unbeschwertes religiöses Leben ist mir nicht mehr vorstellbar.“ (Reck 2000) Diesen Bruch so zu erleben, dass von der Theologie wenig oder nichts mehr Sinnstiftendes erwartet werden kann, ist Vertretern der zweiten Generation eher fremd. Sie sind sich m.E. zwar des Problems einer sinnstiftenden Vereinnahmung der Shoah durch christliche Theologie bewusst (vgl. Metz 1997a, 149), haben aber dennoch dogmatische und systematische Entwürfe (z.B. Marquardt und Moltmann) und neue Theologien (z.B. Solle und Metz) vorgelegt, die weiterhin an einer hoffenden, heilenden oder erlösenden Botschaft des Christentums festhalten.
Für einige in der dritten Generation ist diese Tradition so fraglich geworden, dass sie uns als unrettbar gegenübertritt. Es wäre sicher nicht richtig, dieses grundsätzliche In-Frage-Stellen allein als Reaktion auf die Shoah zu beziehen. Dies käme einer Reduzierung komplexer kultureller Vorgänge gleich, die unsere „Wahrnehmungen und die daraus entstehenden Haltungen und Handlungen“ (Budde 1997, 144) beeinflusst haben. Der Verlust einer unbeschwerten Religiosität ist die Konsequenz auch anderer gesellschaftlicher Veränderungen, mit denen die beiden großen Kirchen in Deutschland nur schwer Schritt halten. Umgekehrt dürfen die lang anhaltenden Folgen der Shoah nicht unterschätzt oder als Überbewertung einer kleinen Gruppe von Erinnerungsbedürftigen und Gedenkanimateuren abgetan werden. Zahlreiche Studien aus dem nicht-theologischen Bereich belegen, wie sehr diese Vergangenheit in den nachfolgenden Generationen nachwirkt und sich in Familien, Medien, Literatur oder Politik widerspiegelt (vgl. z.B. Rosenthal 1997; Staffa 1998; Müller-Hohagen 1988; Krondorfer 1995 und 1998; Huhnke 2002).
Der vorliegende Band Von Gott reden im Land der Täter handelt u.a. auch von den transgenerationellen Folgen dieses Bruchs und zeigt, inwieweit diese in theologischen Fragestellungen und dem biographischen Werdegang der dritten Generation aufdeckbar sind. Unsere Entfremdungen können sich unterschiedlich ausdrücken. Einige der Autorinnen überdenken radikal, also von der Wurzel her, ihre religiösen Traditionen oder suchen nach einer neuen, teils idiosynkratischen Religiosität. Andere haben die Theologie verlassen, bleiben aber im weitesten Sinne an theologischen Fragen interessiert. Wiederum andere sind aus Deutschland emigriert, beschäftigen sich jedoch mit Problemen deutscher Geschichte und Identität. Vereinzelt haben sie sogar Kirche und Christentum ganz hinter sich gelassen: Sie begreifen sich als „post-konfessionell“ oder sind zum Judentum übergetreten.