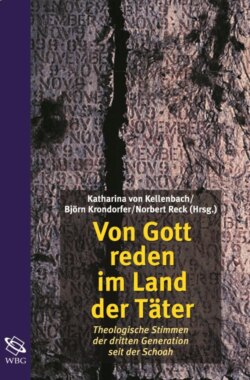Читать книгу Von Gott reden im Land der Täter - Группа авторов - Страница 19
Die Amnestie
ОглавлениеDie meisten der auf 100.000 bis 300.000 geschätzten NS-TäterInnen1, d.h. jener Personen, welche die verschiedenen Mordprogramme der Nationalsozialisten aktiv planten und ausführten, gingen straffrei aus. Nach dem ersten Nürnberger Prozess gegen 24 hohe Politiker und Funktionäre der NSDAP vom 20.11.1945 bis 1.10.1946 „kam es zu Nachfolgeprozessen gemäß Kontrollratsgesetz Nr. 10, die die vier Alliierten in ihren jeweiligen Besatzungszonen durchführten“ (Bassiouni 1995, 15). Die amerikanischen Behörden führten zwischen 1946 und 1949 zwölf weitere Verfahren gegen 177 „Hauptkriegsverbrecher“, darunter Mediziner, Juristen, Industrielle (Flick, I.G. Farben, Dresdner Bank, Krupp), Mitglieder der Einsatzgruppen, des SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes (Pohl), des SS Rasse- und Sicherheitshauptamtes und der Wehrmacht (Oberkommando) im Nürnberger Justizpalast durch. „Weitere 256 Prozesse mit ca. 800 Angeklagten fanden vor US-Militärgerichten in Dachau statt … Die Gesamtzahl der in den westlichen Besatzungszonen von Militärgerichten einschließlich Nürnberg Verurteilten beläuft sich auf 5025, die Todesstrafe wurde gegen 806 Angeklagte verhängt, aber nur bei 486 Verurteilten vollstreckt.“ (Boberach 1997, 592–593)
Die unterschiedlichen Strafpraktiken in den verschiedenen Besatzungszonen und Ländern können hier nicht ausführlich beschrieben werden. Soviel lässt sich aber in Kürze sagen: Die amerikanischen Militärbehörden fühlten sich der Strafverfolgung und Entnazifizierung am stärksten verpflichtet, urteilten am härtesten und sprachen auch die meisten Todesurteile aus (Henkys 1965, 189).2 Die deutsche Kritik entzündete sich gerade deshalb an ihrer Strafpraxis. Aufgrund des stetig wachsenden, insbesondere kirchlichen Widerstandes und im Zuge des Kalten Krieges ließ dann die amerikanische Entschlossenheit nach (Bower 1981): Die letzten fünf Todesurteile wurden am 7. Juni 1951 im War Criminal Prison Landsberg vollstreckt, alle weiteren Todesurteile wurden in Haftstrafen verwandelt. 1951 amnestierte der American High Commissioner McCloy alle Verurteilten, deren Haftstrafen weniger als 15 Jahre betrugen (insgesamt 31 wurden entlassen), außerdem reduzierte er 15 lebenslängliche Urteile auf 10–15 Jahre. Im Jahre 1958 – also zehn Jahre nach der Urteilsverkündung in Nürnberg – wurden die letzten Verurteilten aus Landsberg entlassen (de Mildt 1996, 21; Klee 1992, 144). Nur noch eine Handvoll prominenter Gefangener verblieb im alliierten Spandauer Gefängnis (Speer 1975).
Die bundesrepublikanische Justiz tat sich ebenfalls schwer bei der Verurteilung von NS-Straftätern.3 Zwar gab es eine große Zahl staatsanwaltschaftlicher Vorermittlungen, aber nur eine geringe Verurteilungsquote. Nach einer Statistik des westdeutschen Justizministeriums aus dem Jahre 1986 eröffneten deutsche Staatsanwälte 90921 Vorermittlungen gegen NS-Täter zwischen 1945 und 1986. Nur ein Bruchteil dieser Ermittlungen führte zu Gerichtsprozessen. Insgesamt wurden von bundesdeutschen Gerichten 6479 Angeklagte verurteilt (Rückerl 1980, 367). Diese geringe Anzahl ordentlicher Verurteilungen schrumpft noch weiter zusammen, wenn man sich auf Mordverfahren beschränkt und die Verfahren wegen Denunziation, Raub und Körperverletzung ausnimmt. Lediglich 912 Gerichtsverfahren befassten sich mit Mordvergehen unter nationalsozialistischer Herrschaft und betrafen insgesamt 1875 Angeklagte. Von diesen 1875 Angeklagten erhielten 150 lebenslange Haftstrafen, 842 wurden zu kurzen Gefängnisstrafen verurteilt und weitere 1117 Angeklagte wurden aus verfahrenstechnischen oder gesundheitlichen Gründen freigesprochen oder von der Verfolgung ausgenommen. Selbst wenn man de Mildts niedrige Gesamtzahl von 100.000 TäterInnen zur Ausgangsbasis macht, ergibt sich ein beschämend geringer Strafvollzug. Man kann mit Recht mit Jörg Friedrich von einer Kalten Amnestie (1986) der NS-Täter sprechen.
Die meisten Personen dieses Täterkreises gehörten vor, während oder nach dem Dritten Reich der evangelischen oder katholischen Kirche an. Die übergroße Mehrheit von NS-Tätern war christlich sozialisiert, bevor sie sich der nationalsozialistischen Bewegung anschlössen. Schließlich musste jeder Arierpass und erweiterte SS-Ahnenpass mit Taufscheinen bzw. der Mitgliedschaft in einer der beiden Volkskirchen nachgewiesen werden. Während viele SS-Männer aus den Kirchen austraten und „gottgläubig“ als Konfession angaben, gab es auch unter strammen Nazis einige, die Kirchenmitglieder blieben (vgl. Pohl 1950, 30). Zudem waren nicht alle Beteiligten an NS-Morden überzeugte Nationalsozialisten. Manche töteten ohne Partei- oder SS-Mitgliedschaft, manche verstanden sich als Christen. Spätestens nach der militärischen Niederlage Nazideutschlands traten einige namhafte und viele namenlose NS-TäterInnen wieder in die Kirchen ein und verbanden kirchlichen Glauben und Praxis mit einer mordbehafteten Vergangenheit. Die Wiederaufnahme und seelsorgerische Betreuung dieses Personenkreises, aber auch die grundsätzliche Verflochtenheit deutscher Kirchen mit diesen Menschen blieb bisher unreflektiert.