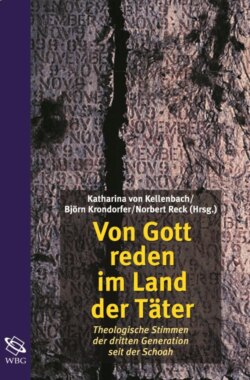Читать книгу Von Gott reden im Land der Täter - Группа авторов - Страница 23
In den Worten der Täter: Wer wirft jetzt den ersten Stein?
ОглавлениеDie Nachkriegsmemoiren hoher NS-Täter demonstrieren, dass die neutestamentlichen Warnungen vor dem Richten als Verdrängungsmechanismus eingesetzt wurden. NS-Funktionäre und ihre Sympathisanten zitieren biblische Verse, um sich den rechtlichen wie sozialen Konsequenzen ihrer Taten zu entziehen. So endet zum Beispiel das 1980 geschriebene Verlagsvorwort zu Adolf Eichmanns Aufzeichnungen, die er vor seiner Verhaftung durch israelische Agenten geschrieben hatte, mit dem folgenden Satz: „Wer wirft jetzt den ersten Stein?“ (Aschenauer 1980, 15) Die Geschichte der Ehebrecherin aus dem Johannesevangelium suggeriert Schuldbefangenheit: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.“ (Joh 8,7) Sollen sich noch in den achtziger Jahren die LeserInnen mit Eichmann identifizieren und die Versuchung zum Völkermord (analog zum Ehebruch) eingestehen? Wo alle Sünder/Täter sind, kann niemand den ersten Stein werfen. Die Solidarität der Sünde führt zur moralischen Lähmung, die eine differenzierte Aufarbeitung von persönlicher, politischer und rechtlicher Schuld nicht zulassen will.
Auch Hans Frank, der für seine Tätigkeit als Reichsminister und Generalgouverneur Polens vom Nürnberger Tribunal verurteilt und am 16.10.1946 gehängt wurde, klagt die christliche Vergebungsbotschaft ein: „Sind nicht das Rachebedürfnis und der Feindeshaß untilgbare Triebe der irdischen Natur, über die hinweg die strahlende Stimme klingt: ‚Ich sage dir, du sollst verzeihen deinem Feinde nicht sieben-, sondern siebenmal siebzig mal‘?! Aber wer hört von den Mächtigen der Erde diese Stimme Christi?!“ (Frank 1954, 425) Wie die kirchlichen Autoren der Denkschrift sieht er das Nürnberger Gericht als Ausdruck von Rache und Feindeshass, nicht von Gerechtigkeit. Dem Arm der Justiz stellt er die christliche Feindesliebe und Vergebungsbereitschaft gegenüber, deren Langmut und Unerschöpflichkeit er für sich selbst Im Angesicht des Galgens (1954) reklamiert. Allerdings gibt auch Hans Frank keine persönliche Schuld zu, sondern ist nur bereit, sich zur Solidarität der Schuld zu bekennen. Er bietet sich als Sündenbock an, der exemplarisch die Sühne für Deutschlands kollektive Schuld übernehmen will. Der getreue Anhänger Adolf Hitlers aus den frühen „Kampfzeiten“ und spätere Generalgouverneur Polens sieht sich selbst als „ein isolierter, machtloser Mann … [der] keinen Einfluss auf die Geschehnisse hatte … Ich behaupte und erkläre, daß ich nie in meinem Leben einen Mord begangen habe, daß die Tötungen aller Art in unmittelbarer … Befehlsbezogenheit Hitler-Himmler … geschehen sind.“ (404) Trotz seiner hohen politischen Position beschreibt er sich als „Nichteingeweihter“, der nichts von der „Judenvertilgung“ gewusst und „völlig hilflos gegen dies alles“ gewesen sein will (393–394). Trotz seiner persönlichen Unschuld sehe er es als seine „Pflicht“, „an Hitlers Stelle die Schuld“ (393) freiwillig auf sich zu nehmen.
Nun bleibt mir als Mitkämpfer des Führers nur eines: nun, da er in entsetzlichem Schuldbewußtsein sein Testament geschrieben hatte, beging er Selbstmord und entfloh vor der irdischen Gerechtigkeit. So trat ich in Nürnberg an seiner Statt vor die Richter und sagte, daß ich die Schuld bekenne. (Frank 1954, 392)
Frank akzeptiert seinen Tod nicht als Strafe für seine eigenen, individuell zu verantwortenden Taten, sondern als stellvertretenden Sühnetod. Wie Adolf Eichmann15 sieht er seine Schuld nicht individuell, sondern kollektiv und stellvertretend für Adolf Hitler (oder Himmler, Heydrich und andere Personen der NS-Hierarchie, die jeweils nicht greifbar waren). Diesen Gedanken bringt Frank am Ende seines Buches zum krönenden Abschluss:
Das Deutschland aber, das Hitler hinterließ, erlebt jetzt seine schwerste Passion. Es wird verhöhnt, gegeißelt und ans Kreuz geschlagen. Das Reich ist begraben. Und da auch ich meinen Weg mit Hitler bedenke, neige ich mein Haupt in Schuld. Nichts bleibt mir als das Gebet zu Gott für mein Volk und Land und meine Buße als Beitrag zur Sühne. Und in Ewigkeit diene ich dir, Vaterland … denn ich habe dich geliebt über alles in der Welt. (Frank 1954, 431)
Hier wird Christi stellvertretender Sühnetod auf die Leiden des nationalsozialistisch personifizierten Deutschlands übertragen. Für Frank wird das unschuldige Deutschland (von den alliierten Siegermächten) gezwungen, die Schuld Hitlers stellvertretend zu übernehmen und in einer grausamen Passion am Kreuz zu sühnen. Die Erniedrigung und Qual des unschuldig leidenden Opferlammes, dessen stellvertretendes Leiden Versöhnung und Erlösung erwirkt, wird hier auf die selbstverursachte Not im kriegszerstörten Deutschland projiziert. Dabei sieht Frank sicherlich nicht nur Deutschland in der Rolle des leidenden Gottessohns verkörpert, sondern auch sich selbst. Trotz seines „mannhaften“ Versuchs, die Schuld und Strafe anstelle Hitlers tapfer zu akzeptieren, bricht sein Selbstmitleid an vielen Stellen seiner Memoiren durch. Zu gerne würde er die eigene Person in der Rolle des zum Tode verurteilten Messias darstellen. In dieser nationalsozialistischen Reinterpretation des christlichen Glaubensbekenntnisses wird zwar die Auferstehung nicht explizit ausgesprochen, sie schwingt aber mit: Deutschland wird „verhöhnt, gegeißelt und ans Kreuz geschlagen. Das Reich ist begraben“ und – so geht es im Glaubensbekenntnis weiter – am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten. Hans Frank fand im Gefängnis den Glauben an Jesus Christus wieder und ließ sich erneut in die altkatholische Kirche aufnehmen, aber seine erste und letzte Liebe galt dem deutschen Vaterland „in Ewigkeit“. Amen.