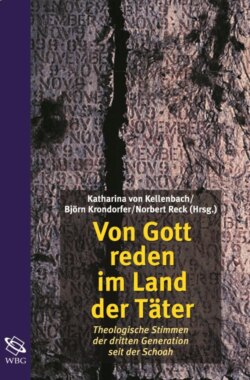Читать книгу Von Gott reden im Land der Täter - Группа авторов - Страница 6
Vorwort
ОглавлениеVon Gott reden im Land der Täter: Das ist Frage und Aussage in einem Atemzug. Es ist einerseits eine Tatsache: Nie ist das Reden von Gott in diesem Land verstummt, auch als Helmut Gollwitzer nach dem 9. November 1938 fragte: „Ist uns nicht allen der Mund gestopft an diesem Tage? Können wir heute noch etwas anderes als nur schweigen? Was hat nun uns und unserem Volk und unserer Kirche all das Predigen und Predigthören genützt, die ganzen Jahre und Jahrhunderte lang, als daß wir nun da angelangt sind, wo wir heute stehen …?“1 Und so ist andererseits alle Unbefangenheit und Selbstverständlichkeit des Redens von Gott dort zerbrochen, wo als Ortsbestimmung anzufügen ist: „im Land der Täter“.
Im Land der Täter: Könnte eine solche Bestimmung eine sinnvolle Konkretion und Antwort auf die Forderung sein, Theologie nicht im abstrakten Raum zu treiben, sondern kontextuell und situationsbezogen, politisch, in Geschichte und Gesellschaft? So jedenfalls lauteten auch die Ansprüche der Begründer und Begründerinnen der „Theologie nach Auschwitz“, wie sie seit etwa dreißig Jahren in Deutschland formuliert wurden. Inzwischen ist eine Generation von Theologinnen und Theologen nachgewachsen, die diese Impulse aufgegriffen, aber auch modifiziert und erweitert hat.
Das hat uns, die Herausgeber dieses Bandes, interessiert: Wie würde unsere, die neue Generation christlicher, nach-christlicher und jüdischer TheologInnen und KulturwissenschaftlerInnen ihre eigenen Perspektiven benennen? Wo sieht sie Unterschiede zu ihren Vorgängern? Welche Aufgaben sieht sie vor sich? Welche Auswirkungen haben ihre jeweiligen Erfahrungshorizonte auf die theologischen Standpunkte?
Es zeigte sich, dass die Bezeichnung dieses Landes als „Land der Täter“ in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle spielt – und zwar nicht im Sinne einer anachronistischen Fixierung, sondern als heuristische Kategorie für die Gegenwart: Sie lenkt den Blick auf gesellschaftliche und theologische Kontinuitäten, auf Diskurse der Schuldabwehr und der fortgesetzten Opferstilisierung. Sie impliziert eine Unzufriedenheit mit den allzu umstandslosen christlichen Solidaritätserklärungen für jüdische Opfer. Sie schaut auf die christliche Schuldgeschichte in der NS-Zeit und danach. Sie weckt ein Bewusstsein für die eigene Herkunft aus Opfer- oder Täterzu-sammenhängen und fragt, wie solche Zuschreibungen aufgebrochen werden können.
Mit der vorliegenden Sammlung Von Gott reden im Land der Täter stellt diese Generation ihre Reflexionen zu dem von ihr wahrgenommenen Spannungsfeld vor. Sie hat sich mit den Positionen der Vorgängergeneration auseinander gesetzt, aber sie teilt nicht mehr deren Erfahrungswelt. Das ist, bei aller Vielgestaltigkeit der einzelnen Arbeiten, die biographische Gemeinsamkeit der Autorinnen und Autoren in diesem Band: Sie kennen die NS-Zeit nicht aus eigenem Erleben und sind bereits mit dem Bewusstsein aufgewachsen, „nach dem Holocaust“ zu leben. Die gewählten Generationsbegriffe variieren von Beitrag zu Beitrag, manche sehen sich als zweite, andere eher als dritte Generation nach der Shoah – für uns alle dürfte jedoch gelten: Wir sind die Enkelinnen und Enkel der in der NS-Zeit Erwachsenen. Reden wir von Opfern und Tätern, so meinen wir die Generation unserer Großeltern.
Der Generationsbegriff erlaubt ein produktives Ineinander von Dankbarkeit und Eigenständigkeit: Wir knüpfen an das an, was die Vorgängergeneration in die Diskussion eingebracht hat, aber aus unserer eigenen Situation ergeben sich neue, andere Aufgaben. Das nimmt uns gleichzeitig in die Pflicht, unsere Warte so genau wie möglich zu benennen, damit sie für unsere Überlegungen kritisch fruchtbar wird. Nicht um individualistische Nabelschau zu betreiben, sondern um „das Persönliche als das Politische“ zu erkennen. Wer spricht? – das muss erkennbar bleiben, gegen den eingespielten Gestus einer raum- und zeitlos über den Dingen schwebenden Vernunft. Eine solche Selbstthematisierung wird bis heute im akademischen Raum in diesem Land mit Skepsis betrachtet, scheint uns aber dringend nötig, um Befangenheiten aufzudecken und Positionen gesellschaftlich zu verorten. Wir sind zuversichtlich, dass die Beiträge dieses Bandes eindrucksvoll zeigen, wie viel kritische Kraft aus der Reflexion des eigenen Standpunkts entstehen kann.
Wir Herausgeber haben die einzelnen Beiträge vier Themenbereichen zugeordnet, die helfen sollen, die Arbeitsfelder der Autorinnen und Autoren deutlich zu machen.
Im ersten Teil, Verortung: Perspektiven und blinde Flecken, wird nach der Positionierung theologischer Diskurse und den theologischen Spurendes Tätererbes gefahndet. Welche Rolle spielt der familienbiographische und kulturelle Kontext, um der Kontinuitäten der kirchlichen und theologischen Verstrickung mit der NS-Zeit gewahr zu werden? Welche Funktion hat eine objektivistische Sprache für theologische Täterschaft? Können kirchliche Schuldbekenntnisse und die theologische Rede von Vergebung dazu dienen, die Täter vor Strafmaßnahmen zu schützen? Geraten durch die thematische Einengung auf Fragen der Theodizee und des Leidens die Täter aus dem Blickfeld? Muss die Frage nach den christlichen Anteilen an den Taten des Holocaust nicht das christliche Weltverhältnis in der Neuzeit insgesamt betrachten?
Der zweite Teil, Das Eigene und die Anderen im jüdisch-christlichen Gespräch, versucht, das Verhältnis zwischen Juden und Christen aus der Sicht der nachgewachsenen Generation neu zu bestimmen. Welche Rolle spielen dabei die Pluralität jüdischer Identitäten, die politischen und religiösen Realitäten des Staates Israel, lateinamerikanische und feministische Befreiungstheologien, die im Rahmen des traditionellen jüdisch-christlichen Dialogs bisher kaum zur Sprache kommen?
Im dritten Teil, Von Zeugen und Zeugnissen, stellen sich die Autorinnen und Autoren hinsichtlich des Generationenwechsels der komplexen hermeneutischen Situation, die ihnen einen unkomplizierten Zugriff auf Geschichte, Erinnerung und Gedenken verweigert. Immer ist ihre Position als Nachgeborene mitzudenken, wenn sie Zeugen und Zeugnissen begegnen oder wenn sie sich in der diskursiven Polarität von Opfern und Tätern theologisch und kulturell verorten wollen. Wie kann das paradoxe Zeugnis der Überlebenden, die das Unsägliche sagbar, das Unvorstellbare vorstellbar machen wollten, verstanden werden? Wo stoßen wir als Nachgeborene an Grenzen der Sprache und Vorstellungskraft? Wie kann dann das Vermächtnis, das die Zeugen der Nachwelt weitergeben möchten, theologisch, hermeneutisch, ethisch und pädagogisch aufgenommen und umgesetzt werden, ohne zu verflachen und verfremdet zu werden?
Im letzten Teil werden Rituale und Orte der Erinnerung unter dem Blickwinkel der „Täter“ und „Opfer“ sowie ihrer Nachkommen analysiert. Lässt sich auf religiöse Traditionen zurückgreifen, um die generationelle Fortsetzung der Täter- und Opferrollenzuschreibungen zu unterbrechen? Welche Texte und Orte werden ritualisiert und für welche Zwecke? Wie kann der Erfahrung der Opfer angemessen gedacht werden, ohne sie für die eigenen zeitgenössischen Anliegen zu missbrauchen?
Dies sind, zusammengefasst, die Themen und Fragen, die die Autoren und Autorinnen aufwerfen und diskutieren. Für die Zuordnung zu den vier Themenbereichen sind allein die Herausgeber verantwortlich. Leserinnen und Leser, die nach bestimmten Schwerpunktfeldern Ausschau halten, wollen wir indes ermutigen, auch diejenigen Teile des Buches zur Kenntnis zu nehmen, die nicht unmittelbar ihrem Suchraster entsprechen.
Einzelne Beiträge verfechten mitunter gegensätzliche Positionen, manche Position wird von den Herausgebern nicht geteilt. Dies wollten wir nicht glätten, denn uns ging es nicht so sehr um inhaltliche Einmütigkeit, als vielmehr um die Bereitschaft, sich auf die Frage nach den eigenen generationellen und gesellschaftlichen Positionierungen einzulassen.
Wir möchten sehr herzlich allen Autoren und Autorinnen danken, die mit ihren Überlegungen und ihren Arbeiten dazu beigetragen haben, dass dieses Buch entstehen konnte. Alle haben ihre Beiträge speziell für dieses Buch verfasst und viel Zeit für die redaktionelle Bearbeitung der Texte aufgewandt. Wir wünschen uns, dass die kritischen Impulse ihrer Beiträge bei den Leserinnen und Lesern auf waches Interesse stoßen.
Katharina von Kellenbach dankt der Alexander von Humboldt Stiftung für ein Stipendium, das die Fertigstellung ihres Beitrags ermöglichte.
Björn Krondorfer möchte sich bei Prof. Rathenow für seine Gastfreundschaft an der Technischen Universität Berlin bedanken.
Dem Lektor der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Dr. Bruno Kern, danken wir herzlich für sein Engagement für dieses Projekt, seine Geduld und Unterstützung.
Martin Kick gilt unsere Dankbarkeit für seine rettende Hilfe beim Setzen der Texte dieses Buchs.
Katharina von Kellenbach
Björn Krondorfer
Norbert Reck
Berlin und München, im April 2001
1 H. Gollwitzer, Dennoch bleibe ich stets an dir … Predigten aus dem Kirchenkampf 1937–1940, Ausgewählte Werke, Bd. 1, München 1988, 52f.