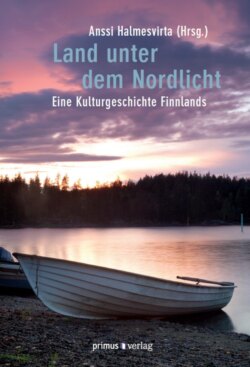Читать книгу Land unter dem Nordlicht - Группа авторов - Страница 20
Der finnische Synkretismus im Mittelalter
ОглавлениеDas Endergebnis des Christianisierungsprozesses in Finnland kann als synkretistisch charakterisiert werden, was bedeutet, dass die christlichen und vorchristlichen Kulturelemente teilweise miteinander verschmolzen oder aber nebeneinander weiterlebten. Wie bereits oben beschrieben, konnte der Synkretismus auf persönlicher Ebene oder je nach Region ganz verschiedene Gestalt annehmen. Natürlich ist der Synkretismus keine nur auf die finnische Kultur beschränkte Erscheinung, sondern trat auch sonst überall da auf, wo unterschiedliche Glaubenssysteme und damit verbundene kulturelle Merkmale aufeinandertrafen. Es ist auch zu bedenken, dass das altfinnische Heidentum nicht für eine rein finnische Kultur stand, sondern sich im Kontakt mit anderen Kulturen herausgebildet und verändert hatte. Dafür bietet die einheimische Benennung für den Teufel, Perkele, ein gutes Beispiel, war sie doch ursprünglich eine von den baltischen und slawischen Völkern entlehnte Bezeichnung für den Donnergott. Perkele ist in Finnland noch heute geläufig als Fluchwort. Offensichtlich war der Ausdruck unter den Altfinnen besonders populär oder gefürchtet, weil die Geistlichen namentlich diese Gottheit dämonisierten und nicht beispielsweise den anderen finnischen Donnergott Ukko.
Die Tatsache, dass der Perkele und andere von den Finnen angebetete Gottheiten und Naturkräfte als teuflisch abgestempelt wurden, bietet ein Beispiel dafür, wie sowohl die katholische als auch die orthodoxe Kirche die heidnischen Ansichten mit ihren eigenen Glaubenssystemen verbanden, statt sie als bar jeder Grundlage abzustreiten. Der Synkretismus prägte die Ausgestaltung des christlichen Glaubens schon seit der Zeit, da sich das Christentum über Finnland ausbreitete: Dies wird anschaulich im Fest der Geburt Christi, das bei Römern wie Germanen als Wintersonnenwende gefeiert wurde. Auch die Frühfinnen kannten das Mittwinterfest, das sie joulu nannten (vgl. schwed. jul, engl. Yule für „Weihnacht“). Im christianisierten Finnland gewann das Wort neue Bedeutung als Fest der Geburt Christi.
Die meisten finnischen Namen von christlichen Feiertagen sind aus der schwedischen Sprache oder über diese entlehnt, zum Beispiel ist helatorstai für Christi Himmelfahrt eine direkte Entlehnung aus helghathorsdagh. Die Bezeichnung pääsiäinen für Ostern geht dagegen nicht auf schwedisch pasker oder paskadagh zurück, da diese Wörter im Finnischen auf Fäkalien (finn. paska, Scheiße) hingewiesen hätten, was das Auferstehungsfest diffamiert hätte. Deshalb schufen die Missionare und frühen finnischsprachigen Geistlichen den Begriff pääsiäinen (zum Verb päästä, erreichen): Zu laskiainen (Fastnacht) setzt die 40 Tage andauernde Fastenzeit ein, deren Ende an Ostern erreicht ist. Auch die Bezeichnung für das Dreikönigsfest loppiainen (zu loppu, Ende) sagt schon als Wort aus, dass die Weihnachtszeit vorüber ist. Manchmal ging man in Finnland „christlicher“ vor als in den bereits christianisierten Ländern: Das Mittsommerfest benannte man nach Johannes dem Täufer juhannus, obwohl die Schweden sich auf midsommar festgelegt hatten, das freilich in Südwestfinnland auch in der Form mittumaari auftritt.
Die finnische Zeitrechnung orientierte sich in den christianisierten Teilen des Landes an dem Julianischen Kalender. Trotzdem blieben die Finnen bei ihren ursprünglichen Monatsnamen und verwendeten, anders als die meisten europäischen Völker, nicht dem antiken römischen Kalender entlehnte Bezeichnungen. Andererseits eigneten sie sich doch nach dem Gehör die germanischen Wochentagsnamen als solche an und verehrten beispielsweise weiterhin den Herrn des Donners, Thor, im Namen torstai (Donnerstag, vgl. schwed. torsdag, engl. thursday). Die Bezeichnung keskiviikko stellt wiederum eine direkte Lehnübersetzung des deutschen „Mittwoch“ dar, weshalb im Finnischen ein Bezug auf Odin fehlt, wie er im Schwedischen onsdag oder im Englischen Wednesday gegeben ist.
Das Wort für „heilig“, pyhä, brauchte man nicht zu entlehnen, es wurde aus dem frühfinnischen Wortschatz und den eigenen Glaubenstraditionen übernommen. Als nun christlicher Begriff verwies pyhä in konkreter wie geistiger Hinsicht auf mit göttlicher Kraft und göttlichem Ansehen ausgestattete Dinge, aber auch auf Feiertage (pyhäpäivä) und Heilige (pyhimys).
Katholische wie orthodoxe Kirche trugen das Ihre dazu bei, die Heiligenverehrung unter den Finnen zu verwurzeln. Nach Ansicht gelehrter Theologen waren Heilige Fürbitter, aber in volkstümlicher Auffassung ersetzten sie in vorchristlicher Zeit verehrte Gottheiten und Kräfte oder sie verschmolzen mit diesen. Auch in Finnland erwies man zahlreichen anderswo in Ansehen stehenden Heiligen seine Reverenz. Dass Heilige als potentere Vermittler zwischen Dies- und Jenseitigem begriffen wurden als gewöhnliche Menschen, hängt sicher auch damit zusammen, dass die Altfinnen des Glaubens waren, ihre Götter, Propheten, Zauberer und Heilkundigen seien ebenso wie heilige oder gefürchtete Plätze mit übernatürlichen Kräften versehen. Diese Kraft nannten sie väki. Heiligen vertraute man außer in großen Krisen auch im alltäglichen Leben: Der finnische Fischer konnte von den Aposteln Petrus und Andreas Angelglück erbitten, da beide Fischer waren. Auch die Frau konnte väekäs oder väkevä, also voller „Kräfte“, mithin auf übernatürliche Weise stark sein, was wiederum den Kult weiblicher Heiliger in Finnland förderte. Die Verehrung der Jungfrau Maria wie der heiligen Birgitta vermischen sich mit dem vorchristlichen Kult der Herrin des Waldes.
Das Leben und die Taten der Heiligen waren den Laien wenigstens teilweise bekannt, denn Priester und Dominikaner behandelten sie in ihren Predigten, und in den Wandmalereien, Skulpturen und Altären der Kirchen waren ebenfalls Heilige mit Ausschnitten ihres Lebensweges abgebildet. Viele Kunstwerke in finnischen Kirchen wurden aus dem Ausland beschafft. So wurde etwa der Sarkophag des heiligen Henrik, dessen Deck- und Seitenplatten mit Kupfergravierungen des ersten Kreuzzuges und seines Märtyrertods geschmückt sind, zu Anfang des 15. Jahrhunderts in Flandern bestellt. Damals wollte der Bischof von Turku, Magnus II. Tavast, dem Märtyrerheiligen seine Hochachtung bezeigen und schenkte den Sarkophag der Kirche von Nousiainen, aller Wahrscheinlichkeit nach, um die Wallfahrten zu dieser Kirche zu unterstützen.
In der Diözese Turku wurde zumeist der liturgische Kalender des Dominikanerordens befolgt, aber das Andenken einiger Heiliger beging man durchaus auch zu anderen Zeiten als im übrigen katholischen Europa. Unterschiede zeigen sich ebenfalls im Vergleich mit dem Heiligenkalender, der auf der Westseite des Bottnischen Meerbusens im Gebrauch war. Die jährlich wiederkehrenden Heiligenfeste und anderen kirchlichen Feiertage verschmolzen mit dem Jahresrhythmus der Laiengesellschaft. Aufgrund der kirchlichen Zeiteinteilung wusste man etwa, wann eine Pause in der Alltagsarbeit einzulegen war, wann es Zeit war, den Markt zu besuchen, wann Bedienstete eingestellt werden konnten, wann die Herde auf die Weide gebracht werden musste und wann man mit dem Heumachen anfangen sollte. Auf Basis des an einem Feiertag herrschenden Wetters wurden sogar die Wettervorhersagen auf Wochen und Monate hinaus erstellt. Häufig verstand oder interpretierte das Volk die Symbolik kirchlicher Kunstwerke und Predigttexte ganz anders, als sie von den Pfarrern gemeint war. Die heilige Jungfrau Margarethe war beispielsweise in vielen Kirchen mit einem dreizackigen Speer oder mit einem Kreuzstab in der Hand abgebildet, mit dem sie den Drachen erlegte. Da aber ihr Gedenktag in den heinäkuu („Heumonat“ Juli) fiel, in dem in Finnland die Heuernte einsetzte, worauf der finnische Monatsname noch immer hinweist, sah man im Attribut der Heiligen in der bäuerlichen Kultur schlicht und einfach eine Heugabel.
Nicht alle Heiligen erreichten die gleichgroße Gunst oder Bekanntheit, und gleichnamige Heilige konnten leicht miteinander verwechselt werden. Sowohl die katholischen als auch die orthodoxen Priester lehrten die Finnen, die Mutter Johannes’ des Täufers, Elisabeth, zu verehren, aber besonders im katholischen Europa kannte man auch spätere gleichnamige Frauenheilige. Die bekannteste war die jung verstorbene Gattin des ungarischen Königs Andreas II. und des Landgrafen von Thüringen, Ludwigs IV., die heilige Elisabeth (1207–1231), deren Gedenktag sich spätestens im 15. Jahrhundert als Teil des Heiligenkalenders der Diözese Turku festschrieb.
Die Popularität der Heiligen ist im Nachhinein schwer zu beurteilen, da anzunehmen ist, dass nicht annähernd alle Schenkungsurkunden erhalten geblieben sind. So wissen wir also nicht, wie häufig Schenkungen für einen bestimmten Heiligen getätigt wurden. Außerdem hat sich die Ausstattung der Kirchen im Laufe der Jahrhunderte stark verändert und die mittelalterlichen Kunstwerke sind nicht mehr alle erhalten. Da auch von der damaligen Literatur nur noch Reste vorhanden sind, weiß man nicht genau, welche Heiligen in Predigttexten und anderen geistlichen Schriften häufiger vorkamen. Wir besitzen also keine exakten Kenntnisse darüber, wie sehr ein bestimmter Heiliger das gemeine Volk im Mittelalter interessierte.
Dass die Heiligen für die mittelalterlichen Finnen durchaus Bedeutung hatten, ist zweifellos: In katholischen wie orthodoxen Gegenden begann man, den Kindern gemeineuropäische Namen zu geben, die häufig Heiligennamen oder Ableitungen von diesen waren. Altfinnische Personennamen wurden seltener, verschwanden aber nicht völlig. Mit dem christlichen und europäischen Personennamenfundus wurde die Benennungspraxis in Finnland noch mannigfaltiger: In Dokumenten wurde der Name einer Person in der Regel in schwedischer (im Osten in russischer) Form notiert, aber hin und wieder tauchen in Schriftzeugnissen auch die finnischen Pendants der gleichen Namen auf. So erschien ein Mann mit dem Rufnamen Heikki in schwedischsprachigen Urkunden in der Form Henrik, wurde aber zuweilen auch Heikki geschrieben, eine Praxis, die sich mancherorts bis ins 20. Jahrhundert fortsetzte. Entsprechend nannten die Orthodoxen denselben Mann zum Beispiel abwechselnd Jyrki, Jegor oder Georgij.
Der Heiligenkult blieb in gewisser Weise gleichwohl kulturelles Importgut im mittelalterlichen Finnland. Da sowohl im skandinavischen als auch im russischen Sprachraum auch aus der jeweiligen eigenen Sprach- und Kulturgruppe aufgestiegene Heilige verehrt wurden, hatten die Finnen lediglich zwei „eigene“ Heilige, den Märtyrerbischof Henrik und den 1366 verstorbenen Bischof Hemming von Turku. Beide waren hoch geachtete geistige Persönlichkeiten, jedoch keine gebürtigen Finnen: Henrik kam der Legende nach aus England, Hemming wiederum wurde in der Provinz Uppland in Schweden geboren und erreichte offiziell nur den Status eines Seligen (beatus), weil die Reformation den Prozess der Heiligsprechung unterbrach. Die orthodoxen Karelier verehrten mehrere fromme Männer und Frauen aus ihrer Mitte als heilig, zumeist Mönche und Nonnen. Der Erste war hier der Mönch Hermann, der Überlieferung zufolge einer der Gründer des Klosters Valamo.
Beim Kanonisierungsvorgang traten Finnen nur selten als Zeugen auf, was darauf hinweist, dass ihnen der Heiligenkult teilweise fremd blieb. Heilige begriff man vielleicht eher als vorchristliche, Gott ähnliche Helfer denn als vorbildliche Menschen, denen es nachzueifern galt. Auch die Reise an solche Orte, wo Pfaffen und Mönche Angaben zu den Wundertaten einer heiligzusprechenden Person sammelten, dürfte für viele unüberwindlich lang und beschwerlich gewesen sein. Am deutlichsten aber erklärt das Fehlen einheimischer Heiliger die Tatsache, dass die in Finnland ansässigen Adeligen – nur wenige Adelsgeschlechter aus frühfinnischen Zeiten, ansonsten mit den neuen Herrschern zugezogene fremdsprachige adelige Familien – der Zahl und dem Wohlstand nach eine wesentlich kleinere Gruppe waren als ihre gemeineuropäischen Standesbrüder und -schwestern. Die Kirche ihrerseits kanonisierte sehr oft eben Angehörige des Adels, die wenigstens der Form halber für die Kirche gekämpft hatten oder ihr Schenkungen hatten zukommen lassen. In Finnland blieb der Kreis solcher geeigneter Heiligenkandidaten von vornherein erheblich kleiner. Zudem wissen wir trotz all der Kirchengründungen und der fromme Wendungen enthaltenden Schenkungsurkunden letztlich nicht, inwieweit die Finnen im Mittelalter die christliche Kultur, besonders die offiziellen Lehrmeinungen, wirklich verinnerlichten. Obwohl die Kirche von Inkoo an der Südküste in ihrem Inneren von einem Fresko geschmückt war, das einen Danse macabre zeigte, wie er in der europäischen Kultur nach dem Schwarzen Tod bekannt war, und den lesekundigen Kreisen auch in Finnland die auf jenseitige Gedanken gerichtete Ars moriendi-Literatur zugänglich war, sollte doch auch die Verbreitung einer bloß oberflächlichen Sittenchristlichkeit nicht unterschätzt werden. Diese könnte genau genommen eine wichtige Rolle in einer Gesellschaft gespielt haben, die ihr Sein und Handeln offiziell auf Gottes Fügung gründete. Schenkungen an geistliche Institutionen und an die Armen dienten immer auch als Mittel, den eigenen Status zu betonen – es gehörte mithin zum guten Ton, dass ein wohlhabender Adliger oder Bürger spätestens auf seinem Totenbett der Kirche und der Armen gedachte. Angst vor Hölle und Fegefeuer mag einige vielleicht tatsächlich umgetrieben haben, den meisten aber reichte es wohl, den Zehnten und andere Zahlungen an die Geistlichkeit zu entrichten und die Kirche nur dann aufzusuchen, wenn es unumgänglich war.
Von den Dörfern und Einödhöfen im Binnenland konnte der Weg zur Kirche mitunter sehr weit sein, was unter anderem zur Anlegung von Übergangsfriedhöfen führte. Verstorbene wurden etwa im Sommer vorläufig begraben und im Winter dann mit dem Pferdeschlitten zur Kirche gebracht und nach der Einsegnung im eigentlichen Grab beerdigt. Manchmal blieben provisorische Gräber auch dauerhaft erhalten; die Toten erhielten also durchaus nicht immer ein regelgerechtes christliches Begräbnis. Häufig wurden die Übergangsgräber außerhalb der Besiedlung angelegt, am liebsten auf einer Insel, was auf Furcht vor den Toten und dem Jenseits schließen lässt. Um die Rückkehr des Verschiedenen zu verhindern oder auch zu seinem Gedenken entästeten die Finnen in der Nähe einige Bäume: Man glaubte, die Seelen der Verstorbenen kehrten wieder um, wenn sie dieses Zeichen zwischen dem Dorf und der Grabstätte sahen.
Die binnenfinnische halbchristliche Leicheninseltradition begann im Spätmittelalter, als sich die Besiedlung auf die Einödsgegenden ausweitete. Ein entsprechendes Phänomen begegnet auch im schwach besiedelten Binnenland Schwedens. Die Obrigkeit war sich dessen bewusst, dass besonders in Savo und Karelien die Bauern zum Teil so weit verstreut lebten, dass sie nur einige Male im Jahr zur Kirche gehen konnten, wenn überhaupt. Der Bischof von Turku, Laurens Suurpää, beklagte diese Situation zu Anfang des 16. Jahrhunderts auf der schwedischen Ratsversammlung und sprach gar von „Unwissenheit hinsichtlich des christlichen Glaubens“ und davon, dass man hier „wie Lappen und Heiden“ lebe. Der Staatsrat stimmte seinem Vorschlag zu, die weiträumigen Gemeinden im Inland in kleinere aufzuspalten, was den Kirchgang verkürzen würde. Der Brauch, Verstorbene auf Inseln zu beerdigen, hielt sich allerdings noch über Jahrhunderte.
Die Führung der orthodoxen Kirche bewegte die gleiche Sorge hinsichtlich der karelischen Bevölkerung in den Weiten Russlands. Erzbischof Makarij und sein Nachfolger Feodosij versuchten in den 1530er und 1540er Jahren, den etwa bei einem Fünftel der Bewohner von Vatja noch vorherrschenden Aberglauben auszurotten. Nach den von der Kirche gesammelten Informationen verehrte das Volk in abgelegenen Gegenden weiterhin Wälder, Steine, Flüsse, Moore, Quellen, Berge, Sonne und Mond, Sterne, Seen und vieles andere und brachten Tiere und sogar ihre Kinder als Opfer dar – die Erwähnung von Kinderopfern entsprang freilich wohl lediglich der Absicht der Priester, das Heidentum Kareliens zu betonen. Heidnischen Charakter besaßen in den Augen der Geistlichen auch die eigenen Grabstätten der Dörfer und der Brauch, die Hilfe von Sehern in Anspruch zu nehmen. Noch im 16. Jahrhundert war Karelien also Missionsgebiet.
Wenn die Kirchenoberen ihre Vorwürfe vielleicht auch in zugespitzter Form vorbrachten, ist im Lichte solcher Behauptungen und angesichts des Verzeichnisses der Abgötter bei Agricola doch offensichtlich, dass es der katholischen wie auch der orthodoxen Kirche noch am Beginn des 16. Jahrhunderts kaum gelungen war, ihre Lehre mehr als nur sehr oberflächlich zu verwurzeln, zumindest nicht im tiefen Binnenland. Möglicherweise lebten die heidnischen Glaubensvorstellungen und Praktiken sogar in der Nähe kirchlicher Zentren fort. Neuere archäologische Funde haben gezeigt, dass auch Dörfer in dichter besiedelten katholischen Gegenden ihre eigenen Begräbnisplätze beibehielten, zuweilen nur eine Stunde Fußweg entfernt von der Gemeindekirche und dem dortigen gemeinschaftlichen Kirchhof. Man hat das Vorhandensein dieser Dorffriedhöfe noch nicht hinreichend erklären können, aber sie belegen auf alle Fälle, wie die Volkskultur von den offiziellen Werten und Normen auch in angeblich vor Generationen bereits christianisierten Regionen abweichen konnte. Ähnliche Verhältnisse sind auch für die großen Städte des schwedischen Reichs bezeugt: In Stockholm wurden Ende des 15. Jahrhunderts wenigstens zwei Fälle der Verehrung Odins entdeckt.
Ebenfalls in Stockholm wurden Ende des 15. Jahrhunderts vor Gericht auch die Verbrechen eines finnischen Mannes namens Lasse aus Huittinen in der Provinz Satakunta verhandelt. Lasse war kreuz und quer durch Schweden gezogen und hatte Wertgegenstände aus vielen Kirchen gestohlen. Darunter befanden sich auch mit Blick auf die Christianisierung Schwedens und das Wallfahrtswesen bedeutende Kirchen. Er wurde als Kirchendieb am obersten Querbalken des Galgens gehängt. Lasse kann somit als Beispiel für einen Finnen am Ausgang des Mittelalters gelten, der, obschon in einem früh christianisierten Gebiet geboren, die heiligen Gegenstände in den Kirchen ganz pragmatisch sah als Mittel zur Verbesserung der eigenen Situation. Natürlich aber gab es neben ihm und anderen Normenbrechern unter den Finnen im Mittelalter auch bei den Laien ebenso gut solche, die die christliche Kultur intensiver verinnerlicht hatten.