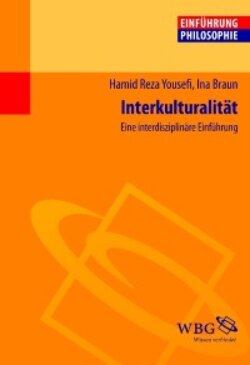Читать книгу Interkulturalität - Hamid Reza Yousefi - Страница 9
1.2.2. Totalitätsorientiertes Kulturkonzept
ОглавлениеTotalitäre Kulturtheorie
Eine Reihe von Wissenschaftlern, die die historisch-spezifische Lebensweise einer sozialen Gruppe im Vergleich zu anderen Gruppen in den Mittelpunkt stellen, vertritt ein totalitätsorientiertes Kulturkonzept.
Definition: Der totalitätsorientierte Kulturbegriff ist ein regionalisierendes und nationalisierendes Konzept, das die spezifische Lebensform eines Kollektivs in einer bestimmten historischen Epoche in den Vordergrund stellt und nach dem Kulturen wie Kugeln, die aufeinanderprallen und ohne Bezug zueinander sind, aufgefasst werden.
Unter Kultur wird hier die spezifische Lebensform eines Kollektivs bzw. die Totalität der kollektiven Lebensformen einer Nation oder einer Gemeinschaft verstanden. Hierbei wird von der grundsätzlichen Verschiedenartigkeit der Kulturen ausgegangen, wobei Kultur und Gesellschaft miteinander identifiziert werden.
Hierzu einige Beispiele:
Johann Gottfried Herder (1744–1803), Bronislaw Malinowski (1884–1942), Oswald Spengler (1880–1936) und Arnold Joseph Toynbee (1889–1975) gehören zu den prominenten Vertretern eines totalitätsorientierten Kulturkonzepts.
Herders geschlossener Kulturbegriff
In seinen „Briefen zur Beförderung der Humanität“ definiert Herder seinen Kulturbegriff und meint, Kultur gedeihe einzig „auf dem eigenen Boden der Nation, in ihrer ererbten und sich forterbenden Mundart“.11 Eine Mischung von Kulturen bedeutet für ihn Verlust an „Eindrang, Tiefe und Bestimmtheit“.12
Dabei betrachtet Herder die Kulturen als in sich abgeschlossene Sphären, gewissermaßen als einheitlich-unveränderbare Kugeln. Diese Sphären teilt er, in der Tradition normativer Kulturkonzepte, in „rohe“ und „andere“ Völker auf. Für ihn ist die Kultur eines Volkes „die Blüte seines Daseins, mit welcher es sich zwar angenehm, aber hinfällig offenbaret. Wie der Mensch, der auf die Welt kommt, nichts weiss – er muss, was er wissen will, lernen –, so lernt ein rohes Volk durch Übung für sich oder durch Umgang mit anderen. Nun aber hat jede Art der menschlichen Kenntnisse ihren eigenen Kreis, d.i. ihre Natur, Zeit, Stelle und Lebensperiode“.13
Kultur als homogenes Gefüge
Herder stützte sich mit seinen Urteilen, wie Kant, vorwiegend auf indirekte Reiseberichte Anderer. Ethnologen des 19. Jahrhunderts untersuchten traditionell Stammesgesellschaften oder außereuropäische, schriftlose Völker, die selbstredend als „rohe“ Völker galten, und betrachteten Kulturen im Geist von Herders totalitärer Kulturauffassung in der Regel als statische Gebilde und homogene Gefüge. Eine solche reine eigene oder eine reine andere Kultur existiert jedoch nur als Privatanthropologie, d.h. als ein privat erdachtes Menschenbild. Wir sprechen zwar über Kultur oder Kulturen, es geht dabei aber immer um Menschen als Träger unterschiedlicher Sinn- und Orientierungssysteme. Reckwitz zufolge ist das Interesse dieses Kulturverständnisses die „Totalität der kollektiv geteilten Lebensformen eines Volkes, einer Nation, einer Gemeinschaft“.14
Malinowskis ethnographischer Realismus
Malinowski steht mit seiner Auffassung, Kulturen seien Sphären, die an Nationen gebunden sind, in der Tradition Herders. Aufgrund verbesserter verkehrstechnischer Mittel und Wege bereiste er jedoch die Kulturgebiete, über die er berichtete, persönlich, und führte im Rahmen seines „ethnographischen Realismus“ die Praxis der „Feldforschung“ ein. Hier erschloss der Forscher die Lebenswelt des Anderen durch Erfahrung und Empathie erstmals unmittelbar.15
Für Malinowski ist Kultur „ein umfassendes Ganze[s]“.16 Er ist der Ansicht, dass der instrumentelle Apparat von Kultur – worunter er Wissens-, Moral- und Glaubenssysteme wie auch Erziehung und Wirtschaft versteht – entstanden sei, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen und Probleme zu lösen. Jeglichem menschlichen Handeln unterstellt er radikale Kulturabhängigkeit. Kulturen werden nach diesem Verständnis als Organismen, als geschlossene statische Kreise, aufgefasst.
Trotz der neuartigen Feldforschung erhebt Malinowski, wie seine Vorgänger, eigenkulturelle Erfahrungen zum Maßstab und vergleicht sie mit der Praxis der Anderen. Er macht das Andere ausschließlich zum Objekt seiner Forschung, ohne dieses zu Wort kommen zu lassen. Obwohl er nun sein Erleben aus „erster Hand“ berichtet, verharrt der Forscher in der Rolle einer Art des Vormundes des Anderen.
Kulturen als Organismen bei Spengler
Spengler betrachtet in seiner Theorie die Kulturen und ihre Beziehungen zueinander. Die „einzelnen Kulturen“ sind für ihn „Organismen“ und die „Weltgeschichte […] ihre Gesamtbiographie“.17 Er vertritt den in seiner Zeit entstehenden darwinistischen Kulturbegriff in Anlehnung an den Begriff des „Typus“ von Wilhelm Dilthey (1833–1911) und Max Weber (1864–1920), den er zur These der „totalen Andersartigkeit der Kulturen“ weiterentwickelt. Jede Kultur besitze eine „Seele“, die in ihrem Stil und ihrer Denkweise zum Ausdruck komme. Folglich entstünden Kulturen unabhängig voneinander und seien untereinander wesensfremd. Wie ein Mensch durchliefen sie mehrere Lebensstadien und am Ende stehe unweigerlich ihr Verfall und damit ihre Ablösung durch eine neue Kultur.
Weltgeschichte als Weltgericht
Die Weltgeschichte sieht Spengler als einen ewigen Kreislauf von Kulturen, die in Abfolge entstehen und vergehen. Der Mensch sei als Träger der Welt ein Glied der Geschichte, in der es „um das Leben und immer nur um das Leben, die Rasse, den Triumph des Willens zur Macht“ gehe, „und nicht um den Sieg von Wahrheiten, Erfindungen oder Geld. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht: sie hat immer dem stärksten, volleren, seiner selbst gewisseren Leben Recht gegeben, Recht nämlich auf das Dasein“.18
Spengler sieht den „westeuropäisch-amerikanischen Kulturraum“ seiner Zeit als den machtvollsten Raum an und will an diesem „das Schicksal einer Kultur, und zwar der einzigen, die heute auf diesem Planeten in Vollendung begriffen ist, […] in den noch nicht abgelaufenen Stadien […] verfolgen“.19 Auch die deutsche Kultur als Repräsentantin eines „Herrenvolkes“ sieht er berufen zur Macht. Mit diesem Konzept verschaffte Spengler den Kriegen und Kolonialisierungsabsichten seiner Zeit die Legitimation des Naturnotwendigen.
Toynbees rhythmischer Ablauf von Kulturen
Toynbee argumentiert mit einer anderen Intensität und Schwerpunktsetzung ähnlich. Er verfolgt das Ziel, eine philosophische Deutung der großen Entwicklungslinien der Menschheitsgeschichte herauszuarbeiten. Er analysiert Kulturbegegnungen, Bedingungen der Entstehung, des Aufstiegs und Verfalls von Kulturen und geht grundsätzlich von einer Interdependenz von Kulturen aus, die keinen Zweifel daran lässt, dass das „Verstehen“ der einen Kultur die fundierte Kenntnis der anderen zur Voraussetzung hat. Geschichte verläuft ihm zufolge im Wechsel dynamischer Zeiten und Phasen des „Beharrens“. Dabei widmet Toynbee, in Abkehr von einer euro- bzw. ethnozentrischen Geschichtsschreibung, außereuropäischen Kulturen ebenso viel Aufmerksamkeit wie der europäischen.20
Diese innovative innere Logik der universalgeschichtlichen Auffassung offenbart jedoch eine weitere Einseitigkeit: Sie ist ausschließlich christlich motiviert. Die Darstellung außereuropäischer Länder erfolgt aus dieser Perspektive, was häufig zu solchen Einseitigkeiten verleitet. Toynbee, wie auch Spengler, gehört zu den spekulativen Geschichtsphilosophen wie Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), die eine teleologische Totale in Form einer geschichtsdeterministischen Auffassung vertreten. Die Weltgeschichte besteht dieser Auffassung zufolge aus einem „rhythmisch geordneten Ablauf“.21
Kritik Schelers
Die Bewertung von Kulturen kann jedoch nicht aus einer „kontinuierlichen Bewegung“ mit einer a priori bestimmten Zielgerichtetheit aufgefasst werden. Max Scheler (1874–1928) bezeichnet solche Sichtweisen, bezogen auf Europa, als europäisch eingeengte Geschichtsauffassungen. Die weltgeschichtliche Struktur gleiche vielmehr – in einem noch immer totalitätsorientierten Verständnis – „einem Flusssystem, in dem eine große Anzahl von Flüssen Jahrhunderte ihren besonderen Lauf verfolgen, die sich aber, von unzähligen Nebenflüssen gespeist, schließlich in steigendem Neigungswinkel zueinander zu einem großen Strome zu vereinen streben“.22
Zusammenfassung
Der totalitätsorientierte Kulturbegriff definiert sich im Gegensatz zum normativen Kulturkonzept nicht mehr als eine für „jedermann“ erstrebenswerte Lebensform, sondern als mannigfaltige und spezifische Lebensformen verschiedener Kollektive an diversen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten. Totalitätsorientierte Kulturkonzepte sind problematisch, weil sie zu Kulturfundamentalismus und der Forderung nach der Reinheit einer Rasse verleiten können. Dass hier stufentheoretisch verfahren werden muss, ist eine Folge der inneren Logik des totalitären Orientierungssystems.
Ein totalitätsorientiertes Kulturverständnis unterliegt, wie das normative, einem Imperativ, weil Kultur als eine bestimmte unverwechselbare Lebensform betrachtet wird und mit anderen Kulturen in Konkurrenz tritt.
Übungsaufgaben:
1 Diskutieren Sie das totalitätsorientierte Kulturkonzept und analysieren Sie seine Vor- und Nachteile.
2 Besprechen Sie die Kulturtheorien von Herder, Malinowski, Spengler und Toynbee. Diskutieren Sie hierbei die Haltung Schelers.
3 Arbeiten Sie die zentralen Unterschiede heraus und belegen Sie sie mit jeweils einem Beispiel aus Ihrem sozialen Umfeld.
4 Beantworten Sie die Frage, ob und inwieweit Herders Kulturbegriff oder ähnliche Konzepte für die Begegnung von Menschen aus unterschiedlichen Kontexten förderlich sind.
5 Stellen Sie sich einmal vor, Sie wollen einen Dialog zwischen Menschen organisieren, die aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten stammen. Wie sieht der Dialog aus, wenn nicht alle Diskurspartner von einem totalitätsorientierten Kulturbegriff ausgehen?