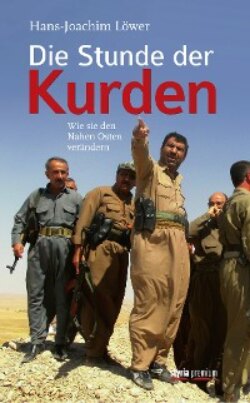Читать книгу Die Stunde der Kurden - Hans-Joachim Löwer - Страница 6
ОглавлениеKAPITEL 2
BARSAN
„Wir strecken die Hände aus“
Woher der Geist der Versöhnung weht
Noch einmal stehe ich vor einem Grab. Es liegt ganz unscheinbar, fast versteckt, an einem Hang des Berges Schirin. Seit gut deißig Jahren ruht hier der größte Sohn des Landes, der Übervater der Kurden. Wäre ein Stück dahinter nicht eine Gedenkstätte gebaut worden, so liefe man Gefahr, ganz achtlos an diesem Grab vorbeizugehen. Keine Tafel mit irgendeiner Inschrift. Keine Kerze, die feierlich flackert. Nur eine kleine, rechteckige Anhäufung von Erde. Nichts, absolut nichts verrät dem Besucher, wer dieser Tote ist. So wollte es Mustafa Barsani. Schlicht, wie er sein Leben führte, wollte er auch bestattet sein.
Zwei hochkant aufgestellte Steinplatten markieren die Lage des Toten, das ist islamischer Brauch. Sohn Idris, der nur acht Jahre später starb, wurde neben seinen Vater gebettet. Eine hüfthohe Steinmauer grenzt das sechs mal sechs Meter große Geviert ein, man kann sich mit den Händen auf sie stützen. Besucher stehen stumm und andächtig an diesem historischen Platz.
Ein Stück weiter unten liegen fast hundert Männer begraben, die an Barsanis Seite gekämpft haben. „Peschmerga“ nennen die Kurden bis heute all jene, die für die Freiheit ihres Volkes zu den Waffen greifen. Die Bezeichnung bedeutet auf Deutsch: „Die dem Tod ins Auge Sehenden.“ Wer seinen Einsatz mit dem Leben bezahlt, der gilt als „Märtyrer“. Das, aber wirklich nur das, haben sie mit den Islamisten gemein, die heute das Land der Kurden bedrohen.
Der Wind säuselt durch die Blätter der Bäume, die ein wenig Schutz vor der stechenden Sonne bieten. Sanft weht die Brise über die herrliche Landschaft, so als wolle sie alle Wunden streicheln, die sie in den vergangenen hundert Jahren erlitten hat.
Barsanis Erben kamen vor ein paar Jahren zu dem Entschluss, dass sie sich in einem einzigen Punkt über den letzten Willen ihres toten Helden hinwegsetzen müssten. Sein Grab durfte einfach nicht länger einfach so vor sich hin dümpeln. Sie ließen auf einer terrassierten Fläche ein mächtiges Halbrund aus Beton errichten – eine Art Kulturzentrum mit Museum und Veranstaltungsräumen.
Wieder suche ich, diesmal tief in den Bergen, nach den geistigen Wurzeln dieses Volkes. Woher kommt es, dass die irakischen Kurden so ganz anders „ticken“ als ihre Nachbarn? Warum glaubt heute jeder, der in ihr Land kommt, plötzlich in einer anderen Welt zu sein, obwohl sie auf der Landkarte schier eisern umschlossen scheint von Arabern, Türken und Persern?
„Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen“, sagt Mebaschar Hado. Kurden lieben Geschichten, das haben sie aus den Zeiten mitgenommen, in denen es noch kein Fernsehen gab. Da saßen sie in ihren einsamen Dörfern tagsüber vor dem Haus beim Tee, abends drinnen auf dem Teppich bei Huhn und Reis und tauschten die neuesten Nachrichten aus. Mebaschar gehört zum „Gastfreundschaftskomitee“ dieser Gedenkstätte und hat sich für mich ein paar Stunden freigenommen. Denn er will mir erklären, welcher Geist vom Grab des Mustafa Barsani ausgeht.
Er berichtet von einer der vielen Schlachten, die zu Marksteinen in der Geschichte der Kurden wurden. 1932 war es, bei Dola Waje, gar nicht weit entfernt von hier. Die Kurden hatten sich wieder einmal gegen die Zentralregierung in Bagdad erhoben. Eine irakische Spezialeinheit, aus der Luft unterstützt von britischen Flugzeugen, rückte gegen sie vor. Die Peschmerga leisteten zunächst keinen Widerstand, lockten die Soldaten immer tiefer ins Tal von Barsan hinein. Sie hatten beiderseits die Höhen besetzt, von dort nahmen sie dann den Feind unter Feuer. Am Ende war es ein Kampf Mann gegen Mann und ein irakischer Soldat schoss dem jungen Barsani, der einen Rebellentrupp kommandierte, eine Kugel in den linken Arm. Die Peschmerga überwältigten ihn und wollten ihn auf der Stelle töten. Barsani aber, gerade einmal 29, fiel ihnen in die Arme. „Lasst ihn leben!“, befahl er. „Er ist ein tapferer Mann.“ Der gefangene Schütze traute seinen Ohren nicht. „Ich bin Kurde“, brach es aus ihm heraus. Von nun an wollte er nicht mehr für Bagdad kämpfen und wurde sozusagen undercover ein wertvoller Informant für die Aufständischen. Die Kurden, so endet diese Geschichte, gewannen die Schlacht. Sie erlaubten, dass alle verwundeten Feinde zu ihren Einheiten zurückgebracht wurden – und halfen in vielen Fällen sogar beim Transport.
Mebaschar macht eine Pause und denkt nach. Dann fällt ihm eine zweite Geschichte ein. Sie spielt 1947, kurz bevor Mustafa Barsani, nunmehr 44, ins Exil in die Sowjetunion aufbrach, das letztlich zehn Jahre dauern sollte. Seine Peschmerga zogen ausgezehrt durch kurdische Dörfer. „Er hat ihnen trotzdem streng verboten, von den Einwohnern Essen zu fordern. ‚Verlangt von ihnen nie etwas mit Gewalt‘, hat er ihnen eingehämmert. ‚Wie wollt ihr sonst ihre Sympathien gewinnen?‘“ Die Folge sei gewesen, dass die Dörfler den Kämpfern aus freien Stücken Nahrung angeboten hätten.
Dann ist da noch eine dritte Geschichte. Sie habe sich Ende der 1960er-Jahre ereignet, sagt Mebaschar. Da war Barsani schon ein alter Kämpe, die Kurden fochten noch immer für ihren eigenen Staat, und Bagdad war so wie eh und je entschlossen, sie lieber zu vernichten als zu verstehen. Ein Mann namens Nasim Kasas war damals Chef des irakischen Geheimdienstes, und er war aus nachvollziehbaren Gründen bei den Kurden besonders verhasst. Zwei junge Peschmerga traten vor Barsani und behaupteten, sie würden es schaffen, ihn umzubringen – mit einem Bombenanschlag auf sein Haus.
„Könnt ihr mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, dass dabei auch noch andere ums Leben kommen?“, fragte sie der Kurdenführer.
„Nein, natürlich nicht“, antworteten sie. „Wie können wir so etwas garantieren?“
„Dann dürft ihr diesen Anschlag nicht machen“, entschied Barsani. „Merkt euch für immer: Nie dürft ihr Unschuldige töten!“ Mebaschar schweigt und lässt die Anekdoten wirken. „Mitkämpfer, die heute noch leben, brechen in Tränen aus, wenn von Mustafa Barsani die Rede ist“, fährt er fort. „Niemand war so gut zu den Leuten wie er.“ Noch eine Pause und dann fügt er hinzu: „Wenn er mit seinen Peschmerga einen Fluss durchqueren musste, stieg er immer als Letzter ins Wasser.“
Wir streifen über den seltsamen Friedhof, auf dem so gar nichts heroisch wirkt. Nur über unseren Köpfen, in 36 Meter Höhe, flattert die kurdische Flagge, wie sie von der autonomen Regionalregierung verwendet wird. Sie hat drei horizontale Streifen: Rot steht für das vergossene Blut, Weiß steht für den Frieden und Grün für die gebirgige Natur. Im Zentrum der Flagge scheint eine Sonne mit 21 Strahlen – eine uralte Glückszahl dieses Volkes.
Der Boden rund um das Dorf Barsan ist mit besonders viel Blut getränkt. Um den Peschmerga die Unterstützung zu entziehen, ließ Saddam Hussein ab 1983 Siedlungen in diesem Gebiet zerstören und Tausende von Männern hinrichten. Aber heute, dreißig Jahre danach, sind nicht einmal mehr Narben zu sehen. 59 Dörfer sind neu errichtet worden, teils mithilfe internationaler Organisationen, so wirkt die ganze Gegend wie ein einziges Neubauprojekt. Anfangs waren es Witwen, die mit ihren Kindern ein neues Leben begannen, mittlerweile gibt es in diesem Tal jedoch auch wieder tatkräftige Männer. „Wir haben Regenfälle von Oktober bis Mai“, sagt Mebaschar. „Viele Früchte wachsen hier ohne jede Bewässerung: Mandeln und Melonen, Trauben, Feigen und wilde Birnen.“
Ich treffe mit ihm den ersten, aber lange nicht den letzten erstaunlichen Menschen in Kurdistan. Er ist der lokale Chef des kurdischen Geheimdienstes Asaisch, wurde 1973 geboren und offenbart mir, dass er philosophische Werke von Locke, Descartes und Spinoza gelesen habe. „Schon als kleines Kind wollte ich immer Bücher haben“, erzählt er. „Ich wuchs im Iran auf, weil meine Eltern dorthin geflüchtet waren. Dort las ich viel über die kurdische, persische und europäische Geschichte.“ Nach seiner
Rückkehr, als erwachsener Mann, brachte er sich ganz alleine Englisch bei, mit Kopfhörer und Computer.
„Die Leute von Barsan haben schon an Umweltschutz gedacht, als es dieses Wort noch gar nicht gab“, sagt er. „Hier wurden die Bäume nie großflächig abgeholzt. Sie sehen ja, alles ist hier voller Bäume, daher ist die Landschaft besonders grün. Wissen Sie, was hier passiert ist? Eine echte Kulturrevolution!“
„Wie bitte?“, sage ich.
„Ja, das war das Werk von Scheich Abd al-Salam. Sie werden es nicht glauben, aber der setzte von 1885 an bahnbrechende Reformen durch.“ Er zählt sie der Reihe nach auf: Privater Großgrundbesitz wurde abgeschafft, der Boden unter den Bauern verteilt. Zwangsehen, von Eltern arrangiert, wurden ebenso verboten wie die damit verbundene Mitgift. Jedermann wurde vor dem Gesetz gleich. Die Moschee war nicht mehr nur eine Gebetsstätte, sondern auch ein Raum für Diskussionen und Schlichtung von Streitereien. In jedem Dorf wurde ein Komitee gegründet, das sich um die Belange der Allgemeinheit zu kümmern hatte. Es war wie ein Urkommunismus, noch ehe die Oktoberrevolution ausbrach, und wie ein republikanischer Minikosmos, während große Teile Europas noch von Kaisern und Königen regiert wurden.
„Humanität war das Topthema jener Zeit“, findet Mebaschar. „Die lokalen Scheichs gingen in die Städte und saugten sich dort mit Informationen voll. Die neuen Ideen wurden zu einem Motto, unter dem sich sieben Stämme zu einer Art Konföderation zusammenschlossen: die Schiwani und Dolameri, die Misuri und Baroschi, die Nisari, Gardi und Harki Binadscheh – sie alle wollten von nun an nur noch Barsanis sein.“
Die ungestümen Demokraten von Barsan schickten 1907 ein Telegramm an die Hohe Pforte in Konstantinopel. Sie stellten an den Herrscher des Osmanischen Reiches, dem sie formell untertan waren, unerhörte Forderungen: In den Kurdengebieten sollte Kurdisch die Amts- und Schulsprache sein, der Gouverneur und seine Beamten Kurdisch sprechen müssen, ein Teil der Steuern für den Bau von Straßen und Schulen in den Kurdengebieten verwendet werden. Für den Sultan war das nichts anderes als Aufruhr und Abtrünnigkeit. Sieben Jahre später wurden Abd al-Salam und dessen drei Leibwächter von einem kurdischen Scheich, der heimlich mit den Türken paktierte, verraten: Sie waren eingeladen, bei ihm zu übernachten, und wurden von seinen Leuten im Tiefschlaf überwältigt. Alle vier wurden in Mossul erschossen. „Das waren“, meint Mebaschar, „unsere ersten Märtyrer.“
Der Geist von Barsan ist die zweite große Quelle, aus der die heutigen Kurden schöpfen.
„Wir haben nie andere Völker angegriffen, sondern immer nur uns selbst verteidigt“, sagt Mebaschar. „Aber wir lassen auch nie zu, dass man uns unsere Rechte nimmt. Wenn wir kämpfen, schauen wir dem Gegner ins Auge – wir schießen ihm nie in den Rücken.“
Ich trinke meinen letzten Tee und wir sprechen über die Kraft zur Versöhnung. Etwa 200.000 Kurden haben, aus welchen Gründen auch immer, unter Saddam Hussein dem Regime in Bagdad gedient, meist als Polizisten und Soldaten. Sie trugen die Uniform des Feindes und wurden daher dschasch genannt, auf Deutsch etwa „Arschlöcher“. Als Saddam stürzte, wurde kein Einziger von ihnen bestraft. Die dschasch zogen ihre Uniformen aus, gingen nach Hause zu Frau und Kind, erlebten keinerlei Vergeltung.
Mebaschar reicht mir zum Abschied die Hand. „Wir sind es gewohnt“, sagt er, „die Hand auszustrecken.“ Für ein paar Stunden habe ich fast vergessen, dass ich im Nahen Osten bin.
„Wir sind halt irgendwie anders“, meint der Geheimdienstmann mit den philosophischen Werken im Regal. „Anders als die Araber – aber auch anders als ihr im Westen.“
ERBIL
„In Bagdad haben sie Mauern errichtet“, sagt Massud Abdul Khalek, Chef der Wochenzeitung „Standard“ und einer der bekanntesten kurdischen Intellektuellen. „So groß ist inzwischen der Hass zwischen Sunniten und Schiiten. Wie soll da jemals noch ein einheitlicher Staat funktionieren? Ihr Deutschen habt doch selber einmal eine Mauer gehabt. Ihr wisst, was das bedeutet.“
In Kurdistan leben eine Menge arabischer Sunniten und Schiiten. Sie machen Geschäfte miteinander und leben friedlich nebeneinander – in einem Ambiente, das von Kurden geprägt ist. Aber außerhalb Kurdistans gehen sie einander an die Gurgel – in einem Ambiente, das von ihnen selber geprägt ist. Allein 2014, so UN-Angaben, kamen im Irak 12.282 Menschen durch Anschläge und gewalttätige Auseinandersetzungen ums Leben – durchschnittlich 34 pro Tag.
Massud drückt diesen Unterschied so aus: „Sie bekämpfen sich im Schatten von Dattelbäumen – aber nicht im Schatten von Nussbäumen.“