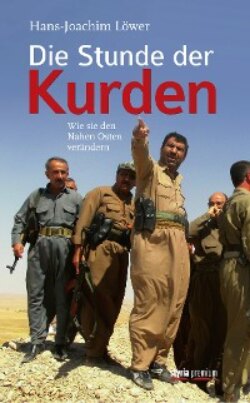Читать книгу Die Stunde der Kurden - Hans-Joachim Löwer - Страница 9
ОглавлениеKAPITEL 5
HALABDSCHA
„Nur Alter und Tod können mich stoppen“
Weshalb ein verkrüppelter Minenräumer weitermacht
Was war er für ein kühner junger Kerl! Seine Kameraden konnten oft gar nicht hinsehen, wenn er bei der Arbeit war. Er legte sich der Länge nach auf den Bauch und robbte zentimeterweise vor. Seine Hände tasteten sich vorsichtig durch das Dunkel der Nacht. War da irgendwo ein Stolperdraht, der quer durch das Gelände verlief? Oder saß da, per Hand vergraben, ein kleiner Sprengkopf im Boden? Hoschiar Ali wusste, dass er in die Luft fliegen würde, wenn er auch nur ein wenig zu stark an so etwas stieße. Das Teufelszeug, das er im Gelände suchte, waren Minen. Er war Mitte zwanzig und hatte sich, das war Ehrensache zu jener Zeit, den Peschmerga angeschlossen. Diese kamen nachts von den Bergen herunter und griffen Militärbasen an, auf denen die irakische Armee stationiert war. Seit 1986 hatten die Kurden dieses Ass in ihren Reihen. Hoschiar buddelte ihnen, durch das Geschick seiner Hände, jeweils einen zwei Meter breiten Korridor frei, durch den sie dann ihre Attacke starteten.
„Ich habe mir das alles praktisch selber beigebracht“, sagt er. „Nach kurzer Zeit wusste ich schon genau, wie die Soldaten ihre Minen legten und wie groß die Abstände zwischen den Sprengfallen waren.“ Wir sitzen im Wohnzimmer seines Hauses in Halabdscha, in einer Ecke steht eine ganze Kollektion von Minen, und Hoschiar, Jahrgang 1963, erzählt aus seinem verrückten Leben. Er ist der nächste Kurde, bei dem ich aus dem Staunen nicht mehr herauskomme.
1991, als die Vereinten Nationen eine Schutzzone für die Kurden einrichteten, überfluteten internationale Hilfsorganisationen den Nordirak. Sie machten sich daran, Millionen von Minen aufzuspüren und zu entschärfen, die große Teile des Landes schlicht unbewohnbar machten. Wenn Menschen in die Berge zurückkehrten, um ihre von Saddam Hussein zerstörten Dörfer wiederaufzubauen, liefen sie Gefahr, bei der Feldarbeit auf vermintes Gelände zu geraten, ihre Kühe und Schafe durch Explosionen zerrissen zu sehen. Viele Dorfbewohner waren unzufrieden mit dem Tempo, das die Experten aus dem Ausland an den Tag legten. Da fiel ihnen dieser Teufelskerl aus Halabdscha wieder ein, von dem die Peschmerga so oft erzählt hatten. „Ruft ihn doch einfach an“, hieß es dann. „Der fackelt nicht lange. Der legt einfach los.“
„Ich habe jedem meine Telefonnummer gegeben, der mich danach fragte“, berichtet Hoschiar heute. „So sind mit der Zeit immer mehr Anrufe gekommen.“ Seine Eltern waren dem Giftgasangriff auf Halabdscha zum Opfer gefallen, daher hatte er auch niemanden, der ihn ernsthaft zurückzuhalten versuchte. „Ich habe so viel Sterben gesehen – ich wollte einfach etwas tun. So ist das bis auf den heutigen Tag.“
„Was nehmen Sie denn pro Einsatz?“, frage ich.
„Nichts, absolut nichts“, antwortet er. „Ich habe das noch nie für Geld gemacht. Ich war fünf Jahre Peschmerga, schied aus im Rang eines Generalmajors, und die Pension, die ich heute dafür bekomme, reicht aus. Ich will mit den Minen kein Geld verdienen.“
Es hat nicht wenige Leute gegeben, die ihn kritisierten. Er mache eine lebensgefährliche Arbeit ohne jedes moderne Gerät und ohne je eine Ausbildung absolviert zu haben. Sein Vorgehen sei amateuerhaft, unprofessionell, mehr von Abenteuerlust als von Fachwissen bestimmt. Dadurch verleite er junge Leute, die ebenfalls ohne Training seien, es ihm gleichzutun. In der Tat sind zwei seiner Brüder, die ihm beim Minenräumen halfen, dabei umgekommen. Einmal wurde er vom Ministerium für Minenangelegenheiten in Sulaimania verklagt, weil er angeblich in dessen Zuständigkeitsgebiet wilderte. Aber da ging das Volk für ihn auf die Barrikaden, und es meldete sich eine Schar von Rechtsanwälten, die anboten, ihn kostenlos zu verteidigen, und so verlief das Verfahren schließlich im Sande.
„Glauben Sie mir“, sagt er trotzig, „ich habe mehr getan als all diese Organisationen zusammen. Ich habe 540.000 Hektar Land gesäubert und dabei fast 2,4 Millionen Minen ausgegraben. Ich habe 160 Menschen, die in Minenfeldern schwer verletzt wurden, eigenhändig herausgezogen. Die meisten dieser Organisationen aber sind korrupt und verschwenden nur das Geld.“
Mir kommen Zweifel angesichts der abenteuerlichen Zahlen. Aber ich sehe mit eigenen Augen, dass er einen hohen Preis für seine Passion bezahlt hat. 1989, in seinem dritten Peschmerga-Jahr, wurde ihm bei einer nächtlichen Suche das linke Bein abgerissen. Kein Minenräumer der Welt hätte danach wohl Lust gehabt, nach der fälligen Amputation seine Arbeit wiederaufzunehmen. Hoschiar hingegen zog mit Krücken wieder los, legte sie an Ort und Stelle aus der Hand und robbte einbeinig auf seine neuen Ziele zu.
Fünf Jahre später, 1994, erwischte es ihn das zweite Mal. Er setzte seinen verbliebenen Fuß auf einen Stein, unter dem eine Mine vergraben war. Da wurde ihm auch noch das rechte Bein zerfetzt, Ärzte mussten von dem Stumpf nach und nach immer noch einmal etwas abschneiden, dafür wurde er in den Iran und sogar nach Russland gebracht. Nun war Hoschiar aus Halabdscha endgültig zum Volkshelden geworden – zu einer Art lebendem Märtyrer.
„Peace Winds“, eine japanische Hilfsorganisation, lud ihn zu einer Reise in den Fernen Osten ein. Dort blieb er insgesamt sieben Jahre, die Japaner präsentierten ihn auf Fundraising-Touren im ganzen Land und sammelten so viel Geld, sodass seine Familie noch eine zusätzliche Pension erhielt. Mit den Mitteln aus Spenden kauften die Japaner ihm zwei computergesteuerte Prothesen – sozusagen „intelligente Kniegelenke“, die die Bewegungsabläufe koordinieren und harmonisieren. Damit geht er nun auch nicht gerade gelöst, sondern nur mühsam, ständig hin- und herschwankend. Doch kein einziges Wort des Jammerns kommt über seine Lippen. Er lacht, als habe er bei all dem noch Spaß, und aus seinem Mund sprudelt ein unaufhörlicher Quell von Geschichten.
„Wäre es, nach dem Verlust beider Beine, nun nicht wirklich genug gewesen?“, frage ich ihn.
„Warum denn?“, antwortet er. „Es gibt noch so viel zu tun.“ Das Gebiet an der iranischen Grenze, im Raum Halabdscha und Sulaimania, sei bislang nur zu einem Drittel geräumt. 9250 Minenopfer habe es in dieser Gegend schon gegeben. Der Vertrag von Ottawa, den der Irak unterschrieben habe, sehe vor, dass bis 2018 das ganze Land frei von Minen sein soll. „Da habe ich wirklich noch viel, viel Arbeit.“
So wackelt er mit seinen Prothesen auch heute noch ins Feld, schnallt seine zwei Kunstbeine ab, legt sie ins Gras – und beginnt als Torso nach Minen zu suchen. Die Kurden haben nun auch noch einen Helden ohne Beine. Moscheen wurden nach ihm benannt, Schulen und Kliniken und ganze Dörfer tragen seinen Namen.
„Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen mein neues Museum“, sagt Hoschiar und vibriert vor Tatendrang. „Es ist noch nicht ganz fertig, aber zumindest die Mauern stehen schon.“ Wir steigen zusammen in ein Auto, es geht von Halabdscha aus gut fünf Kilometer Richtung Grenze auf einen Hügel. Dort liegen nicht nur Minen herum, sondern auch Reste von Giftgasbomben.
„Ich will hier alle Waffen ausstellen, die gegen die Kurden eingesetzt worden sind“, verkündet er. „Und alle Minen, die ich entschärft habe, sollen eines Tages einmal hier lagern. Zurzeit sind sie noch in einer einsamen Berggegend vergraben, ein kleiner Teil liegt in meinem Haus herum.“ Ich stapfe durch einen Rohbau, der noch nicht so richtig ahnen lässt, wie das einmal aussehen soll. „Keine Sorge, auch das kriege ich hin“, erklärt Hoschiar. „Ich tue das für künftige Generationen. Die werden nämlich gar nicht glauben, was in Kurdistan einmal los war – wenn sie es nicht mit ihren eigenen Augen sehen können.“
Von hier oben aus hat man einen schönen Blick hinaus ins Land. Hoschiar behauptet, er kenne jede Scholle, und ich erwidere, das wundere mich nun wahrlich nicht mehr.
„Ich bin wohl auch der Einzige, der zu seinen Lebzeiten schon sieben Gräber hat“, äußert er und genießt, dass ich ihn schon wieder ganz lange ansehe.
„Sieben Gräber, sagten Sie?“
„Ja, meine amputierten Gliedmaßen sind auf sieben Stellen verteilt. Die Leute glauben, so eine Reliquie bringt ihnen Glück. Ein Stück liegt im Iran, eines in Japan, eines in Russland. Auf kurdischem Boden sind vier Teile bestattet, sie liegen in Pindschar und Sulaimania, am Berg Bamo, wo ich mein erstes Bein verlor, und hier in meiner Heimatstadt Halabdscha. Wenn du willst, fahren wir mal hin zu dem hiesigen Grab.“
Zehn Minuten später stehen wir an diesem Ort. Ein kleines, unscheinbares Rechteck, ein wenig aufgeschüttete Erde, und wieder ein weiter Blick hinaus in die Täler. Viele Menschen pilgern im Lauf des Jahres hierher, denn das hier ist ja nun wirklich kurdische Geschichte in Fleisch und Blut.
Wir fahren zurück zu Hoschiars Haus. Dort sitzt der eineinhalbjährige Beneat, sein jüngster Sohn, im Wohnzimmer und spielt mit all den gehorteten Minen – darunter ist auch diejenige, die einst ein Bein des Vaters wegriss. Er kennt sich offenbar schon ziemlich gut mit den Dingern aus, rupft und zupft unaufhörlich an ihnen herum. Mein Dolmetscher bekommt schreckgeweitete Augen, springt auf und zerrt mich aus dem Raum. „Du, das ist nicht mehr sicher hier“, raunt er mir zu. „Bitte lass uns gehen!“ Hoschiar lächelt nachsichtig, das hat er anscheinend nicht zum ersten Mal erlebt.
In seinem Vorgarten steht ein Schild mit einem Totenkopf und zwei gekreuzten Knochen. Er hat den Boden abgesteckt wie ein Minenfeld, das gesäubert werden soll. Auf dem Hausdach weht eine Nippon-Flagge, die ihm angeblich ein japanischer Journalist gekauft hat. Sein Auto ziert ein Aufkleber, mit dem sich Hoschiar direkt an die Minen wendet: „Gott und meinem Land zuliebe – ich bin bereit, euch zu zerstören, wo immer ihr auch seid.“
„Solange ich noch meine Hände habe, werde ich mit dieser Arbeit nicht aufhören“, sagt er, „glaub mir, nicht für einen Moment.“ Er reicht mir zum Abschied die Hand. Wir gehen hinaus auf die Straße, und er humpelt mit seinen Krücken hinter uns her.
„Die Freiheit hat eben ihren Preis“, ruft er uns nach, als wir in unser Auto einsteigen.
Noch einmal strahlt er übers ganze Gesicht. Und winkt uns mit seinen Krücken nach.
ERBIL
Ich brauche nur „Almanya“ zu sagen – schon strahlt mein Taxifahrer und reckt den Daumen nach oben. „Very good people“, kommt dann aus seinem Mund. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es ist fast schon erdrückend, wie die Kurden die Deutschen lieben. Seit Berlin auch noch Waffen liefert, ist die Liebe ins Unermessliche gestiegen.
Die Taxifahrer graben im Gedächtnis nach großen Deutschen. „Schumacher“ ist ein Topfavorit, „Schweinsteiger“ ebenso. Aber einer macht mit Riesenabstand das Rennen. Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn der Name fällt. „Hitler“, sagen sie und ballen bewundernd die Faust. Toller Kerl, hat es mit der ganzen Welt aufgenommen. Genauso tapfer wie die Peschmerga, die von einer Übermacht an Soldaten und Waffen nicht zu besiegen waren.
Bei Arabern ist der Hitler-Hype weit verbreitet, dort liebt man ihn wegen seines Hasses auf die Juden. Aber zu den sanftmütigen Kurden passt das irgendwie nicht. Sie haben auch überhaupt nichts gegen Juden. Ich frage kurdische Freunde, wie sie sich das Phänomen erklären. „Das rührt noch aus Saddams Zeiten“, antworten sie. „In unseren Schulbüchern war Hitler einfach ein großer Feldherr. Wir haben so gut wie nichts davon gehört, dass er Verbrechen begangen hat.“