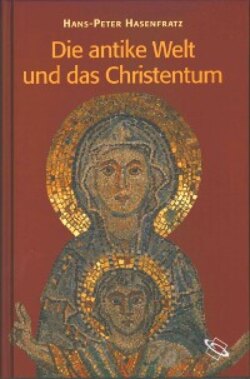Читать книгу Die antike Welt und das Christentum - Hans-Peter Hasenfratz - Страница 10
Sklaven und Freie3
ОглавлениеEin römischer Rechtssatz lautete: tria sunt, quae habemus: libertatem, civitatem, familiam – dreierlei besitzen wir (als freie Bürger): persönliche Freiheit, Bürgerrecht, Familienzugehörigkeit (Digesten 4,5,11). Der Sklave besitzt nichts von alledem, denn er besitzt zivilrechtlich gar keine Rechtspersönlichkeit (kein caput). Das meint: er gilt zivilrechtlich als Sache, die jemandem gehört; Kategorien wie Freiheit, Bürgerrecht, Familie treffen auf Sachen natürlich nicht zu. Der Sklave als Sache, die in jemandes Eigentum steht, zählt zu den Instrumenten. Und zwar im Unterschied zu den stummen (instrumentum mutum) und lautbegabten (instr. semivocale) zu den sprachfähigen Instrumenten (instr. vocale), unterscheidet sich also von Gerät und Vieh nur durch seine sprachliche Artikulationsfähigkeit (Varro, Res rusticae 1,17,1). Grundsätzlich gibt es nichts, was ein Herr mit seinem Sklaven nicht tun konnte. Er konnte ihn ohne Grund töten, wenn es ihm beliebte (vitae necisque potestas – Macht über Leben und Tod). Der Eigentümer kann seine Sklavin auf den Strich schicken und den Erlös einkassieren (s. u. S. 31); Sklaven können von ihrer Herrin sexuell missbraucht werden (vgl. Eck 1993, 117 ff.). In einem seiner Epigramme (6,39) gibt uns Martial Einblick in den demoralisierenden Einfluss der Sklavenwirtschaft auf die familiäre Geschlechtsmoral. Die etwas freie Übersetzung (Schreiber 1962, 147 / 148) entspricht der Thematik.
Angeredet ist der Gatte (Cinna) der Ehefrau (Marulla):
„Von deiner Frau hast du der Kinder sieben,
Was man so Kinder nennt, denn im Gesicht
Steht ihnen allen leserlich geschrieben:
Du bist der Vater dieser Sippschaft nicht.
Der Bursche da mit dem gekrausten Haar
Ist von dem Maurenkoch ganz offenbar.
Woher der Zweite stammt, erkennt man leicht,
Weil er dem Bäcker, diesem Triefaug, gleicht.
Die Affennase und die wulstgen Lippen
Des Dritten lassen auf ’nen Boxer tippen.
Der hübsche Vierte mit der frechen Miene
Ist ganz der widerliche Konkubine.
Der Spitzkopf mit dem schlappen Eselsohr
Ging zweifellos aus dem Kretin hervor.
Den bunten Reigen schließt ein Schwesternpaar
Mit schwarzem und mit feuerroten Haar.
Auch ihre Väter sind vom Personal:
Der Flötenspieler und der Hofmarschall.
Die Liste wär’ viel länger noch geraten,
Doch etliche Verehrer war’n Kastraten.“
Der Sklave hat als Sache auch kein Recht auf Besitz: kein Eigentum. Er ist lediglich „die verlängerte Tasche seines Herrn“ (Sohm 1949, 170). Sein Herr kann ihm allerdings Vermögenswerte (zeitweilig) überlassen (ein sog. peculium), die er dann im Rahmen der Anweisungen seines Herrn selbstständig zu verwalten hat. Das ist übrigens der Hintergrund der biblischen Parabel von den anvertrauten Talenten (Mt 25,14 – 30).
Im Moment, da jemand Sklave wird, verliert er sein bisheriges Bürgerrecht; ein anderes kann er nicht erwerben: er ist ja Sache. Mit dem Eintritt in den Sklavenstand sind auch seine bisherigen Familienverhältnisse, aus denen er herausgerissen wurde, erloschen; neue kann er als Sache nicht begründen. Sein Eigentümer mag ihm erlauben oder befehlen (Sklavenzucht!), mit einer Sklavin Kinder zu erzeugen: aber diese Kinder sind nicht seine Kinder, sondern Eigentum seines Herrn. Ein solches eheähnliches Verhältnis zwischen Sklaven verschiedenen Geschlechts ist rechtlich keine Ehe (matrimonium), sondern ein contubernium – ein Zusammenhausen (wörtlich: Zeltgemeinschaft).
Wie wird ein Mensch nach römischem Recht Sklave? Einmal durch Geburt von einer Sklavin (ist die Mutter eine Freie, der Vater ein Sklave von ihr, ist das Kind frei; s. o.). Dann durch Kriegsgefangenschaft. Bedingt durch die militärische Expansionspolitik Roms war dies der häufigste Tatbestand, der Sklaverei begründete. Die als Siegesbeute nach Rom geschafften und im Triumphzug (s. u. S. 50) bekränzt vorgeführten Kriegsgefangenen wurden als Sklaven an Interessierte ausgeboten (sub corona vendere – wörtlich: unter dem Triumphkranz verkaufen). Weiter wird Sklave, wer seine Verbindlichkeiten nicht bezahlen kann. Ist die Geldschuld gerichtlich anerkannt, darf der Gläubiger Hand an den Zahlungsunfähigen legen (manus iniectio) und ihn, wenn niemand für ihn bürgt, gefangen setzen und nach dreimaligem öffentlichen Ausruf an den Markttagen in die Sklaverei verkaufen oder töten (mehrere Gläubiger dürfen sich ihn in Stücke hauen) (Zwölftafelgesetz 3,1 – 6; Düll 1959, 30 ff.). Die biblische Parabel vom großmütigen König (und vom unbarmherzigen Knecht) setzt das Rechtsinstitut der Schuldsklaverei voraus: Mt 18,23 – 27(28 – 34). Schließlich steht auf gewisse Kapitalverbrechen Strafsklaverei durch Verurteilung zu Bergwerksarbeit (ad metallum) oder zum Tierkampf auf Tod und Leben in der Arena (ad bestias). 1Kor 15,32 spielt Paulus – im Bild – auf einen solchen Kampf mit wilden Tieren in Ephesus (s. u. S. 84) an. Und endlich wird eine freie Frau Sklavin, wenn sie sich mit einem fremden Sklaven in ein Konkubinat einlässt und ihre Beziehung zu ihrem Konkubinen trotz dreimaliger Aufforderung seiner Halterschaft nicht beendet: dann fällt sie selbst zur Strafe in deren Eigentum4. Mit ihren eigenen Sklaven darf eine freie Frau (hinter dem Rücken des Ehemanns, wenn sie einen hat wie die Marulla bei Martial) natürlich treiben, was ihr beliebt (und jene vermögen!).
Die Entlassung aus der Sklaverei (Freilassung) bedarf eines förmlichen Rechtsaktes. Denn wenn jemand seinen Sklaven einfach zum Teufel jagt, weil er ihm lästig ist (derelictio), wird dieser dadurch nicht frei, sondern herrenlose Sache (res nullius), die dem Erstbesten gehört, der sie sich aneignet. Es mochte mancherlei Gründe geben, seinen Sklaven (seine Sklavin) freizulassen: aus einer Laune heraus, zum Dank für geleistete treue Dienste, um ihn (sie) rechtmäßig zu heiraten, weil jemand ihn (sie) freikaufte oder weil man ihm (ihr) erlaubt hatte, sich nebenher genügend Geld zu verdienen oder abzusparen, um sich selbst freizukaufen usw. Die Freilassung (manumissio) erfolgte entweder durch testamentarische Verfügung (testamento); ohne diese ging der Sklave wie ein Gegenstand oder ein Stück Vieh an die Erben weiter. Oder vor dem Prätor (Gerichtsvorsteher): der Eigentümer erklärt seinen Freilassungswillen, der Prätor berührt zum Zeichen seiner Amtsvollmacht den Freizulassenden mit einem Stab (vindicta) und bekräftigt damit die Freilassung als rechtsgültig5. Durch Testament im Todesfall oder Erklärung vor dem Prätor zu Lebzeiten des Freilassers wird der Sklave zum libertus und gehört zum Stand der libertini: der Freigelassenen (vgl. Apg 6,9). Der Freigelassene ist noch nicht ganz frei, sondern seinem Patron (patronus: die Bezeichnung seines einstigen Herrn) bleibt er weiterhin verbunden und verpflichtet: der Patron darf ihn beerben; den Patron muss er, falls dieser verarmt, unterstützen. Der Erblasser konnte mit der testamentarischen Freilassung Auflagen verbinden: Grabpflege, jährlich wiederkehrendes Totengedenken usw. Die Freilassung ist eine Art Geburtsakt, durch den eine Sache zu einer Person, der Patron zum Vater wird; den Zeugungsakt symbolisiert die Berührung durch den prätorischen Stab (phallische „Lebensrute“). Erst die Kinder des Freigelassenen sind wirklich Freie (liberi), weil schon frei geboren (ingenui).
Waren Sklaven nach römischem Zivilrecht Sache, so galten sie immerhin sakralrechtlich (religiös) als Person. Ihr Grab blieb wie das von Freien als (den unterirdischen Gottheiten) geweihte Stätte (res religiosa) für immer profaner Nutzung entzogen (vgl. Gayer 1976, 55). Deshalb sind uns so viele Gräber und Grabinschriften aus der Antike erhalten geblieben – wichtigste Dokumente antiker „Geschichte von unten“. Sklaven durften nicht am Kult der römischen Bürger teilnehmen, sie besaßen ja kein Bürgerrecht. Aber es war ihnen gestattet, sich zu Kultverbänden zusammenzuschließen (die der Staat dann tolerierte, wenn sie den Kaiserkult nicht in Frage stellten): mysteria, sacramenta (private Kultvereine), collegia (bes. Begräbnisvereine). Die Mysterienvereine standen (oft) auch Freien offen, denen der offizielle Staatskult (emotional) nicht genügte. Hier wurden andere, „freiere“, „neuere“ Formen der Religiosität geübt, die im Trend der gesellschaftlichen und religiösen Entwicklung lagen (s. u. S. 33 und S. 78). Auch die Christen haben sich in solchen Kultvereinen organisiert, doch wurden diese vom Staat nicht geduldet, weil sie den Kaiserkult verweigerten und den Kaiser auch nominell nicht als zu verehrende göttliche Person anerkannten (vgl. Phil 3,20; s. u. S. 44).
Wo und wozu wurden Sklaven gebraucht? Neben den schon erwähnten sollen noch zwei Verwendungsarten und -orte besonders angesprochen werden. Erstens die Arbeitssklaven auf den großen Landgütern (latifundia). Ihre Lage war wenig beneidenswert. Ihr Herr residierte in der fernen Stadt oder in einer Sommervilla des städtischen Umlandes oder am Meer – keinesfalls auf dem Landgut. Seine spärlichen Besuche dort beschränkten sich auf kurze Inspektionsvisiten, die persönliche Kontakte mit der unfreien Belegschaft erschwerten oder als nicht wünschenswert gar nicht erst aufkommen ließen. Es ist dies das (auch andernorts bekannte) System der „absentee landlordship“ (Frye 1976, 217), das uns den Zugang zum Verständnis der Allegorie von den bösen Winzern (Mk 12,1 – 9) erschließt. Dieses System lieferte die Sklaven dem Gutsverwalter aus, der, nur am Aufbringen der Pachtsumme interessiert, seine Arbeitskräfte erbarmungslos ausbeutete. Menschenleben brauchte er nicht sonderlich zu schonen, die Sklaven reproduzierten sich von selbst! Besser hatten es, zweitens, die Haussklaven, die in den großen (städtischen) Haushaltungen aufwuchsen (vernae) und gewissermaßen zur Großfamilie rechneten. Hier war der persönliche Kontakt zur Herrschaft möglich und ausschlaggebend, konnten sich – oft sehr (zu!) enge und gute – menschliche Bande knüpfen. Dafür war in diesen Großhaushalten der Vornehmen (und besonders in den kaiserlichen Hofhaltungen) die Arbeitsteilung geisttötend, oft bis zum Exzess getrieben und entsprechend unproduktiv, indem jede Handreichung und die kleinste Dienstleistung von einem speziellen Sklaven verrichtet wurde (Geist 1969, 84 ff.). Grabinschriften erwähnen: praepositus auri potori – Vorgesetzter über das goldene Trinkgeschirr, a mappis – Tischtuchverwahrer, pincerna – Getränkemixer, ad imagines – Ahnenbildpfleger, vestificus a veste scaenica – Schneider für den Theaterbesuch, cistarius a veste forensi – Garderobier für Ausgangsanzüge, nomenclator – Namennenner (der seinem Herrn die Namen der begegnenden Passanten zu nennen hatte), silentiarius – Schweigengebieter (der seine Mitsklaven zur Ruhe anhalten musste) und dergleichen Stumpfsinn mehr.
Entwichene Sklaven (fugitivi) hatten kaum eine Chance; Detekteien mit professionellen Sklavenjägern (fugitivarii) schnappten (gegen Honorar) den Flüchtigen meist schnell wieder. Die Bestrafung für den Fluchtversuch war ins Belieben des Eigentümers gestellt und konnte äußerst grausam sein; (späteres) kaiserliches Recht verbietet zwar grundlose Tötung eines Sklaven (s. u.), hier aber lag ja ein Grund vor. Im neutestamentlichen Philemonbrief schickt der Apostel Paulus einen entlaufenen Sklaven zu seinem Herrn zurück und bittet für den Ausreißer um Verzeihung, da Herr und Sklave Christen seien (vgl. Gayer 1976, 223 ff.). Im Trend stoischer Philosophie („Menschen sind von Natur aus Brüder und Schwestern“), und vielleicht auch schon als unterschwellige Wirkung des christlichen Zeitgeistes, haben ab der ersten nachchristlichen Jahrhundertwende kaiserliche Reskripte das Sklavenrecht humanisiert (vgl. Eck 1993, 120 ff.). Grundlose Tötung seines Sklaven etwa (s. o.) sollte den Täter teuer zu stehen kommen: tötet jemand seinen Sklaven, so zahlt er denselben Betrag an die Staatskasse, den er wegen Sachbeschädigung einem Dritten als Schadenersatz zu leisten gehabt hätte, wenn er dessen Sklaven erschlug. Ferner sollten nach der gleichen Verfügung Sklavenhalter gezwungen werden, ihre Sklaven zu verkaufen, wenn sie sich unerträglich roh gegen sie benähmen (Gaius, Institutiones 1,53). In den Digesten (1,6,2) ist der Name einer vornehmen Dame verewigt: sie hieß Umbricia und wurde für fünf Jahre verbannt, weil sie aus unbedeutendstem Anlass ihre Sklavinnen aufs Grausamste gequält hatte (atrocissime tractasset). Wer seine Sklaven zu unzüchtigen Handlungen (etwa seine Sklavin zur Prostitution; s. o.) zwang, musste fortan mit Bestrafung (Zwangsverkauf; s. o.) rechnen. Berührung einer Kaiserstatue schützte vor dem Zugriff des Herrn (ad statuas confugere).
Was die kaiserlichen Reskripte unter Strafe stellen mussten, war offenbar Praxis. Daneben darf nicht vergessen werden, dass uns anrührende Zeugnisse menschlicher Nähe zwischen Herrschaft und Sklaven erhalten sind, wie sie zwischen Gleichgestellten und Verwandten inniger nicht sein konnten. Einige Grabinschriften sollen das illustrieren (Geist 1969, 62ff.; Übersetzung von mir):
„Ehemann war ich nicht, und doch hinterließ ich ‚Kinder‘“ (Wortspiel: liberi bedeutet Kinder und Freie).
Grab eines Centurionen (Hauptmanns), der nicht verheiratet war und doch, wie er bemerkt, Kinder (liberi) zurücklässt, nämlich von ihm freigelassene Sklaven, deren Nachkommen Freie (liberi) werden.
„Hero hat sich und Silvana, der Patrizierin, seiner Herrin und Gemahlin, seiner überaus geliebten Frau, zu Lebzeiten dieses Grabmahl errichtet; dank ihrer Wohltat habe ich nach meiner Freilassung dreißig Jahre ungetrübt (sene bile, sic!) (mit ihr zusammen) gelebt.“
Die Frau, offenbar aus bester Familie, hat ihrem geliebten Sklaven die Freiheit geschenkt und ihn geheiratet; die Ehe scheint sehr glücklich gewesen zu sein.
„Den Namen nenne ich nicht noch sein Alter, / dass der Schmerz nicht beim Lesen das Gemüt drücke. / Du warst ein süßes Kind, doch in (zu) kurzer Zeit / hat der Tod das Leben besiegt, so dass du nicht frei wurdest. / Ach, ist das nicht Schmerz, wenn der vergeht, den man liebt? / Nun hat (ihn) der Tod auf ewig frei gemacht.“
Grabschrift für einen geliebten früh verstorbenen Haussklaven. Seine Herrschaft trauert um ihn wie um ein eigenes Kind. Ihre Absicht, ihn einmal freizulassen, hat der Tod vereitelt – und ihm ewige Freiheit gebracht.
„Dieses leere Grab hat unser Herr mir geweiht, / damit ich die Dächer seines Hauses von nahe sähe, / damit er mit eigener Hand öfter mir Blumen spende und Wein / und eine Träne, die mir mehr (als beides) gilt …“
Jemand hat seinem treuen Sklaven, der in der Fremde verstorben ist, ein Kenotaph auf seinem Grundstück gesetzt, damit der ferne Tote ihm nahe sei. Die Inschrift schließt mit der Versicherung des Toten: möge er (der Herr) zu den Assyrern, möge er zu den Iberern reisen – über Land und Meer folge seine (des Verstorbenen) Seele (anima) dem Herrn nach (subsequitur dominum).
Wer im Römischen Imperium nicht Sklave war, war deshalb noch lange nicht frei im Vollsinn. Das war nur der Quirit, der civis Romanus: der römische Bürger. Er besitzt aktives und passives Wahlrecht (ius suffragii und ius honorum), genießt weitgehende Steuerfreiheit (zahlt z. B. keine Kopfsteuer), darf (wie Apg 25,11 vom Apostel Paulus berichtet, der römische Bürger gewesen sein soll) an den Kaiser als oberste Gerichtsinstanz appellieren (provocatio). Dafür war er militärpflichtig: Jeder römische Bürger galt (theoretisch) als Soldat, die Dienstzeit als Legionär betrug volle zwanzig Jahre (Geist 1969, 119). Später (s. u. S. 25) wurden die Miliz- zunehmend durch Söldnertruppen ergänzt und ersetzt.
Die Bürger irgendwelcher anderen Gemeinden innerhalb des Imperiums, die Peregrinen (peregrini), genossen weniger Rechte, und mehr Pflichten drückten sie. Am besten unter ihnen stellten sich die Bürger einer Gemeinde auf italischem Boden (die Latini, ursprünglich nur die auf dem Boden Latiums Ansässigen). Auch sie waren weitgehend steuerfrei (zahlten z. B. keine Grundsteuern, die steuerliche Hauptbelastung). Auch Bürgern von Gemeinden auf nicht italischem Boden (etwa Kolonen) ist das ius Latii (das latinische Bürgerrecht) verliehen worden, sogar ganzen Provinzen wie Spanien durch Vespasian (69 – 79). Die Latiner hatten weder aktives noch passives Wahlrecht, mussten aber gegen die Feinde Roms immer wieder ihren Kopf hinhalten und die Hauptlasten der Kriege (Punischer Krieg!) tragen. So hob man auf einen römischen Bürger zwei „Bundesgenossen“ (Latiner) aus – zu einer Zeit, als das Zahlenverhältnis zwischen den beiden Gruppen diesen Aufgebotsquotienten noch keineswegs rechtfertigte (vgl. Mommsen 1907, 800; 1908, 219). Die Missstimmung darüber (und über vieles andere; s. u.) entlud sich schließlich im Bundesgenossenkrieg (91 – 82), der Rom an den Rand des Abgrunds brachte und den Latinern schließlich das volle römische Bürgerrecht eintrug. Wie die Römer mit ihren latinischen Bundesgenossen umzugehen pflegten, berichtet uns C. S. Gracchus in einer seiner Reden (Till 1976, 240 ff.; eingeklammerte Erläuterungen von mir eingefügt):
„Kürzlich kam ein Konsul nach Teanum im Gebiet der Sidiciner (diese und die folgenden latinischen Städte lagen an der Via Latina, die von Rom nach Süditalien führte). Seine Frau sagte, sie wolle im Männerbad baden. Der sidicinische Quästor M. Marius erhielt den Auftrag, alle, die dort gerade badeten, herauszujagen. Die Frau berichtete hernach ihrem Mann, das Bad sei ihr nicht schnell genug überlassen worden und auch nicht sauber genug gewesen. Deshalb wurde auf dem Marktplatz ein Pfahl aufgerichtet und dorthin der vornehmste Mann seiner Gemeinde geführt, M. Marius. Die Kleider wurden ihm vom Leibe gerissen, er wurde mit Ruten gepeitscht. Als das die Einwohner von Cales hörten, erließen sie eine Verordnung, keiner solle in der Badeanstalt baden, wenn ein römischer Beamter dort wäre. In Ferentinum befahl unser Prätor aus demselben Anlass, die Gemeindequästoren festzunehmen: der eine stürzte sich von der Mauer herab, der andere wurde ergriffen und mit Ruten gepeitscht.“
Traten die Römer schon gegen ihre Bundesgenossen derart arrogant auf, wie dann erst, lässt sich leicht schließen, gegenüber den übrigen Peregrinen, d. h. den Bewohnern der nicht italischen Gemeinden, also den Provinzialen. Auf ihnen lag faktisch die ganze Steuerlast des Imperiums. Im Klartext: Sie zahlten die Steuern für die steuerfreien römischen Bürger. Nämlich die Grundsteuer (tributum soli) und die Kopfsteuer (tributum capitis). Dazu kamen noch Zölle und andere Abgaben (die auch römische Bürger zu entrichten hatten). Die Provinzen waren der Willkür der römischen Beamten und ihrer Helfer schutzlos ausgeliefert und wurden bis aufs Blut ausgebeutet. Und dazu diente das System der sog. Staatspacht (Steuerpacht). Die Steuerhoheit des Staates, also sein Recht zum Einzug von Steuern und Zöllen, wurde im Auktionsverfahren gegen eine pauschale (und an den römischen Staat im Voraus zu entrichtende) Summe befristet und regional an Private (sog. publicani, die „Zöllner“ der Evangelien) vergeben. Das Eintreiben der Abgaben war damit privatisiert, der Überschuss über die gezahlte Pachtsumme bildete den erwirtschafteten Gewinn der Steuerpächter. Der Vorteil dieses Systems liegt auf der Hand: da die Steuerpacht auf Vorschuss zu zahlen war, kam der römische Staat schnell zu Geld, ohne sich mit hohen Verwaltungskosten zu belasten, die mit dem Einzug von Steuern verbunden sind; und da die höchsten Verwaltungsbeamten aus Rom ursprünglich jährlich wechselten, konnten sie bei Amtsantritt mit festen Einnahmen rechnen. Durch Registrierung der Provinzialen und ihrer beweglichen und festen Vermögenswerte (Landvermessung) verschaffte sich Rom einen Überblick über die zu erwartenden Steuereinkünfte und die danach zu bemessende Pachtsumme für die Steuerpachtvergabe. Eine solche Registrierung (census) für Judäa erwähnt Lk 2,1ff.: wer Grundbesitz besaß, musste ihn dort deklarieren, wo er lag (vgl. Leipoldt/Grundmann 1967, 160). Um die Kopfsteuer (im Unterschied zur Grundsteuer bei Lk) geht es in Mk 12,13 – 17: die Zeloten (eine radikale „palästinensische Befreiungsbewegung“) lehnten anders als die Pharisäer besonders die Kopfsteuer ab, weil in Münzen zu entrichten, die das Bild des Kaisers trugen. Falls die Steuerpächter und ihre Angestellten Einheimische waren (und nicht römische Bürger), galten sie ihrer Umgebung als Kollaborateure der Besatzungsmacht Rom und ernteten dementsprechend Hass und Verachtung (wie der Hauptpächter Zachäus Lk 19,1 – 10).
Eine besondere Gruppe von Freien besaß zwar Freiheit (libertas) und Familienzugehörigkeit (familia), aber kein Bürgerrecht (keine civitas), weder römisches noch peregrinisches (s. o. S. 15). Es sind diejenigen Peregrinen, deren Heimatgemeinde infolge feindlicher Handlungen gegen Rom von den Römern vernichtet worden war, also nicht mehr existierte. Oder anders: die nicht versklavten Mitglieder einer Gemeinschaft, die sich den Römern nach feindlichen Handlungen ergeben musste und deren Gemeindestatus aufgehoben wurde (die sog. dediticii). Dediticii wurden die Juden nach der Zerstörung Jerusalems (endgültig 135 unter Hadrian). Da die Dediticii keiner Gemeinde angehören, auch keiner nichtrömischen, besitzen sie nirgends im Römischen Reich ein dauerndes Niederlassungsrecht. Ihr römischrechtlicher Status als Dediticii hat die Juden letztlich zum heimatlosen „wandernden Gottesvolk“ gemacht und sie überallhin in die Diaspora verstreut.
Im Jahre 212 verlieh Caracalla allen Peregrinen, außer den Dediticii6, das römische Bürgerrecht (constitutio Antoniniana). Aber nicht, dass jetzt alle dadurch steuerfrei geworden wären. Im Gegenteil hob Diocletian (284 – 305) die Steuerfreiheit Italiens auf.
Sowohl das System der Staatspacht, das die Bevölkerung einer Provinz in „Kollaborateure“ (Steuerpächter) und „Patrioten“ (ihre Opfer) spaltete, wie das der abgestuften Persönlichkeitsrechte, das die Bewohner des Imperiums in verschiedene „Güteklassen“ teilte7, entspringen dem Prinzip römischer Staatskunst: divide et impera. Teilen und Herrschen waren die Grundpfeiler der pax Romana.