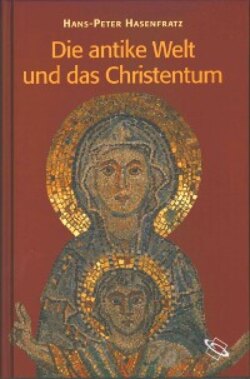Читать книгу Die antike Welt und das Christentum - Hans-Peter Hasenfratz - Страница 12
ОглавлениеII. Religiöse Fluchtwege aus der Unbehaustheit
Die Nostalgie – die Sehnsucht nach dem Gewesenen
A. Die Oberschicht und das verlorene „Goldene Zeitalter“
Unbehaustheit in der Gegenwart erzeugt immer Nostalgie nach dem Vergangenen, das mit allem verklärt wird, was die Gegenwart unerfüllt lässt. Die Literatur als Medium der Oberschicht spiegelt diese Nostalgie, denn die Dichter (sofern sie nicht vom System korrumpiert sind) waren immer die sensibelsten Seismographen ihres sozio-kulturellen Ambientes. Formal drückt sich die Nostalgie im Römischen Imperium so aus, dass man zum Sprachstil der „guten alten Zeit“ zurückgriff. Gebildete Griechen beginnen in einer Sprache zu schreiben, wie sie Griechenlands kulturelle Blütezeit (5. / 4. Jh. v. Chr.) auszeichnet (Platon, Aristophanes): Attizismus – in bewusster Distanzierung von der gesprochenen und geschriebenen Umgangssprache (Koine, in der auch die neutestamentlichen Schriften überliefert sind) und vom bombastisch-schwülstigen Stil der Höfe und hofnaher Kreise (Asianismus).
In Ägypten (der wohl am schamlosesten ausgebeuteten römischen Provinz) ging man noch weiter. Die Tempelbauten (Philae, Dendera) werden mit „Hektaren“ (Morenz 1977, 227) von altägyptischen hieroglyphischen Ritualtexten überschrieben, während Schrift und Sprache längst demotisch (koptisch) oder griechisch waren. Nostalgische Vergegenwärtigung vergangener pharaonischer Herrlichkeit in einer Epoche tiefer Demütigung! Auch lateinische Schriftsteller der Silbernen Latinität und noch mehr der Archaisierenden Periode (ab 120: Tod des Tacitus) griffen zunehmend auf das vorklassische Latein (vor Cicero) zurück: knappe bis enigmatisch reduzierte, formelhafte Sätze, Parataxe statt Hypotaxe in der Art etwa des Alten Cato oder altrömischer Gesetzestexte und Rechtsformeln. Stilistische Fiktion, die in die kleinräumigen und frugalen, überschaubaren Verhältnisse der Zeit vor der Weltherrschaft zurückversetzt und abhebt von der (gesprochenen) Gegenwartssprache, dem Vulgärlatein. Inhaltlich – und wir beschränken uns jetzt auf die lateinischen Literaten – wird Nostalgie thematisiert z. B. in Horazens Verklärung einfachen Landlebens (kräftig sekundiert von stoisch-epikureischer Selbstgenügsamkeitsideologie), in der Germania des Tacitus, der seinen römischen Zeitgenossen im Bild der Germanen, ihrer Einfachheit (simplicitas), ihrem Freiheitsstreben (libertas), ihrer Ehrliebe (honor, gloria) und ihrem Kampfesmut (fortitudo, virtus), die verlorenen altrömischen, republikanischen Tugenden vor Augen hält (vgl. Hasenfratz 1999, 10, 11 / 12).
Ist es Zufall, dass in dieser Zeit ein uralter indogermanischer Mythus wieder auftaucht: der Mythus vom verlorenen Goldenen Zeitalter9 Und ist es Zufall, dass in dieser Zeit besagter Mythus gleich in mehreren (noch zu behandelnden) Kontexten (bei der Figur des Augustus, bei den Dionysos-Mysterien, beim Eskapismus) poetisch thematisiert wird? Wir bringen den Mythus in der Fassung Ovids (Metamorphosen 1,89 ff.; Rösch 1990, 10 ff.; Auslassung von mir):
„Erstes Alter ward das Goldene. Ohne Gesetz und
Sühner wahrte aus eigenem Trieb es die Treu und das Rechte.
Fern war Strafe und Furcht, man las nicht in eherne Tafeln
Drohende Worte gereiht, es fürchtete nicht ihres Richters
Mund die flehende Schar, kein Fürsprech musste sie schützen.
Noch war die Föhre, gefällt um den fremden Erdkreis zu schauen,
Nicht von der Höh ihrer Berge hinab in die Fluten gestiegen;
Außer den eigenen kannten die Sterblichen keine Gestade.
Noch umschloss da nicht ein steiler Graben die Städte, …
Schwerter waren da nicht; und keiner Krieger bedürfend,
Lebten die Völker dahin in sanfter, sicherer Ruhe.
Unverletzt durch den Karst, von keiner Pflugschar verwundet,
Nicht im Frondienst gab von sich aus alles die Erde;
Und mit der Nahrung begnügt, die keinem Zwange erwachsen,
Las man Hagäpfel da und Bergerdbeeren, des Waldes
Kirschen und, was als Frucht an dem derben Dornengerank hing,
Las die von Juppiters lichtem Baum gefallenen Eicheln.
Ewiger Frühling war, mit lauen Lüften umspielte
Sanfter West die Blumen, die keinem Samen entblühten.
Ungepflügt trug bald auch des Bodens Früchte die Erde,
Ohne Brachen gilbte das Feld von hangenden Ähren.
Bald von Milch und bald von Nectar gingen die Flüsse,
Gelber Honig tropfte aus grünender Eiche hernieder.“
Nach allmählicher Verschlechterung (Silbernes, Ehernes) brach das
letzte, das Eiserne Zeitalter, an, das gegenwärtige:
„Da ergoss sich sogleich in die Zeit aus der schlimmeren Ader
Aller Frevel. Es floh die Scham, die Treue, die Wahrheit;
Und der Betrug, die List, die rohe Gewalt und die Tücke
Rückten an deren Platz und die böse Begier zu besitzen.
Segel gab der Schiffer den Winden dahin – die er kaum noch
Kennen gelernt – und, die solange gestanden auf hohem
Berge, die Kiele, sie tanzten auf unbekanntem Gewoge.
Und den Boden – Gemeingut bisher wie die Luft und die Sonne –
Grenzte mit langen Rainen fortan der genaue Vermesser.
Und von dem reichen Boden verlangte man nicht nur die Saat, nicht
Nur die geschuldete Nahrung: man drang in der Erde Geweide.
Schätze, die tief sie versteckt und den stygischen Schatten genähert,
Grub man hervor – dem Schlechten zum Anreiz; das schädliche Eisen
Ist schon getreten ans Licht und – schädlicher noch als das Eisen –
Auch das Gold. Da ist, dem beide sie dienen, der Krieg und
Schlägt mit blutigen Händen zusammen die klirrenden Waffen.
Nur vom Raub wird gelebt. Der Freund ist vorm Freunde nicht sicher,
Nicht vor dem Eidam der Schwäher, auch Bruderliebe ist selten.
Tod der Gemahlin droht der Mann und sie dem Gatten.
Schreckliche Stiefmütter mischen die leichenschaffenden Gifte.
Vor der Zeit schon forscht nach dem Ende des Vaters der Sohn:
Darnieder liegt die heilige Scheu, und, der Himmlischen letzte,
Jungfrau Astraea verlässt die mordbluttriefende Erde.“
Das Goldene Zeitalter ist eine Ära vollkommensten Friedens: der Menschen unter sich und zwischen Mensch und Natur. Freiwillig spendet der Boden und seine Gewächse den Menschen alles, was sie zum Leben brauchen. Immer währender Frühling herrscht (sanfter West), die Flüsse führen Milch und Honig, Honig taut die Eiche. Ungeschlagen (zum Schiffsbau) zieren Wälder die Höhen. Ungeschändet durch Pflug und Karst – Vergewaltigung von Mutter Erde durch Bodenbearbeitung galt frühen Kulturen als die Ursünde10 – trägt und gebiert die Erde. Das alles verkehrt sich im Zeitalter der „schlechteren Metallader“, des Eisens, ins pure Gegenteil. Da herrscht Krieg aller gegen alle: der Mensch wird „dem Menschen ein Wolf“. Das „verruchte Besitzstreben“(amor sceleratus habendi) zerreißt Gemeinschaften und Familien. Der Erde wird mit (instrumenteller) Gewalt die Saat abgezwungen; ihre Adern zur Metallgewinnung ausgeschlachtet, und die Ausbeute (Eisen, Gold) dient neuen Kriegen zum Fraß. Das Holz der Bergwälder ächzt, zu Schiffsplanken gefügt, in den Meereswellen (der unbarmherzige Kahlschlag bestimmt noch heute mediterrane Landschaft – und Klima!). Die Göttin der Gerechtigkeit (Dike), die „Sternenjungfrau“, verlässt schaudernd die blutgetränkten Fluren, um am Himmel als Sternbild (Jungfrau) zu leuchten.
Das Pikante an diesen Versen ist, dass sie die damalige Jetztzeit (die Zeit des Kaisers Augustus) zur schlechtesten aller Zeiten, zum Eisernen Zeitalter abstempelten. Damit traf der spottsüchtige Ovid den Kaiser, der sich zum Bringer und Vollender einer neuen Goldenen Ära (s. u. S. 37) „stylte“, ins Mark. Und es sind wohl diese Hexameter – und nicht sein mögliches Techtelmechtel mit der Kaiserenkelin Iulia, auch nicht seine frivole Liebesdichtung, die der kaiserlichen puritanischen Familienförderungspolitik (s. u. S. 108) zuwiderlief –, welche Ovid im Jahre 8 die Verbannung ans Schwarze Meer eintrugen, aus der er nicht mehr zurückkehren sollte11
.