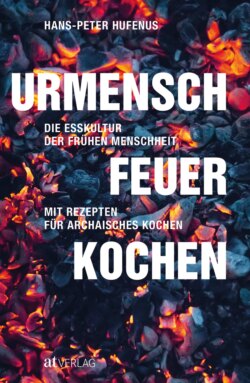Читать книгу Urmensch, Feuer, Kochen - eBook - Hans-Peter Hufenus - Страница 10
Оглавление4
TROCKEN FLEISCH – MANNA DES HIMMELS
»Oxossi – du großer Bruder aus alten Zeiten. Deinen Spuren zu folgen, dein Suchen und Finden, dein Nehmen in Maß ist mir heilig.«
Von der genetischen Ausstattung her sind wir Menschen ja nicht so gut in der Lage, rohes, frisches Fleisch zu verzehren. Und »verdorbenes« Fleisch vertragen wir auch nicht; allein beim Geruch wird uns schon übel. Unsere Mägen sind geschaffen für »abgehangenes« Fleisch, wie der Metzger sagt. Das war die absolut einmalige Nahrungsnische, die dem frühen Menschen ein riesiges Angebot bereithielt. Geübt im Blick zum Himmel und der Deutung der Rauchzeichen, ward ihm ein neues Zeichen zum Leitstern der Nahrungsfindung: der Vogelflug.
Aus Wildwestromanen und -filmen wissen wir, dass die Aasgeier schon zu kreisen beginnen, sobald ein möglicher Tod sich abzeichnet. So früh diese Vögel erscheinen, so spät erst können sie sich an dem Opfer gütlich tun. Diese Vögel müssen sich nämlich gedulden, bis beim verendeten Tier der Verwesungsprozess einsetzt.
Und genau diese Frist war nun die Stunde des Menschen. Sobald man kreisende Aasgeier gesichtet hatte, hieß es, sich zu sputen. Vielleicht war ein größeres Tier einem Unfall zum Opfer gefallen oder an einer Krankheit gestorben, oder Löwen hatten es gerissen, sich aber schnell satt gefressen und einen großen Teil der Beute liegen lassen.
Der Vogelflug verriet den Menschen, wie weit entfernt und wie groß die Beute etwa sein würde. Dementsprechend machte sich dann eine Gruppe auf den Weg, die groß genug war, möglichst viel der Beute ans heimatliche Lagerfeuer in Sicherheit zu bringen. Das waren nicht nur Männer und Frauen, sondern auch Kinder. Letztere vermochten zwar noch nicht so viel zu tragen, aber ausdauernd zu rennen. Das konnten sie, und sie tun es ja auch heute noch liebend gern, weil es in unseren Genen verankert ist. So wie das Fußballspielen. Man kann sich solch eine Gruppe in etwa wie eine Kicker-Elf vorstellen. Es gibt keinen »Chef«, der befiehlt, die Gruppe organisiert sich durch Zeichen und Zurufe und findet laufend die aktuell optimale Kooperation.
Die Notwendigkeit derart intelligenter Zusammenarbeit kombiniert mit der großen Verfügbarkeit von phosphatreicher Nahrung förderte das Hirnwachstum enorm, der frühe Homo wurde immer gescheiter. Diese Entwicklung sollte noch weiter gehen, bis trotz der Erfindung der physiologischen Frühgeburt und der elastischen Hirnschale des Säuglings durch den zu engen Geburtskanal der Frau vor einigen hunderttausend Jahren eine Grenze gesetzt wurde.
Aber zurück zu unseren Urahnen, die durch die Beobachtung des Vogelflugs zu frischem Aas geführt wurden: Vom erbeuteten Fleisch wurde nur das sofort gegessen, was roh verzehrbar war, beispielsweise die Leber. Eine zweite Tranche konnte später am Feuer gebraten und der große Rest durch Sonnen-beziehungsweise Lufttrocknen für künftige Gerichte haltbar gemacht werden. Fett konnte nicht luftgetrocknet werden, da es zu feucht ist und ranzig wird, aber man konnte es am Feuer »auslassen«; das heißt, die sich verflüssigenden und heruntertropfenden Fettanteile wurden für den weiteren Gebrauch aufgefangen. Die andere Variante war, fetthaltige Fleischteile zu räuchern, wie das heute noch mit Speck und Schinken angewandt wird. Dass diese Menschen vom frisch erbeuteten Wild Stücke herausschnitten, um sie auf dem Spieß am Feuer zu grillen, ist wohl eher ein Bild neuzeitlicher Lagerfeuerromantik.
Diese Vorstellung hatte ich auch, bis ich als Greenhorn auf einer meiner ersten Südamerikareisen eines Besseren belehrt wurde. Nach meinem Aufenthalt in Kolumbien begab ich mich nach Peru, wo ich eine Trekkingtour in den Anden leiten sollte. Da erlernte ich jene Art des Fleischgarens, die ich als den »Peruanischen Hirtenofen« bezeichne. Aus Steinen wird eine Kuppel errichtet, die man mit einem Feuer im Innern eine Stunde lang erhitzt. Die peruanischen Begleiter gaben dann Schweinefleisch hinein, bedeckten das Ganze mit Blättern und Erde und ließen es etwa eine Stunde garen. Auf diese Weise wird auch frisch geschlachtetes Fleisch zart.
Die Einheimischen nannten den Ofen »Pacha-Mama«, weil er anlässlich der Festlichkeiten zu Ehren der Erdgöttin Pacha Mama zum Einsatz kommt. Beim Pacha-Mama-Ritual werden in dieser Art Ofen die Speisen für die Gottheit gekocht. Den Andenvölkern ist dieses Ritual sehr wichtig und das Prinzip der Reziprozität ein ungeschriebenes, selbstverständliches und verbindliches Gesetz. Dieses Prinzip der Gegenseitigkeit besagt, dass das gesamte Leben darauf ausgerichtet ist, ein ständiges Gleichgewicht von Geben und Nehmen zu schaffen. Die Natur wird als Gebende erlebt, der man auch gibt.
An jenem ehernen Gesetz vermochten auch die christlichen Missionare nichts zu ändern, die ja die Lehre verbreiteten, dass der Ausgleich erst im Himmel geschähe. Die Andenvölker machten – weil eine Anpassung an christliche Dogmen für ihr Überleben dienlich schien – einfach die heilige Maria zur Pacha Mama. Dieser heiligen Maria zu dienen hieß, Achtung und Ehrerbietung sowie Speis und Trank darzubieten. Wie auch in Europa sind die Orte dieser heiligen Gottheit in Peru offiziell die vielen Kirchen mit Namen wie »Kirche unserer Mutter des heiligen Herzens« (Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón) und viele andere. Die werden an Sonntagen von den Gläubigen gehorsam aufgesucht. Aber wirklich verehrt wird Pacha Mama bei Naturheiligtümern: Bergen, Felsen, Steinen.
Im westlichen Denken und religiösen Handeln gibt es keine heilige Natur mehr, für deren Gaben man sich bedanken sollte. Und die »Reziprozität« unter den Menschen selbst wird über das Geld geregelt. In meiner Kindheit hatte ich – weil so gelernt und gesehen – die Idee, dass das Opfer darin besteht, beim Kirchenbesuch ein paar Münzen in einen »Opferstock« zu geben.
Als Südamerika-Novize war auch ich weit davon entfernt, eine Idee von dieser ursprünglichen Form der Reziprozität zu haben. Ziemlich verlegen stocherte ich im gebratenen Meerschweinchen herum, das die Gastgeberfamilie unserer einheimischen Begleiter extra für mich brieten und an einem einsamen Tischchen vor einer Wand servierten, während die Familie in der Küche sich mit einem frugalen Mahl beschied. Ich war ja während der Vorbereitungen für die Trekkingtouren allein unterwegs und konnte da auch viele Rucksacktouristen erleben, die im Glauben an eine grenzenlose Gastfreundlichkeit der Einheimischen mit ziemlich wenig Geld herumreisten, da die Indigenen gar nicht die Idee hatten, dass ihr Angebot an Essen und Unterkunft mit Geld abgegolten werden könnte. Aber die westlichen Touristen hatten ja nichts anderes zu geben. Inzwischen haben die Einheimischen dazugelernt und wissen nun, zum Ärgernis mancher Besucher, sehr wohl, eine hohle Hand für Geld zu machen.
Nun muss man natürlich sehen, dass es sich bei Andenbewohnern ja längst nicht mehr um reine Naturvölker handelt. Schon vor Ankunft der Europäer waren große Gebiete längst keine Sammlerkulturen mehr, sondern hierarchisch gegliederte Reiche mit einer privilegierten Elite, die sich auf eine auf Sklavenarbeit beruhende Agrarwirtschaft stützte und deren Opfergaben an die Götter Menschen, vorzugsweise auch Kinder waren. Die ankommenden Spanier setzten der Gewaltherrschaft noch eins drauf, plünderten die Schätze, töteten die Männer und unterwarfen die Frauen. Die Nachkommen nennen sich heute Ecuadorianer, Peruaner, Bolivianer. Aber die alten hierarchischen Herrschaftsreiche der Inkas, der Mayas, der Azteken und so weiter waren damals noch nicht flächendeckend, und es lebte außerhalb der Ballungszentren weiterhin ein großer Teil der Menschen eine Sammler-Jäger-Kultur, deren kulturelles Erbe auch noch lebendig ist und die viele westliche Touristen anlockt. Eine sogenannte »Abenteuerreise« nach Südamerika hatte deshalb immer zwei Komponenten zu enthalten: einerseits den Besuch der Stätten der alten Hochkulturen und andererseits eine Trekkingtour in einem Wildnisgebiet mit Kontakt zu Einheimischen, die als indigen wahrgenommen wurden.
Nach und nach lernte ich auf meinen vielen Reisen zu differenzieren, was kulturell eher den Wildbeutern zugehörig ist und welche Gepflogenheiten mehr den späteren Ausbeutern zuzuschreiben sind. Einfach war das keineswegs.
»Auf einem alten Goldgräberpfad über die Anden bis hinunter in den Urwald«: So war die Reise ausgeschrieben, die ich in Bolivien erkundet hatte und dann leitete. Es war eine Reise, auf der alles schiefging, was nur misslingen konnte. Schon die Ankunft in La Paz war ein Desaster. Der Flieger landete um ein Uhr nachts. Es war verdammt kalt fast 4000 Meter über dem Meeresspiegel, und wir steckten nicht gerade in den wärmsten Kleidern. Ein ziemlicher Nachteil, wenn man in das Hotel nicht eingelassen wird, weil es belegt ist. Ich hatte bei der Buchung nicht bedacht, dass ein Uhr nachts ja mit dem Datum des Vortages hätte beginnen müssen. Wenigstens gab es dann einige Traveller, die früh aufbrachen, und nach und nach konnten wir unsere Zimmer beziehen.
Am nächsten Tag ging es dann per Bus zum Titicacasee und weiter zu einer Landstadt namens Sorata. Dort empfing uns der von mir kontaktierte Organisator mit der Bemerkung, es sei »alles« für uns organisiert, es fehlten »nur« noch die Tragtiere …!
So starteten wir denn unsere Trekkingtour vorerst ohne die Lastenträger, das Gruppengepäck konnte mit einem Geländewagen auf einer Schotterstraße bis zu einem kleinen Dorf jenseits der Passhöhe transportiert werden, dort würden wir dann Tragtiere finden. Es gelang, einen kleinen Trupp von Einheimischen mit Maultieren für die nächsten vier Tage zu buchen. Danach gäbe es in einem Goldgräberdorf wieder Geländefahrzeuge, die Transporte hinunter bis zum nächsten Urwaldfluss durchführen würden.
Der Goldgräberpfad ist ein alter, steinbelegter Fußweg, der die Anden durch alle Vegetationsstufen bis hinab ins Amazonasbecken führt. Beginnend in der kalten Einöde, begegnet einem bei der Wanderung durch den Wolken-, den Nebel- und zuletzt den Regenwald bei fast jedem Schritt eine neue Pflanzenart. Vereinzelt trifft man einfache Hütten auf dem Weg, an den gegenüberliegenden Hängen hier und da kleine Rodungen, Spuren der Goldgräber, die ihr Glück suchen.
Den ersten Tag mit den Tragtieren gingen wir so lange, bis es wieder Bäumchen und damit Brennholz zum Kochen gab. Es war eine etwas eigenartige Stimmung, während wir als Reisegruppe gemeinsam aßen und die Einheimischen etwas entfernt hockten und uns nur zuschauten. Vor dem Schlafengehen baten sie mich, ihnen den Lohn für den einen Tag schon auszuhändigen.
Am nächsten Morgen waren sie dann verschwunden, sie hatten sich klammheimlich nachts aus dem Staub gemacht; und mir dämmerte allmählich, dass wir sie wahrscheinlich hätten zum Essen einladen sollen. Ich war ja gar nicht auf die Idee gekommen, war das in Nepal doch ganz anders. Da nahmen die Begleiter jeweils ihr Essen selbst mit und aßen separat. Kurzum, wir hatten keine andere Wahl, als das gesamte Gepäck nun selbst zu tragen. Zum Glück war die Gegend nicht völlig unbesiedelt, und es gelang uns, ab dem zweiten Tag mal einige Träger, mal ein Maultier anzuheuern und schlussendlich ohne weitere Pannen in Guanay anzukommen, von wo aus die Reise per Boot auf dem Río Mapiri weiterging.
Um die Flussreise attraktiv zu gestalten, schlug uns der Bootsführer vor, weiter unten einen Nebenfluss hinaufzufahren zu einem verborgenen See im Urwald. Das ließen wir uns natürlich nicht entgehen. Erst ging es noch ziemlich flott, aber dann folgte eine erste Untiefe, an der uns nichts anderes übrigblieb, als aus dem Boot zu steigen und zu schieben. Es blieb nicht bei der einen, und mit jeder weiteren Untiefe sank die Stimmung der Gruppe, bis wir den Punkt erreichten, dass einige zu murren begannen.
Es war wie ein Wunder, dass ich sie zum Weitermachen motivieren konnte mit dem Versprechen, dass wir bei Ankunft am See ein Wildschwein braten würden. Und das Wunder geschah, nach einigen Minuten kam uns ein Boot entgegen, in dessen Rumpf tatsächlich eine erlegte Sau lag; und die Jäger waren sogar bereit, sie zu verkaufen.
Bald darauf erreichten wir unser Etappenziel. Während unsere Begleiter sich an die Zerlegung des Schweins machten, bauten wir aus grünen Holzstämmchen einen Grillrost, unter dem wir ein kräftiges Feuer entfachten. Leider wurde der Braten nicht richtig gar, und je länger wir die Stücke auf dem Grill ließen, desto zäher wurden sie. Daher gestaltete sich unser Abendessen als etwas anstrengend.
Rurrenabaque hieß die Ortschaft, die wir nach ein paar weiteren Tagen auf dem Río Mapiri und später auf dem Río Beni erreichten. Von dort aus sollte uns ein Flugzeug zurück nach La Paz bringen. Die planmäßige Ankunft des Fliegers aus La Paz wurde mir im örtlichen Office bestätigt, doch als wir am nächsten Tag zum Flugplatz wollten, war weit und breit kein Taxi zu finden. Das einzige Fahrzeug in der Ortschaft war ein Lastwagen, von dem gerade Ziegel ausgeladen wurden. Glücklicherweise willigten die Arbeiter ein, dass wir ihnen beim Abladen helfen und sie uns dafür und gegen ein Entgelt zum Flughafen fahren würden. Das musste aber schnell gehen, und es war der Einsatz der ganzen Reisegruppe gefragt. Das Flugzeug zu verpassen wäre ein Drama gewesen, da ich den Rückflug nach Europa schon für den nächsten Tag gebucht hatte.
Trotz all der Schwierigkeiten verlief die Reise alles in allem nach Programm, und die Teilnehmer kamen wohlauf nach Hause. Aber ich rechnete mit dem Schlimmsten, Reklamationen und damit der Gefahr, meinen Job zu verlieren. Doch es kam anders. Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren durchaus positiv; und einer von ihnen verfasste sogar einen handgeschriebenen Brief, in dem er kundtat, dass ihn diese Reise tief bewegt hätte und er jetzt sein Leben verändern würde. Ich hatte keine Ahnung, was genau der Anlass dazu war; ich vermutete die Wirkung des einfachen Unterwegsseins mit einer Menschengruppe in einer Urlandschaft. Das war eine Offenbarung für mich, die Geburtsstunde einer neuen Tätigkeit, die sich dereinst Erlebnispädagogik nennen sollte. Aber das ist noch Zukunft – und es brauchte noch viele weitere Erfahrungen bis zum Erkennen des Grundprinzips, das Menschen bewegt und motiviert: das Erleben von Kooperation.
In der Kooperation sind wir ganz Mensch, weil wir genetisch so angelegt sind. Zwei Millionen Jahre wandten wir dieses Modell erfolgreich an. Und zwar nicht nur innerhalb unserer Spezies, sondern auch zwischen uns und der Natur. Wie gesagt schauten unsere Ahnen ehrfürchtig den Blitzen zu und lauschten dem Donner. Mächtige Kräfte des Himmels, oft bedrohlich, aber auch großzügig. Ihnen verdankten die Menschen reichliche Mahlzeiten. Und sie verdankten ihnen auch das Feuer, das sie zu kultivieren lernten. Der geschulte Blick zum Himmel ermöglichte ihnen die genaue Lokalisierung von frisch gestorbenen Tieren, ihre Fähigkeiten des ausdauernden Rennens und der kooperativen Organisation das Einholen reicher Beute. Und die Aasgeier ihrerseits kamen so leichter an die Überbleibsel, weil sie von den Menschen schon aufgeschnitten waren. Jetzt galten nicht mehr Donner und Blitz als die Himmelskräfte, die Nahrung brachten, sondern die Vögel, und das Verhältnis mit diesen entwickelte sich zu einem des gegenseitigen Gebens und Nehmens.
Die Nutzung des Feuers brachte dem Menschen nicht nur eine große Erweiterung des Nahrungsangebots, sondern reduzierte darüber hinaus gewaltig die Gefahr, selbst Nahrung für andere zu sein. Der Mensch war nicht mehr Teil jener Balance unter den Lebewesen, die dem Gesetz des Fressens und Gefressenwerdens unterlag. Das führte zu einem so großen Bevölkerungswachstum, dass mit der Zeit das vorhandene Angebot von Aas für die Ernährung nicht mehr ausreichte, und so begannen die Menschen, die Tiere auch aktiv zu töten, sie wurden zu Jägern. Diese frühen Jägertruppen machten mit ihren Holzspeeren mit Vorliebe Jagd auf Großwild. Großwild war gutmütig und schwerfällig und leichter in eine Falle zu treiben als kleinere Tiere. Die Beute reichte für eine ganze Sippe, und das über Wochen.
Das Feuer ermöglichte die Weiterverarbeitung des Erbeuteten, während es gleichzeitig Schutz vor Raubtieren bot – und durch seinen Schein erhellte es die Nacht im Umkreis der Gruppe und brachte somit einen weiteren Gewinn gegenüber der Tierwelt: die Verlängerung des Tages. Nach Verrichtung des Tagewerks kauerten sie nun abends rund ums Feuer und ließen den Tag Revue passieren – die Menschen wurden zu Geschichtenerzählern.
Das war nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich. Das Erinnern und Teilen von Erfolgen und Missgeschicken ermöglichte ihnen eine neue Lernform. Durch die aus der geteilten Erfahrung gewonnenen Erkenntnisse konnten sie ihre Strategien optimieren und so beim nächsten Jagdausflug das Spiel von »Versuch und Irrtum« durch geplante Aktionen mit möglichst viel Erfolg mit möglichst kleinen Verlusten beeinflussen.
Noch gab es kein Spezialistentum, zum Jagdtrupp gehörten Frauen, Männer und Kinder. Nachdem die Menschen gelernt hatten, die Zeichen am Himmel zu lesen, kam mit der Einführung der Jagd die Fähigkeit dazu, die Zeichen auf der Erde zu interpretieren. Statt den Waldbränden und den Aasgeiern folgten sie nun direkt den Tierherden. Sie studierten deren Wander- und Sozialverhalten, feilten an Strategie und Taktik und übernahmen zwangsläufig auch deren Migrationsverhalten. Die Erfolge aufgrund der sich immer mehr verfeinernden Kommunikation und Kooperationskompetenzen, die sich ja nicht nur auf die Nahrungsbeschaffung auswirkten, sondern auch auf die Schutzstrategien gegenüber Feinden, führte zwangsläufig zu einem weiteren enormen Bevölkerungswachstum, das die Menschen bereits früh durch Auswanderung in andere Kontinente drängte. Schon vor 1,7 Millionen Jahren erreichten die ersten Homines China und Indonesien.
Die Kenntnisse in der Handhabung von Feuer begannen sie auch für die Jagd einzusetzen, indem sie bewusst Brände legten, um die Tiere in Richtung natürlicher Fallen wie Sümpfe oder Klippen zu lenken. Vielleicht geschah so zum ersten Mal, dass mittels dieser Techniken die Menschen mehr erbeuteten, als sie zu verbrauchen in der Lage waren. Damit wurde aber auch der alte Pakt mit der Natur gebrochen, der das Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben regelte. Die »edlen Wilden« entwickelten eine erste Untugend, die Unmäßigkeit. Die Menschen hatten so zwar ihre Unschuld verloren, aber gleichzeitig konnten sie dank ihrer Fähigkeit zur Reflexion ein Gegengewicht schaffen. Sie entwickelten Opferrituale und Speisetabus; mit anderen Worten: Sie wurden religiös.
Ist nicht die uns allen bekannte biblische Paradiesgeschichte die eines Tabubruchs? Nicht zu essen von der Frucht eines bestimmten Baumes als Gebot, das von den Menschen gebrochen wurde? Geschehen in einer schon frühagrarischen, patriarchalen Welt, der Mann nur wenig schuldig, die Verführerin eine Schlange, die Schuld am Tabubruch bei der Frau?
Viele Mythen und Sagen, auch solche, die auf die lange Sammler-Jäger-Zeit verweisen, erzählen vom Tabubrüchen, zum Beispiel die folgende.
So wie jeder Tag seine Nacht braucht und jede Bewegung ihre Ruhe, so gab es in frühen Zeiten Tage, an denen Menschen, auch die Orixás, einfach ruhten oder ihre Aufmerksamkeit ganz einem Ritual, einem Platz oder einem bestimmten Orixá widmeten. Diese Geschichte erzählt von einem Tag, der Orunmila gewidmet war und an dem alle von ihren Gewohnheiten abließen, um Orunmila die Ehre zu erweisen.
Daran hielten sich fast alle, aber Oxossi, jung und ungestüm, wollte jagen, wie er es jeden Tag machte. Er legte keinen Wert auf diese Gebote und ging wie immer ruhig auf die Pirsch, dem Waldpfad folgend. Mit wachen Sinnen und hellen Ohren hörte Oxossi ein Lied: »Ich bin nicht Vogel, um durch dich getötet zu werden …« Weit und breit war kein Vogel zu sehen, doch da erblickte er plötzlich eine Schlange! Instinktiv und zielsicher tötete Oxossi die Schlange mithilfe seines Speers und zerteilte sie.
»Ich bin nicht Vogel, um durch dich getötet zu werden …«, klang es wieder durch den Wald, und auch jetzt konnte er keinen Vogel erspähen. Zu Hause angekommen, bereitete er sich jedoch mit seiner Beute ein köstliches Mahl.
Als Oxum am nächsten Tag ihren Freund und Geliebten Oxossi besuchte, fand sie ihn tot am Boden liegend. An seiner Seite sah sie die Spur einer Schlange, die sich bis zum Waldrand dahinzog. Oxum kannte Oxossi, sie ahnte, was ihm widerfahren war; sie suchte Orunmila auf und brachte ihm viele Geschenke. Sie bat und beschwor ihn; und angesichts der Klage der trauernden Oxum ließ er Oxossi unter einer Bedingung wieder zum Leben erwachen: Er müsse fortan der Beschützer der Jäger sein und sie in das Gesetz des rechten Maßes einweihen. So war es, und so wurde Oxossi zum Orixá.
Oxossi führte in diesem Mythos einen Speer mit sich, das ist jene Waffe der Frühmenschen, die sie zur Jagd auf Großwild brauchten. Das Lied wurde zwar von der Schlange gesungen, aber der Liedtext spricht vom Vogel. In der Gestalt des Aasgeiers war der Vogel ein erster Kooperationspartner der Natur und belegt Platz eins unter den Hütern des alten Pakts der Reziprozität, eines Pakts, über dessen Einhaltung nun der zum Orixá gewordene Oxossi wacht und deshalb seinen Platz zwischen der Welt der Tiere und der Welt der Menschen innehat.
REZEPT
CARNE DE SOL
Das Fleisch für diese Zubereitung wird nicht, wie es der Name andeuten könnte, an der Sonne getrocknet, so wie es das Bild aus Afrika zeigt. Fleisch, das an der Sonne getrocknet wird, muss völlig fettfrei sein. Nicht so beim »Carne de Sol«, einer traditionellen Zubereitungsart aus dem Nordosten Brasiliens. Das Besondere daran ist, dass Frischfleisch trotz des tropischen Klimas auf diese Art für mehrere Tage haltbar gemacht werden kann, ohne sein saftiges Inneres zu verlieren. Es handelt sich also um eine uralte Konservierungstechnik.
Zutaten: 1 kg Rumpsteak, 3 Esslöffel grobes Meersalz, 1 Teelöffel brauner Zucker; Bratbutter, Zwiebeln, Salz.
Das Fleisch wird dafür in daumenbreite Stücke geschnitten, mit der Mischung aus Salz und Zucker eingerieben und an einem gedeckten, aber gut durchlüfteten Ort einige Tage gelagert. Dabei trocknet nur die äußere Schicht, innen bleibt das Fleisch saftig.
Nachdem das Salz abgewaschen und das Fleisch in klarem Wasser eingeweicht worden ist, kann es wie Frischfleisch verwendet werden, zum Beispiel am Feuer gegrillt oder zum typisch brasilianischen Gericht »Carne encebollada« verarbeitet werden. Das geht ganz einfach: Das Fleisch in kleine Stücke schneiden und anbraten. Aus der Pfanne nehmen. Zwiebeln in große Stücke oder Ringe schneiden und glasig braten. Zum Schluss das Fleisch wieder dazugeben und salzen.