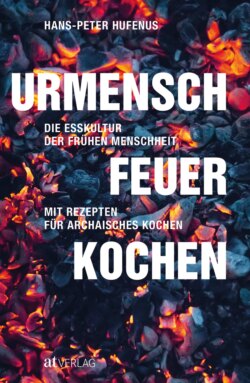Читать книгу Urmensch, Feuer, Kochen - eBook - Hans-Peter Hufenus - Страница 9
Оглавление3
KNOCHENMARK – DAS SALZ DER ERDE
»Xangô – du Mächtiger! Feuer bringen deine Blicke. Deinen Tanz in Kraft und Ruhe willkommen heißen schafft Räume weiser Ordnung.«
Schon lange lebten die Menschen zusammen mit den anderen Tieren, den Steinen, den Pflanzen und mit der Erde, die, mal heiß, mal feucht, dann wieder trocken und kalt, vieles für sie bereithielt. Neugierig waren sie und auf ihre Art immer bereit für ein Schwätzchen mit allen rundherum; und doch wussten sie noch nicht, wie ein Feuer zu machen sei, und noch weniger, wie man kocht. Eines Tages jedoch begann ihnen ihre Nahrung schwer im Bauch zu liegen, und auch der Austausch mit der sonst so lebendigen Welt der Orixás rund um sie herum wurde mühsam.
So gingen sie zur Kreuzung von Exú und baten diesen um Hilfe. Wenn jemand weiterwusste, dann er, das spürten sie. Sie warteten drei Tage und drei Nächte, ohne dass ein Zeichen gekommen wäre. Aber dann hörten sie ein Geräusch im Wald. Es waren Bäume, die über ihnen lachten, indem sie ihre Äste aneinanderrieben. Den Menschen gefiel dieses Spiel überhaupt nicht, und sie riefen nach Xangô, dass er ihnen helfe und Blitze über die Bäume sende.
So geschah es! Von den in Brand gesetzten Bäumen fielen Teile auf die Erde und verbrannten, bis nur die glühende Kohle blieb. Das gefiel den Menschen, und sie begannen die Glutstücke zu sammeln, mit Holzspänen und Erde zu bedecken. Sie waren eben verspielt und neugierig und dachten sich nicht so viel dabei. Nach einiger Zeit machten sie das Hügelchen auf und fanden schwarze Stücke. Und als sie diese Teile (die wir heute Kohle nennen) gemeinsam mit den Glutresten zwischen Steine legten, blies zuerst der Wind hinein, bis sich ein Feuer entzündete. So inspiriert und beschützt durch Xangô – und seine Windfreundin Iansã –, erfanden die Menschen das Feuer, den Herd und das Kochen. Und sie kochten und aßen und teilten, das war gut für sie und die Orixás.
Von einem Tag auf den anderen hat sich dieser Übergang natürlich nicht vollzogen. Wie viele Entdeckungen, die dem Menschen zugeschrieben werden, wurde auch diese zuvor schon von anderen Lebewesen gemacht. So ist auch von Landtieren und vor allem Vögeln bekannt, dass sie gelegentlich Nahrung aus von einem Waldbrand heimgesuchten Landstrichen besorgen. Aber dank dem Rückgang der Körperbehaarung und der damit verbundenen größer gewordenen Fähigkeit zu schwitzen konnten sich diese Menschen näher als ihre befellten Ahnen an ein Feuer wagen.
Etwas rätselhaft an dem hier wiedergegebenen Mythos ist die Stelle, an der die Bäume »lachten«, indem sie ihre Äste aneinanderrieben. Wie wir wissen, kann durch das Aneinanderreiben von trockenen Hölzern auch ein Feuer entfacht werden. Nur, diese Technik begannen die Menschen erst viele hunderttausend Jahre später einzusetzen. Und auch die Kunst, Kohlestücke zu platzieren und mit Glutstücken zu entfachen, entdeckten sie erst später. Zunächst beschieden sie sich damit, in von Blitzen in Brand gesetzten Wäldern gekochte beziehungsweise gebratene Nahrung aufzustöbern.
Keinen »Pelz« mehr zu haben hatte in Afrika auch einen Nachteil. Das menschliche Wesen wurde anfällig für Sonnenbrand und Insektenstiche. Doch es wusste diesen Nachteil in einen Vorteil zu verwandeln. Dank seines aufrechten Gangs entwickelte es die Fähigkeit des »Joggens«. Da es wegen des fehlenden Haarpelzes über eine herausragende Schwitz- und damit Abkühlfähigkeit verfügte, konnte es ausdauernder laufen als alle anderen Lebewesen, und es vermochte so, weite Strecken schneller zurückzulegen als sie. Gegen den Sonnenbrand schützte sich das Wesen durch die Änderung seiner Hautfarbe in Schwarz, was später einmal als »Rassenmerkmal« definiert werden sollte. Gegen Insektenstiche entwickelte es eine so starke Abneigung, dass es lernte, Mücken- und Tsetsefliegen-Gebiete zu meiden und somit gleichzeitig den mit diesen Insekten verbundenen Krankheitserregern auszuweichen.
In jenen Zeiten waren die feuchteren Landstriche unseres Planeten primär mit Wald, die trockeneren Gebiete mit Savanne oder Steppe bedeckt. Wald- und Steppenbrände galten damals noch nicht als »Naturkatastrophen«, sondern als normaler Bestandteil der Wachstumskreisläufe. Meist durch Blitzschlag verursacht, brannte es immer irgendwo. Und dies machte sich der Erectus zunutze. Der Blick zum Himmel sagte diesen Menschen, ob ein Gewitter kam, und aufgrund des aufsteigenden Rauchs sahen sie, wo ein Brand entfacht war. Sie eilten dann auf die windabgekehrte Seite der Brandgebiete, und dort fanden sie in der Glut gegarte essbare Nahrung. Falls sich der Wind drehte und das Feuer plötzlich in die eigene Richtung kam, nutzten sie ihre Fähigkeit des ausdauernden Rennens, um dem Feuer auszuweichen. Nach und nach verlor der Mensch – als einziges Lebewesen – die Angst vor dem Feuer, es wurde ihm ein Freund, der ihnen köstliche und verträgliche Nahrung versprach.
Das Trinken aus der hohlen Hand ist eine der schönsten Gesten der menschlichen Gattung (hier ein Homo heidelbergensis). Im Hintergrund ein kleines Wildfeuer, vermutlich von einem Blitz entfacht, das Nahrung verspricht.
Anders als beim Australopithecus, dessen Wanderungen sich auf jenen Raum beschränkten, der genügend Früchte, Nüsse und essbare Pflanzen bereithielt, erlebte der Homo erectus eine enorme Reichweitenvergrößerung. Dank der sich stetig fortentwickelnden Fähigkeiten der Fernsicht, des ausdauernden Wanderns und der intellektuellen Kapazität erweiterte sich seine Welt um ein »Jenseits des Horizonts«, ein »Jenseits des Sichtbaren«. Blitz und Donner waren nicht mehr nur bedrohlich, sondern auch ganz pragmatisch nutzbare Botschaften. Das Lesen der Rauchzeichen am Himmel befähigte den Erectus schließlich, seine Schritte dahin zu lenken, wo Nahrung zu finden wäre.
Neben den nahrhaften Knollengewächsen, von denen viele ungekocht schwer verdaulich, ungenießbar oder gar giftig gewesen wären, kam einem Nahrungsmittel für die frühen Menschen eine zentrale Bedeutung zu, nämlich dem Knochenmark. Mit dem Faustkeil, einem Werkzeug, das zwei Millionen Jahre lang das »Multitool« der Frühmenschen war, wurden die Knochen von in Bränden umgekommenen Tieren aufgebrochen, um das schmackhafte Mark zu verspeisen.
Das phosphatreiche Knochenmark und die leichtere Verdaulichkeit gekochter Nahrung verhalf der menschlichen Evolution zu der grundlegenden Entscheidung: weniger Darm – mehr Hirn. Knochenmark ist das Anabolikum des Gehirns, das sich in den zwei Millionen Jahren um ein Dreifaches vergrößerte. Die Hirntätigkeit der Menschen verbrauchte nun ein Viertel der Energie, während das Rennen sie nicht mehr Energie kostete als das Gehen. Die zwei Millionen Jahre reichten aber auch, um in den Genen eine Abhängigkeit von salzhaltiger Nahrung – denn das war das Knochenmark – festzulegen. Seither entwickelt der Mensch, wenn er keine Salzzufuhr erhält, Entzugssymptome.
Neben dem Knochenmark mussten die frühen Menschen auch die Blutwurst entdeckt haben. In den Adern der in Bränden umgekommenen Tiere fand sich gekochtes und geronnenes Blut, das ebenso salzig wie das Knochenmark und durchaus genießbar war.
Eine der ersten warmen Mahlzeiten der Menschheitsgeschichte war möglicherweise auch die Schildkrötensuppe. Auf der hastigen Flucht vor dem Buschbrand war irgendwann eine Schildkröte im Gehölz umgekippt und lag hilflos auf dem Rücken. Im eigenen Panzer gekocht und in der Glut warm gehalten, wurde sie früher oder später entdeckt. Irgendwann gab dann ein Mensch in so einen Schildkrötenpanzerinhalt vielleicht zusätzlich Wasser, salziges Knochenmark und eventuell eine Zwiebel: Der Geschmack muss umwerfend gewesen sein, und der erste Maître de Cuisine war geboren.
Busch- und Waldbrände stellten also für den Erectus eine Art wandernde Küche dar, der er dank seines geübten Blicks zum Himmel folgen konnte. Da es je nach verbranntem Material unter der Asche noch tage-, ja wochenlang glimmen konnte, dürften die Menschen auch noch eine Weile nach dem durchgezogenen Wildfeuer auf warme Nahrung gestoßen sein. Wenn sie dann mit ihren Stecken durch den Untergrund stocherten, stellten sie auch fest, dass eine verborgene Glut wieder zu einem Feuerchen entfacht werden konnte, vor allem wenn ein Windstoß hineinblies. Und sie entdeckten, dass sich Glut verschieben lässt. Vielleicht lernten sie auch, kurzzeitig über glühende Kohlen zu gehen – als Vorläufer des heutigen »Feuerlaufens«, das eigentlich »Glutlaufen« heißen sollte. Die Füße verbrannten sie sich dabei auch deshalb nicht so schnell, weil sie als Aufrechtgeher eine robuste Hornhaut entwickelt hatten.
So waren diese Menschen als Gruppe unterwegs, ihre Ausrichtung dorthin, wo Nahrung lockte, ihre Heimat da, wo sie sich niederließen: an einem Gewässer am Rande von verbrannter Erde. Natürlich nahmen sie weiterhin auch jene Speisen zu sich, die sie von früher her kannten: Früchte, Nüsse und Beeren. Aber die neue gekochte Nahrung gab ihnen so viel Nährwert mit so wenig Verdauungsaufwand, dass sie kein Interesse mehr hatten, zum früheren Leben zurückzukehren. Ein Zurück auf die Bäume war ohnehin nicht mehr möglich, die Entscheidung für lange Beine und kurze Arme unumkehrbar.
Damit entfiel aber der Schutz der Bäume vor Raubkatzen und anderen Feinden, die ihre Verwandten aus der Primatenfamilie sich noch zunutze machen konnten. Umso mehr waren sie angewiesen auf ein dichtes Zusammensein in der Gruppe. Faustkeil und Stecken waren noch keine sehr wirksamen Waffen, höchstens für Drohgebärden.
Es stärkte den Gruppenzusammenhalt, wenn die gefundene Nahrung egalitär verteilt wurde, und die Kommunikation untereinander wurde differenzierter: Wohin gehen wir, wo bleiben wir, was macht das Wetter? Noch war die Sprache nicht so entwickelt wie beim späteren Sapiens. Kommuniziert wurde überwiegend »nonverbal« über eine reiche Gestik und Mimik, über Laute und den gesamten Körperausdruck.
Aus der Primatenforschung wissen wir, dass ein einziger Laut bis zu sechzig Bedeutungen haben kann, je nach zugehörigem Körperausdruck, vor allem jenem des Gesichts und der Hände – Grimassen und Gestikulieren. Gegenüber den Primaten pflegten die frühen Menschen dank ihres leistungsstarken Großhirns einen immensen Informationsaustausch; die Entwicklung der komplexen Sprache war nur noch eine Frage der Zeit; es brauchte lediglich die dafür notwendige Positionsveränderung des Kehlkopfes.
Wie der Anthropologe Michael Tomasello in seinem Buch Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation aufzeigt, hat sich gerade auch deswegen unsere Fähigkeit entwickelt, zusammenzuarbeiten, gemeinsam zu planen und zu teilen.5 Tomasello sieht da den großen Unterschied zwischen Menschen und Primaten. Er meint, wenn Schimpansen auf etwas zeigen, heiße dies, dass sie das bestimmte Objekt haben wollen. Doch wenn ein Kleinkind auf einen Hund zeige, der gerade vorbeigehe, dann sei das keine Aufforderung, ihm diesen Hund zu bringen. Nur wenn der Erwachsene abwechselnd auf das Kind und den Hund blicke und dabei emotional positiv reagiere – »Was für ein schöner Hund, ist der nicht toll!« –, sei das Kind zufrieden. Denn jetzt sei ein gemeinsamer Aufmerksamkeitsrahmen entstanden, eine geteilte Welt.
Dazu müssen die Menschen nicht einmal miteinander reden, sie können es einander an den Augen abschauen. Deshalb – meint Tomasello – hat uns die Evolution mit Augen ausgestattet, an denen auch der weiße Teil des Augapfels sichtbar ist. So erkennen wir gegenseitig, wohin wir schauen. Wir folgen sozusagen den Augen der anderen. Bei unseren dunkelhäutigen Vorfahren war das noch deutlicher sichtbar.
Ob diese frühen Menschen schon ein Gefühl der Dankbarkeit entwickelten, können wir nicht wissen. Auf jeden Fall waren es ja nicht sie, die das Essen kochten, sondern die Natur: der Blitz, das Feuer, der Wind. Wir wissen aber, dass noch viel Zeit verstreichen sollte, bis die Menschen tatsächlich in der Lage waren, den Göttern ein warmes Mahl zu bereiten.
Die neue Nahrungsquelle war so reichhaltig, dass sich Menschen auf einmal verstärkt zu vermehren begannen, während ja die Population ihrer Vorfahren, der Australopithecinen, über fünf Millionen Jahre mehr oder weniger gleich blieb. Und so kam man nicht umhin, sich früher oder später wieder etwas einfallen zu lassen, um die vielen hungrigen Münder stopfen zu können.
Nach den Tausenden Jahren Erfahrung mit der Nahrungssuche in der Glut, dem Herumstochern, dem Holzauflegen, dem Reinblasen, war es nur noch ein Schritt zur Entwicklung der Kunst des Gluttransports. Diese neue Möglichkeit, Glut in pflanzlichen oder tierischen Hartschalen oder Beuteln an einen anderen Ort zu transportieren, zu konservieren und wieder neu anzublasen, war ein riesiger Entwicklungsschub, denn jetzt wurden die Menschen unabhängig von Waldbränden, und sie konnten sich eine neue Nahrungsquelle erschließen: Aas.
REZEPT
KNOCHENMARK
Ganze Rinderknochen (Oberschenkel) in die Glut geben. Nach 20 Minuten die Knochen mit einem Stein aufschlagen und das Mark herausnehmen. Mit Meersalz würzen.
Eine etwas weniger archaische Variante ist: Die Knochen vom Metzger längs durchsägen lassen. Die Enden sollen aber dranbleiben, weil sonst das Mark beim Erhitzen auslaufen würde. Die Knochenhälften 20 Minuten in 80 Grad heißes Wasser geben, um das Mark zu garen. Dazu passt getoastetes Brot.
In prähistorischen Feuerstellen fanden Archäologen immer wieder aufgeschlagene Knochen als Nahrungsreste. Knochenmark muss unter unseren Urahnen eine weit verbreitete Delikatesse gewesen sein.