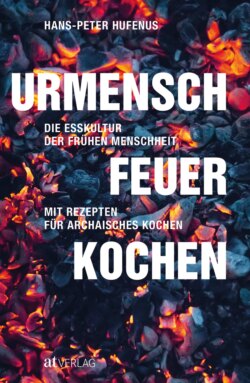Читать книгу Urmensch, Feuer, Kochen - eBook - Hans-Peter Hufenus - Страница 8
Оглавление2
BLÄTTER – BELEBEND, HEILEND, BERAUSCHEND
»Ossain – du in den Blättern der tiefen Wälder Tanzender. Kundiger der tausend Säfte, ihrer Heilkunst, ihres Zaubers.«
War es der Kasperle, der krank war, oder die Prinzessin? Ich erinnere mich nicht, wer wem die Heilkräuter überreichte und ob die Hexe mit im Spiel war. Aber die Szene zog meine Kinderseele in den Bann. Dabei war es weniger die Inszenierung als vielmehr die Pflanzen. Während die Figuren aus Holz und Stoff waren, hatten die Vorführenden echte Blätter aus dem Garten genommen. Ich sehe sie noch heute deutlich vor mir: ein Bündel echter, saftig grüner Blätter.
Wieso mich diese Szene so berührte, verstand ich nicht gleich. Aber eigenartigerweise sprach ich auch mit niemandem darüber, weder mit den anderen Kindern noch mit meinen Eltern. Und so erfuhr ich natürlich auch nicht, um welche Pflanze es sich handelte: Es könnte Bärlauch gewesen sein oder aber Maiglöckchen oder Herbstzeitlose.
Heute wüsste ich es, und auch wie wichtig es ist, diese drei Pflanzen, die so ähnlich ausschauen, zu unterscheiden, sind doch die letzteren beiden für den Menschen giftig. Das Interesse für Wildpflanzen und ihre Nutzbarkeit wurde erst im Erwachsenenalter in mir geweckt; so kamen die Menschen in meinem Umfeld damals auch nicht auf die Idee, ich könnte Botaniker, Apotheker oder Naturheilarzt werden. Stattdessen sahen sie sich mit einem Kind konfrontiert, das aus unerklärlichen Gründen Straßenkehrer werden wollte. Hat ja, zumindest im Herbst, auch was mit Blättern zu tun …
Die ersten Lebewesen auf unserem Planeten waren die Blaualgen, die noch nicht eigentliche Pflanzen waren, sondern Bakterien mit der Fähigkeit, mittels Fotosynthese Sauerstoff aus dem Wasser freizusetzen. Damit wurde der Weg frei für eine der großen Kooperationen des Lebens auf der Erde, nämlich die zwischen jenen, die Sauerstoff einatmen, und jenen, die ihn abgeben. Deshalb sind die Blätter unserer Wälder für die Menschen lebensnotwendig, auch wenn sie nicht als Nahrungsmittel dienen wie bei ihren nächsten Verwandten, den Schimpansen und den Bonobos, deren Speiseplan in den sieben Millionen Jahren der Menschheitsgeschichte unverändert blieb: zu 60 Prozent Früchte und zu 20 Prozent Blätter. Den Rest lieferten Samen, Insekten und Fleisch. Somit teilten sich diese Rohköstler mit den Australopithecinen das Nahrungsvorkommen.
Der Regenbogen zeigt, dass hier gerade ein Gewitter vorbeigezogen ist. Ein Blitz hat einen Baum entzündet. Die Menschen (Erectus) schauen, wohin das Feuer ziehen wird, und werden dann mit ihren Stöcken in der Glut nach gekochter Nahrung suchen.
Das ging fünf Millionen Jahre lang gut, bis ein Klimawandel dem Australopithecus zu schaffen machte. Ein Zweig, den man als den robusten bezeichnet, änderte sein Menü und unterlag schlussendlich seinen tierischen Nahrungskonkurrenten. Überlebt hat wie gesagt der grazile Zweig. Dieser wendete sich vom Blätterkonsum ab und setzte auf das Konzept »Kopf statt Darm«. Wie wir bei den pflanzenfressenden
Tieren beobachten können, verbringen diese den ganzen Tag mit Fressen und Wiederkäuen, während fleischfressende die meiste Zeit auf der faulen Haut liegen.
Die Australopithecinen waren durch ihre Entwicklung für den Verzehr von rohem Fleisch nicht mehr ausgerüstet, weil ihnen der aufrechte Gang und ein Rückgang der Körperbehaarung den Zugang zu gekochter Nahrung öffnete, die sie in der Glut vorbeigezogener Wald- oder Buschbrände fanden. Dazu diente ihnen ein neues Werkzeug, das sich zum Faustkeil dazugesellte, der Grabstock.
Die Erweiterung der Speisekarte durch gekochte Nahrung machte es den Menschen möglich, auch Speisen zu essen, die roh ungenießbar oder gar giftig wären und an deren Genuss ihr Instinkt sie hinderte. Deshalb wurde dieser nach und nach ersetzt durch die Weitergabe von Wissen über Essbarkeit durch Kochen. Leben hieß jetzt Lernen und Weitergeben in der Community. Nicht dass die Menschen den Instinkt verloren hätten, aber er trat etwas zurück zugunsten eines wachsenden Gehirns, das sich erinnern und mit anderen kommunizieren konnte.
Was die Blätter anbelangt, deren wohltuende Wirkung den frühen Menschen nicht verborgen blieb, vollzog sich dann ein Wandel vom Blatt als Nahrungsmittel zum Blatt als Medizin; die Menschen wurden zu Naturheilkundigen. Eine Spezialisierung von Einzelnen, die einen besonderen Zugang zu den Heilkräften der Pflanzen hätten, gab es noch nicht. Alle zeichnete das mehr oder weniger gleiche Wissen aus, und alle waren bestrebt, gesund zu bleiben. In der eng zusammenbleibenden Horde waren sie sicherer vor den Angriffen der Wildkatzen, bestehen die Jagdmethoden dieser ja gerade darin, schwächelnde Individuen von der Herde zu trennen. Über die genaue Sozialstruktur dieser Urmenschen können wir nur Vermutungen anstellen. Waren sie patriarchal organisiert wie die Schimpansen? Oder matriarchal wie die Bonobos? Oder waren sie, als dritte Option, bereits egalitär wie ihre späteren Artgenossen?
Mit den Kompetenzen von Werkzeuggebrauch, aufrechtem Gang, spärlicher Behaarung, der Ergänzung des Speiseplans mit gekochter Nahrung und einem in der Folge größer werdenden Gehirn entstand vor zwei Millionen Jahren ein neuer Typus: der Homo erectus – ein Wesen, das in einer hochkooperativen egalitären Community lebte und mit einer der Gemeinschaft dienenden Originalität ausgestattet war.
Meine der Gemeinschaft dienliche Originalität machte sich – wie wahrscheinlich bei allen Menschen – schon früh im Leben bemerkbar. Dazu gehörte das Ergriffenheitserlebnis mit den Heilkräutern im Kasperletheater genauso wie das Berührtsein von der Tätigkeit der Straßenkehrer.
Im Alter von sieben Jahren ereilte mich ein weiteres einprägsames Erlebnis. In einem Schulferienlager bauten die Leiter mit uns Kindern im Wald eine Laubhütte, von deren Anblick ich auf unerklärliche Weise zutiefst gepackt wurde. War dies ein Resonanzphänomen, eine Tiefenerinnerung an Initiationshütten in menschlichen Urgesellschaften? Natürlich wusste ich von Initiation damals noch nichts, das würde sich erst im späteren Leben entschlüsseln. Aber deutlich wurde, dass sich in mir durch dieses Erlebnis ein neuer Berufswunsch entwickelte: Ich wollte Menschen in die Natur begleiten, so wie es die Leiter mit uns machten.
Der Wunsch geriet wieder in Vergessenheit, und ich erlernte dann einen gestalterischen Beruf. Fast hätte ich die Laufbahn eines Bühnenbildners eingeschlagen, da warf mich ein schwerer Motorradunfall aus der Bahn. Ein ganzes Jahr ans Krankenhausbett gefesselt, sah ich die Welt nur noch durchs Fenster. Der Blick ging zu einem bewaldeten Hügel in der Ferne, und da, auf einmal, ereilte mich der Ruf der Natur und die Erinnerung an jenen ursprünglichen Berufswunsch aus der Kindheit.
Als ich dann nach der Entlassung aus dem Krankenhaus vor dem städtischen Jugendhaus meiner Heimatstadt eine Gruppe beobachtete, die mit Rucksack und Schlafsack, begleitet von einem Jugendarbeiter, in die Natur aufbrach, war die Entscheidung gefallen, die Ausbildung zum Sozialarbeiter anzutreten. Trotz aller Begeisterung für Gruppendynamik und andere tolle psychologische Themen fehlte mir nach Abschluss der Ausbildung aber die Motivation, eine entsprechende Anstellung zu suchen. Ich machte vorerst etwas anderes, erlernte jedoch fleißig alle natursportlichen Techniken, die damals Mode waren: Klettern, Kanufahren, Skitourenfahren. Und dann, eines Tages, bekam ich unvermittelt, wie ein Geschenk vom Himmel, das Angebot, eine Reisegruppe auf einem Himalaya-Trekking zu begleiten.
So war ich dann 1979 in Nepal unterwegs. Beeindruckt von einer gewaltigen Landschaft – im Vordergrund grüne Reisterrassen, am Horizont riesige Schneeberge –, war der etwas befremdliche Anblick meiner Reisegruppe zweitrangig. Aber es beschäftigte mich, dass die einheimischen Träger das Gepäck der Teilnehmer tragen mussten. Vierzig Kilo auf dem Rücken und keine Schuhe an den Füßen – das war gewöhnungsbedürftig. Es gab neben den Trägern noch das Kochteam und die sogenannten Sherpas, Begleiter, die wenig Gepäck trugen. Ich lernte von den Köchinnen, wie man mit drei Steinen eine Kochstelle baut – eine Tradition, die ich seither tausendfach und bis zum heutigen Tag pflege.
Und ich lernte auch viel über westliche Touristen. Am letzten Abend der Reise sollte es ein kleines Fest mit den Sherpas geben, die dafür speziell einen Kuchen auf dem offenen Feuer gebacken hatten. Meine Teilnehmer wünschten sich, dass die Sherpas ihren Tanz vorführten, den sie manchmal vor dem Schlafengehen vollführten, wenn sie unter sich waren. Das würden sie gern tun, meinten die Sherpas auf meine Anfrage, wenn wir ihnen etwas Geld gäben, damit sie sich im nahen Dorf Marihuana kaufen könnten. Das ging nun für meine Teilnehmer ganz und gar nicht. Drogen – das könnten sie auf keinen Fall gutheißen.
Damit fiel die Tanzperformance für den Abend aus, und ich bekam meine erste Lektion in der Doppelseitigkeit von Blättern. Marihuana ist als Pflanze in Asien beheimatet, schon unterwegs während des Trekkings sah ich wildwachsende Cannabisstauden, von denen die Sherpas pflückten. Marihuana war in Nepal auch ganz legal, bis auf Druck der USA 1973 der Konsum verboten wurde.
Auch in anderen Bereichen lernte ich bei jener ersten Reiseleitung viel über Ambivalenz. Im Anschluss an das Trekking gab es eine Floßtour auf einem Fluss, mein erstes und einziges Rafting-Erlebnis. Der Rafting-Guide, damals noch mit Rudern ausgerüstet, lenkte das Gummiboot zu meinem Erstaunen immer in die größten Wellen. Auf meine Frage, warum er dies tue, meinte er: »Man muss den Leuten schon ein wenig Aufregung bieten.« Und mir wurde klar, dass das nicht die Art sein konnte, mit der ich Gruppen in der Natur begleiten würde. Das Rafting, wie ich es hier kennenlernte, wurde weltweit zum Erlebnishit für Touristen und auch zum sogenannten Teamtraining für »Manager«. Etwas abgewandelt, wurde Teamgeist trainiert in einem schwimmenden Vehikel, in dem das Team kräftig ruderte – aber nur auf Befehl des Bootsführers, der hinten ein Steuerruder bediente. Das Teamtraining war also nichts weiter als die Ausführung von Befehlen, ohne auch nur eine Ahnung von der jeweiligen Situation zu haben.
Auf jener Reise in Nepal hatte ich wieder ein Ergriffenheitserlebnis. Es war Abend, und von unserem Zeltlager aus war in der Ferne ein Feuerchen zu sehen, das vor einem der Lehmhäuser brannte. Warum mich der Anblick so berührte, verstand ich damals nicht, war es doch ein einfaches Bild, dessen Bedeutung ich erst viele Jahre später erkennen würde.
Einige Zeit danach bekam ich die Möglichkeit, an einem indigenen Feuer zu sitzen, denn eine nächste Reise führte mich nach Kolumbien, um eine Trekkingreise in der Sierra Nevada de Santa Marta zu erkunden. Das Feuerchen befand sich in der Mitte der strohbedeckten Steinhütte. Leider war der Rauch so dicht, dass ich niemanden in der Hütte erkennen konnte, ich vernahm lediglich Stimmen. Bis ich mich dann mal etwas zur Seite neigte und feststellte, dass es weiter unten keinen Rauch gab. Und so war der Sachverhalt: Da die Indianer bedeutend kleiner waren als ich, konnten sie sich durchaus gut untereinander sehen …
Am nächsten Morgen gab es gebratene Bananen mit Spiegelei. Wie kunstvoll die Köchin hantierte und in dieser holzarmen Gegend mit drei kleinen Stöckchen ein Kochfeuer unterhielt, das reichte, ein Frühstück für die ganze Familie zuzubereiten.
Die Kinder der Familie tanzten herum und riefen mich: »Me Gusto, Me Gusto.« Ich hatte keine Ahnung, warum sie mich so nannten. Erst als sich im Laufe meines Südamerikaaufenthalts mein Spanisch ein wenig verbesserte, erkannte ich, dass ich hatte sagen wollen, wie sehr es mir gefällt. Aber statt »Me gusta« sagte ich: »Me gusto«, was so viel heißt wie: »Ich gefalle mir.« Das muss für die Kinder sehr amüsant gewesen sein. Überhaupt war ich ein richtiges Greenhorn. Nicht den leisesten Schimmer hatte ich, dass ich in einem der gefährlichsten Drogenanbaugebiete der Welt unterwegs war; und so zog ich mit meinem gebuchten einheimischen Begleiter namens Benvindo weiter durch die Berglandschaft.
Malerisch sahen sie aus, die kleinwüchsigen Indianer dieser Gegend mit ihren langen, schwarzen Haaren und ganz in Weiß gekleidet. Alle trugen sie eine Tasche mit sich, aus der sie von Zeit zu Zeit eine Handvoll Blätter nahmen und in den Mund steckten. Mit einem Stab stocherten sie dann in einer Kalabasse herum und führten ihn schließlich in den Mund.
Mein Begleiter klärte mich auf, dass es sich um Kokablätter handelte und in der Kalabasse sich ein Puder aus Meeresmuscheln befinde, mit dessen Hilfe sich das Kokain aus den zerkauten Blättern herauslösen ließ. Wie schon in Nepal gehörten auch hier die Blätter einer Pflanze, die im Westen als Droge deklariert war, zum Alltag der Einheimischen. Wenn sich zwei Männer treffen, wird eine Handvoll Blätter als Zeichen des gegenseitigen Respekts ausgetauscht. Darüber hinaus wird das Blatt der Kokapflanze aber auch bei Opfergaben und Ritualen eingesetzt. Und auch hier waren es die USA, die diese Substanz kriminalisierten. Coca-Cola hatte ja ursprünglich, wie der Name schon sagt, als Bestandteile Kokablätter und Colanuss. 1914 verbot dann die amerikanische Regierung die Verwendung von Kokain in Getränken. Seither wird der Brause angeblich Koffein anstelle von Koka beigemischt, sie müsste also eigentlich »Coffee-Cola« heißen.
Wade Davis schreibt in seinem Buch The Wayfinders eine wunderschöne Hommage an das Kokablatt.4 Als junger Student durfte er 1974 an einer botanischen Expedition in die Anden teilnehmen, deren Ziel das Studium der Kokapflanze war. Das war zu einer Zeit, als der vorerst medizinische Gebrauch von Kokain in den westlichen Ländern bereits zu einem epidemischen Drogenproblem geworden war. Davis studierte den indigenen Umgang mit der heiligen Pflanze der südamerikanischen Ureinwohner. Er berichtet, wie sich schon die Inkas keinem heiligen Schrein zu nähern wagten, ohne ein Kokablatt im Mund zu haben. Und dass sich der Glaube an einen wechselseitigen Austausch von Energie in der Bevölkerung bis heute erhalten hat.
Die wissenschaftliche Untersuchung der Pflanze zeigt, dass der Anteil des Wirkstoffs Alkaloid lediglich ein Prozent des Trockengewichts ausmacht. Den weitaus größeren Anteil bilden Enzyme, die bei der kartoffelbasierten Ernährung der Andenvölker verdauungsunterstützend waren. Koka war keine Droge, aber eine heilige Speise, die als milder Stimulator ohne jegliche toxische Wirkung oder Abhängigkeit über viertausend Jahre von den Menschen konsumiert wurde.
Heute sind die Kokaplantagen der Einheimischen auf Wunsch westlicher Mächte »illegal«, weil diese sie als Ursache für die Kokaindrogenproblematik ihrer Bürger sehen – oder vielleicht auch einfach weil sie der steuerlichen Erhebung entzogen sind. Immer wenn den Ordnungskräften wieder mal ein Coup gegen Kokainhändler gelungen ist, findet das Ereignis einen großen Widerhall in den Medien. Von der global agierenden Kokainmafia ist die Rede und davon, dass der Markt überschwemmt wird von dieser Droge. Den Grund sieht man im steigenden Angebot, weshalb entsprechende Plantagen von Zeit zu Zeit medienwirksam – meist durch Militäreinheiten – zerstört werden. Das Publikum wird dabei im Glauben gelassen, es handelt sich bei den Konsumenten um Randexistenzen unserer Gesellschaft. Dass die Verfasser der entsprechenden Artikel zu einer der Berufsgruppen gehören, die besonders kokainabhängig ist, davon ist nirgends die Rede. Kokain nehmen nicht nur Partybesucher, sondern auch Banker, Hausfrauen, Bauarbeiter. Man kann es eigentlich nicht fassen, dass da so gut wie nie einer gefasst wird.
Ein neuerer Hit im Blätterwald ist das Ayahuasca. In Brasilien schon länger im Gebrauch, hat der psychedelisch wirkende Tee aus einer Mischung von einer bestimmten Liane und den Blättern eines Kaffeestrauchgewächses mittlerweile selbst die westliche Schickeria erreicht. Da wir in einer Zeit leben, in der eine wertschätzende Haltung gegenüber indigenen Völkern und ihren Bräuchen zur politischen Korrektheit gehört, können die Substanzen-Sittenwächter das Gebräu nicht mehr einfach verbieten wie die USA den Nepalesen den Cannabiskonsum und den Kolumbianern den Kokaanbau. So finden wir in verschiedenen Ländern teilweise originelle juristische Handhabungen des Ayahuasca-Konsums. In Peru gehört Ayahuasca zum nationalen Erbe und ist für Touristen nicht geregelt. In Brasilien soll der Konsum erlaubt, aber der Handel verboten sein. Im Iran ist der Konsum den Schiiten unter Aufsicht von Experten erlaubt. In den USA und in Kanada ist Ayahuasca mit der Begründung der freien Religionsausübung gestattet, während es in Deutschland und der Schweiz verboten ist.
Was den Indigenen der Amazonasregion Ayahuasca, den Bewohnern des südlichen Südamerikas das Mateblatt und den indigenen Völkern des südamerikanischen Hochlands die Kokapflanze ist, war der nordamerikanischen Urbevölkerung das Tabakblatt, eine heilige Pflanze für Ritual und Heilung. Von den Kolonisatoren im 17. Jahrhundert nach Europa eingeführt und vorerst nur als Heilpflanze angebaut, entwickelte sich der Tabakkonsum zu einer Epidemie, die heute jährlich viele Millionen Todesopfer fordert. Doch weil Zigarren und Zigaretten ein Produkt der westlichen Wirtschaft sind, ist weder der Anbau noch der Handel verboten.
Aber warum wird eine Heil- und Ritualpflanze, die Indigene seit Jahrtausenden gebrauchen, auf einmal ein die Gesundheit gefährdendes Suchtmittel? Warum wendet sich beim nichtrituellen Gebrauch das Blatt? Ist der Begriff »Missbrauch«, der ja den Drogenkonsum charakterisiert, auch spirituell zu verstehen?
In den Orixá-Traditionen wird unter anderen die folgende Geschichte über Ossain erzählt.
Nach langer Lehr- und Erfahrungszeit kannte Ossain alle Blätter, Säfte und ihre Heilkräfte. Er begann, Blätter oder Kräuter weiterzugeben, und bat dafür immer um eine kleine Gegenleistung, zum Beispiel ein Essen.
Mit einem dieser Blätter machten die Menschen dann ein Vermögen, und bald vergaßen sie Ossain und letztlich auch das eigentliche Blatt. Ossain wurde zornig und schickte nun auch viele Blätter, die krank machten. Und erst als die Menschen sich daran erinnerten und wieder zu ehren begannen, was zu ehren ist, erst dann konnte Gesundheit einkehren.
So geht es einem mit Ossain.
Es war der 26. April 1986. Ich war mit einer Gruppe in einem Kanukurs am Doubs im Schweizer Jura unterwegs. Als Abendessen war ein Wildkräuterreis geplant. Obwohl es ziemlich heftig regnete, stapften wir im Gelände herum und sammelten essbare Wildpflanzen: Bärlauch, Spitzwegerich, Birkenblätter, Brennnesselblätter, Frauenmantel, Brunnenkresse, junge Löwenzahnblätter, Schafgarbe und Klee. Trotz des miserablen Wetters hatten wir es ziemlich gemütlich am Feuer und unter dem Planendach, auf das der Regen unaufhörlich prasselte.
Erst zu Hause erfuhren wir, dass an jenem Tag der Reaktor von Tschernobyl in die Luft gegangen und der radioaktive Fallout ausgerechnet in jenem Gebiet der Schweiz am stärksten gewesen war, in dem wir uns befanden. Der Name »Tschernobyl« heißt »Beifuß«, eine Pflanze, die in früheren Zeiten zur Sommer- und Wintersonnenwende zwecks Abwehr von bösen Geistern als Räuchermittel genutzt wurde. Sie galt im Mittelalter als wirksames Mittel in der Hexerei und war Bestandteil magischer Rezepturen.
Die Erfahrung mit dem Tschernobyl’schen Hexenkessel brachte mich zur Entscheidung, die Kräuterkunst in meinem Kursangebot nicht mehr zu vermitteln. Den Umgang mit Heilkräutern hatte ich, obwohl lange studiert, schon immer den Profis überlassen. Das ist bei Heilpflanzen auch ratsam, ist es doch bei vielen allein die Dosierung, die zwischen heilsam oder giftig entscheidet.
Die Pharmazie ist eines der ältesten akademischen Lehrfächer. Die Trennung von Schulmedizin und Heilmagie erfolgte aber erst in der Neuzeit. Heute führt die kapitalintensive Pharmaindustrie einen Kampf gegen die Naturheilpraxis der Komplementärmedizin, der wie eine ideologische Neuauflage der mittelalterlichen Hexenverfolgung anmutet. In der Neuen Zürcher Zeitung las ich ein Interview mit dem CEO eines Pharmariesen, der anlässlich eines Afrikaaufenthalts unwidersprochen behaupten konnte, dass es in Afrika keine Heilkräuter mehr gäbe. Dabei ist vielerorts nachzulesen, dass von den circa 6400 im tropischen Afrika vorkommenden Pflanzen etwa 4000 für Heilzwecke verwendet werden. Aber die Pharmaindustrie ist natürlich an der Synthetisierung von natürlichen Heilmitteln interessiert und überzeugt davon, dass diese wirksamer seien als unverarbeitete Substanzen, die sich nicht patentieren lassen. Natürlich lässt sich Aspirin ökonomisch einfacher handhaben als Weiderinde, die eine vergleichbare Wirkkraft hat. Aber bei synthetisierten Heilmitteln müssen wir dafür oft unliebsame Nebenwirkungen in Kauf nehmen.
Ich hatte nur einmal beruflichen Kontakt mit Leuten aus der Pharmaindustrie und will das nicht verallgemeinern, aber was mir da entgegenschlug, war aus meiner Sicht eine Atmosphäre von Gier und Angst. Als ich das einem Freund, einem Organisationsberater, erzählte, bestätigte er mir, dass das auch seine Erfahrung in den Trainings mit Vertretern dieser Sparte sei. Aktuell gibt der Firmenchef eines solchen Konzerns in den Medien bekannt, dass er keine »Kultur der Angst« mehr haben möchte. Da kann man nur anfügen: Wie wäre es darüber hinaus mit einer Dankesgeste an die Kräfte der Blätter, des Zaubers und der Heilkunst?
REZEPT
FEUILLES CROQUANTES
125 g Mehl, 1/4 Liter herbes Bier, 1 Ei, Salz, Muskat, Pflanzenöl. Als Blätter und Blüten verwendet werden können: Bärlauch, Beinwell, Borretsch, Brombeer-, Himbeer- und Erdbeerblätter, Holunderblüten, Huflattich, Lindenblätter, Löwenzahn, Rosenblätter, Salbei, Sauerampfer, aber auch essbare Blumen wie Rosen.
Für den Teig das Mehl mit dem Bier, dem Eigelb und den Gewürzen zu einem dickflüssigen Teig verarbeiten. Das Eiweiß zu Schnee schlagen. 1 Teelöffel Öl unter den Teig rühren und den Eischnee unterheben. Einige Minuten ruhen lassen. Öl in einer Kasserolle erhitzen. Blätter in den Bierteig tauchen, abtropfen lassen und dann im heißen Öl goldgelb ausbacken. Mit Muskat und Salz würzen.