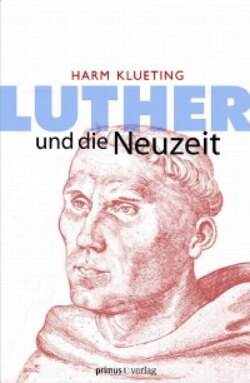Читать книгу Luther und die Neuzeit - Harm Klueting - Страница 15
Stufen des Bruchs Martin Luthers mit der römischen Kirche
ОглавлениеEs gibt einen katholischen Luther − den Priester, Mönch und katholischen Theologieprofessor. Neben dem katholischen Luther gibt es den Luther, der den Papst − erstmals 1520 − als Antichrist bezeichnete, den Ketzer, über den 1521 der päpstliche Bann und die Reichsacht ausgesprochen wurde. Für evangelische Christen − und heute auch für viele katholische − ist dieser Ketzer, der zeitlebens exkommuniziert blieb, der Reformator. Luther beschritt in den weniger als neun Jahren zwischen der Doktorpromotion und der Bannbulle den Weg vom spätmittelalterlichen katholischen Reformer zum evangelischen Reformator. Dabei spielte der Ablassstreit eine wichtige Rolle als Katalysator.
Ablasshandel und Ablasskritik Luther kritisierte den Ablass vereinzelt schon in den frühen Vorlesungen. Danach warnte er in zwei Predigten vor den Gefahren des Ablasses, von denen eine wahrscheinlich am 31. Oktober 1516, genau ein Jahr vor den Ablassthesen, gehalten wurde.47 Den 95 Thesen gegen den Ablass vom 31. Oktober 1517 gingen die viel radikaleren 97 Thesen gegen die scholastische Theologie voraus48, die Luther einer Disputation zugrunde legte, die am 4. September 1517 stattfand. Doch war die Resonanz gering. Dagegen erlangten die 95 lateinischen Ablassthesen49 einen ganz außerordentlichen Widerhall, der aber noch durch den Erfolg der ersten deutschsprachigen Schrift Luthers übertroffen wurde, die er 1518 unter dem Titel Sermon von Ablass und Gnade50 vorlegte. Die Wirkung, die diese Schriften auslösten, stellte alles in den Schatten, was seit der Erfindung des Buchdrucks publizistisch geschehen war. 1518 veröffentlichte Luther die lateinischen Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute51, für viele seine erste reformatorische Schrift.52 Darin legte er im Anschluss an seine 95 Thesen das Ablassproblem und seine theologischen Auffassungen dar.
Den Ablass − lat. indulgentia − gibt es, zuletzt geregelt in der Apostolischen Konstitution Indulgentiarum doctrina Pauls VI. von 196753 und durch den Codex Iuris Canonici von 198354, als Nachlass zeitlicher Strafen vor Gott für Sünden, deren Schuld schon gedeckt ist, auch noch in der katholischen Kirche der Gegenwart, wobei die temporale Limitierung nach Tagen, Monaten oder Jahren heute nicht mehr stattfindet, während Ablässe für Verstorbene nach heutiger Lehre durch Fürbitte (Gebet) zu erlangen sind. Auch in der Kirche des Mittelalters diente der Ablass zur vollständigen oder teilweisen Ablösung zeitlicher Sündenstrafen. Man unterscheidet drei Arten der Sündenstrafen: 1. ewige Sündenstrafen, die dauernd von der Anschauung Gottes ausschließen, was mit ewigem Leiden des Sünders in der Hölle gleichgesetzt wird, 2. zeitliche Sündenstrafen im jenseitigen Leben und 3. kirchliche Bußauflagen im diesseitigen Leben.
Damit verbindet sich die für das Ablasswesen wichtige − auf Tertullian und somit auf das 2. bzw. 3. Jahrhundert zurückgehende − Lehre vom Fegefeuer, lat. purgatorium, wie man es aus Dantes Divina Commedia kennt. Das Feg(e)feuer existierte nach altkirchlicher, von den Reformatoren verworfener, aber vom II. Vaticanum bestätigter Auffassung55 als unräumlich gedachter Ort, an dem die Verstorbenen ihre zeitlichen, also zeitlich begrenzten Sündenstrafen abbüßen. Der Ablass bezog sich nicht auf ewige Sündenstrafen, sondern auf die in der diesseitigen Welt verhängten kirchlichen Bußstrafen und auf die im Fegefeuer abzubüßenden zeitlichen Sündenstrafen. Wichtig war dabei die im hohen Mittelalter entwickelte Lehre vom Schatz der Kirche, der aus den überschüssigen Verdiensten Christi und der Heiligen bestand. Aus diesem Schatz sollen die Ablässe für die Sünder gedeckt werden.
Die Ablässe kamen im 11. Jahrhundert zuerst in Frankreich auf und betrafen anfangs nur die kirchlichen Bußauflagen, später auch die zeitlichen Fegefeuerstrafen der zum Zeitpunkt des Ablasserwerbs noch Lebenden. Im Laufe der Zeit wurden sie auf die zeitlichen Fegefeuerstrafen der Verstorbenen ausgedehnt. Man konnte also auch Verstorbenen, die sich nach der Lehre der Kirche im Fegefeuer befanden und Arme Seelen genannt wurden, durch den Erwerb von Ablässen die zeitlichen Sündenstrafen verkürzen. Dabei war die Gewährung des Ablasses an gute Werke, wie etwa Almosen oder Wallfahrten, gebunden, aber auch an Reue (contritio) des Sünders. Jedenfalls galt das bei Ablässen für Lebende. Trotz der Entwicklung der Ablasslehre durch Albertus Magnus, Bonaventura und Thomas von Aquin gab es um 1500 keine amtlich festgelegte kirchliche Lehre vom Ablass. Das änderte sich erst mit dem Decretum de indulgentiis des Konzils von Trient von 1563.56 Das Fehlen einer verbindlichen lehramtlichen Ablasslehre trug dazu bei, dass das Bußsakrament durch die verbreitete Furcht vor den Qualen des Fegefeuers, durch das Heilsverlangen der Gläubigen und durch den Finanzbedarf der römischen Kurie kommerzialisiert und zum Ablasshandel materialisiert wurde. Der Ablasshandel war eine durch die Vorstellung von der Käuflichkeit des Heils bewirkte Verformung des Ablasswesens.
Luther begegnete den Auswüchsen des Ablasshandels 1517 in seiner unmittelbaren Umgebung um Wittenberg. Das hing mit Albrecht von Brandenburg zusammen, dem Fürstensohn, der 1513 Erzbischof von Magdeburg und Bischof von Halberstadt und 1514 auch noch Erzbischof von Mainz geworden war − und selbst als ein um sein Seelenheil besorgter Ablasssammler hervortrat. Die Wahlkämpfe um seine Bistümer hatten ihm gewaltige Schulden eingetragen. Außerdem hatte Leo X. die dem Kirchenrecht widersprechende Vereinigung zweier Erzbistümer in einer Hand nur gegen hohe Gebühren genehmigt, die Jakob Fugger in Augsburg vorstrecken musste. Um seine Schulden abzutragen, stieg Albrecht in das Ablassgeschäft ein. Viele Territorialfürsten widersetzten sich der finanziellen Ausplünderung ihrer Untertanen. So sperrte auch Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen sein Land für die Ablasshändler. Im sächsischen Wittenberg fand deshalb kein Ablasshandel statt, wohl aber in dem nicht weit von Wittenberg entfernten Jüterbog, das zu Brandenburg gehörte. Viele Wittenberger Bürger liefen dorthin. Der erfolgreichste Ablasshändler im Dienst Albrechts von Brandenburg war Johann Tetzel, der durch seine marktschreierischen Methoden Luthers Bedenken gegen den Ablass erregte. Diese Bedenken verstärkten sich, als Luther im Oktober 1517 die Introductio summaria des Mainzer Erzbischofs für die Ablasshändler in die Hände fiel. Dadurch sah sich Luther veranlasst, andere Gelehrte zu einer Disputation über das Ablasswesen einzuladen und dazu Thesen zu verfassen, wie das zur Klärung wissenschaftlicher Streitfragen an den Universitäten jener Zeit üblich war. Es ging um eine vom Ablasshandel Albrechts von Brandenburg und vom Auftreten Tetzels provozierte akademische Diskussion unter Theologen über die lehramtlich noch nicht festgelegte Lehre vom Ablass.
Luther verfasste dazu 95 Thesen unter dem Titel Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. Er lehnte den Ablass nicht rundweg ab, wollte ihn aber auf die kirchlichen Bußstrafen Lebender beschränken. Vor allem griff er die Lehre vom Schatz der Kirche an. These 62 lautet: „Verus thesaurus ecclesie est sacrosanctum euangelium glorie et gratie Dei“57 (Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium der Ehre und Gnade Gottes). Die Disputation sollte am Allerheiligentag 1517, am 1. November, stattfinden, kam aber nicht zustande. Stattdessen verbreiteten sich die Thesen durch Abschriften, Nachdrucke und Übersetzungen schnell und erreichten breiteste Kreise der Bevölkerung. Diese Resonanz bildete den Hintergrund für den publizistischen Streit über die Thesen, bei dem der Anlass, das Ablassproblem, zunehmend von anderen Fragen wie den Problemen der kirchlichen Autorität, des Papsttums oder der Sakramentenlehre verdrängt wurde. Bald wurden auch Stimmen laut, dass dieser Mönch aus Wittenberg die ein Jahrhundert zurückliegende Ketzerei des Jan Hus erneuere. Interessant ist, dass seine Gegner weniger seine Kritik am Ablasshandel sahen, sondern seine Kritik an der päpstlichen Gewalt. Tatsächlich erkannte er in seinen Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute 1518 die Autorität des Papstes an, doch ließ er sie nur noch mit Röm 13 gelten, der Bibelstelle, wonach die Obrigkeit von Gott gewollt ist. Das Papsttum wurde hier also von Luther den weltlichen Obrigkeiten gleichgestellt. Doch war das noch kein Bruch, sodass der Luther der Resolutiones disputationum noch als katholisch gelten kann.
Der Ketzerprozess Im April 1518 brachte Luther bei einer öffentlichen Disputation, die aus Anlass einer Kapitelsversammlung seines Ordens in Heidelberg stattfand, seine Theologie auf die bis dahin schärfste Formulierung. Die Heidelberger Disputation zog Humanisten wie Martin Bucer und Johannes Brenz − der eine später der Reformator Straßburgs, der andere der Reformator Württembergs − auf Luthers Seite und trug entscheidend zu seiner Resonanz unter den Humanisten bei, die zu den wichtigsten Propagandisten seiner Lehren wurden.
Im Sommer 1518 wurde in Rom der Ketzerprozess aufgenommen, nachdem Albrecht von Brandenburg, Hauptnutznießer des Ablasshandels und finanziell Hauptopfer des von Luther ausgelösten Ablassstreites, die Kurie im Dezember 1517 auf Luthers Ablassthesen aufmerksam gemacht und den Verdacht der Ketzerei geweckt hatte. Im Frühjahr 1518 hatte der Dominikanerorden, dem Tetzel angehörte, in Rom formell Anklage gegen Luther erhoben. Am 7. Juli 1518 erhielt Luther die Vorladung nach Rom, wo er innerhalb von 60 Tagen erscheinen sollte. Doch rief Luther den Schutz seines Landesfürsten, des Kurfürsten Friedrich des Weisen von Sachsen, an. Dieser war als eifriger Ablasssammler und Reliqienverehrer kein Anhänger Luthers. Aber der Kurfürst stellte sich den Ansprüchen der römischen Prozessführung gegen einen Professor seiner Landesuniversität entgegen, die einem römischen Hineinregieren in die kirchlichen Angelegenheiten Sachsens gleichkam. Hier spielten das vorreformatorische landesherrliche Kirchenregiment und der in Sachsen erreichte Stand im frühmodernen Staatsbildungsprozess eine Rolle. Zugleich begann damit das spätere Bündnis von Luthertum und Landesfürstentum.
Die Unterstützung des Kurfürsten führte zur Verlegung des Verhörs von Rom nach Deutschland, wozu sich der politisch auf den Kurfürsten von Sachsen angewiesene Leo X. bereitfand. Aus traditionell-katholischer Sicht geurteilt, versäumte Leo X. aus politischen Rücksichten die Chance, die lutherische Ketzerei rechtzeitig zu unterdrücken. Protestantisch geurteilt bedeutet dasselbe, dass der Papst durch seine politischen Verstrickungen zum Siegeszug der Reformation während der folgenden Jahre beitrug. Nach dem Tod Maximilians I. am 12. Januar 1519 verstärkten sich die politischen Rücksichtnahmen des Papstes auf den Kurfürsten während der Monate der unentschiedenen Königswahl. So wurde in Rom der Ketzerprozess ausgesetzt, um erst nach der im Juni 1519 erfolgten Wahl Karls V. − im Februar 1520 − wieder aufgenommen zu werden. Statt in Rom fand Luthers Verhör im Oktober 1518 am Rande des Reichstags in Augsburg durch Kardinal Cajetan statt, der selbst an einer kritischen Klärung der Ablasstheologie arbeitete und Luthers späterem sola scriptura-Prinzip gar nicht fern stand.
Luther verweigerte den Widerruf seiner Lehre und appellierte „a [...] Papa non bene informato [...] ad [...] patrem [...] melius informandum“58 (von dem schlecht unterrichteten an den besser zu unterrichtenden Papst) und rief die Entscheidung eines Konzils an − er appellierte „ad [...] sacrosanctum Concilium [...] sanctam ecclesiam catholicam repraesentans, sit in causis fidem concernentibus supra Papam“59 (an das hochheilige Konzil, das die heilige katholische Kirche darstellt und in Streitsachen um den Glauben über dem Papst ist). Das war der Konziliarismus des Konzils von Basel und seines konziliaristischen Dogmas von 1439, das das V. Laterankonzil 1516 aufgehoben hatte.60 Noch deutlicher ist das, wenn Luther 1518 unter Berufung auf Nicolaus de Tudeschis gen. Panormitanus, jenen Kanonisten, der als Vertreter Alfonsos I. von Sizilien am Konzil von Basel teilgenommen hatte, dem Papst die höchste Autorität in der Kirche bestritt und ihn allgemeinen Konzilien unterstellte: „In materia fidei non modo generale Concilium esse super Papam, sed etiam quemlibet fidelem, si melioribus nitatur auctoritate et ratione quam Papa“61 (Nicht nur in Sachen des Glaubens ist das allgemeine Konzil über dem Papst, sondern auch über allem, was zum Glauben gehört, weil es sich auf eine bessere Vollmacht und einen besseren Grund stützen kann als der Papst). Luthers Berufung auf Panormitanus, der mit seinem Tractatus de consilio Basiliensi die Superiorität des Konzils über den Papst verteidigte, zeigt, dass er sich im Oktober 1518 noch im Rahmen des Konziliarismus des Konzils von Basel bewegte.
Aber wie weit reichte Luthers Papstkritik im Herbst 1518? Kann man sagen, dass das Augsburger Verhör den „wohl entscheidenden Wendepunkt in Luthers Auffassung vom Papsttum“62 brachte? Das ist eine These Bernd Moellers, der schreibt:
„Der enorme Autoritätsanspruch des Papstes stand für Luther seither auf tönernen Füßen [.]. Die verwegene Folgerung wurde denkbar, der Papst sei der Antichrist.“63
Ausgesprochen hat Luther dieses Urteil 1518 aber noch nicht. Moellers These ist nur eine Vermutung, die von Luthers gleichzeitigem Appell „von dem schlecht unterrichteten an den besser zu unterrichtenden Papst“64 widerlegt wird. Deshalb war auch der Luther des Verhörs von Augsburg 1518 noch immer katholisch.
Die wahrscheinlich entscheidende Stufe auf dem Weg zum Bruch Luthers mit der römischen Kirche war die Leipziger Disputation mit dem Ingolstädter Theologieprofessor Johann Eck im Juli 1519. Von Eck in die Enge getrieben, erklärte Luther nicht nur den Papst, sondern auch allgemeine Konzilien für irrtumsfähig. Er dachte dabei an das Konzil von Konstanz und an dessen Verurteilung des Jan Hus.65 Der Schlüsselsatz von 1519 lautet:
„Ein Concilium mag irren [...] und hat etlich Mal geirret, wie die Historien beweisen und das jetzige letzte Römisch [das V. Laterankonzil] anzeigt wider das Costnitzer [Konstanzer] und Baseler. Also irret in den Artikeln das Costnitzer auch. Oder bewähre du, dass es nit geirret habe. Sonderlich, so man mehr einem Laien sollt glauben, der [die Heilige] Schrift hat, dann dem Papst und Concilio ohne Schrift.“66
Das war etwas qualitativ Neues gegenüber der Papstkritik und dem Konziliarismus des 15. Jahrhunderts. Die Autoritätsfrage − Papst oder Konzil? − beantwortete Luther seitdem mit dem sola scriptura-Prinzip: Autorität hat allein die Bibel. Das war nicht mehr katholisch. Deshalb lag die entscheidende Zäsur bei der Leipziger Disputation von 1519.
Sehr wichtig wurde das Jahr 1520, in dem Luther die Streitfragen erstmals in einer deutschsprachigen Schrift behandelte, in der gegen den Leipziger Franziskaner Augustin von Alfeld gerichteten Schrift Von dem Papsttum zu Rom wider den hochberühmten Romanisten zu Leipzig.67 Hier setzte Luther den Papst zum ersten Mal öffentlich mit dem Antichrist − „Endchrist“68 − gleich und vollzog damit eine Scheidung von nicht mehr zu überbietender Schärfe. Der Antichrist ist eine Gestalt der Apokalyptik, deren Auftreten vor der Wiederkunft Christi erwartet wird. Neutestamentliche Bezugsstellen sind 1 Joh 2,18; 2,22 und 4,3; 2 Joh 7 und Apk 13,11–17. Dabei sah man im Antichrist den Widersacher Christi und die Personalisierung der gegen Gott arbeitenden Kräfte, die durch Verführung mittels einer christlichen Maskierung die Menschen von Christus weg und auf ihre Seite bringen. Luthers Antichrist-Polemik war weder neu noch originell. Schon im Mittelalter wurden das politisch mächtige Papsttum oder einzelne Päpste von Predigern aus dem Franziskanerorden, aber auch von Wiclif mit dem Antichrist gleichgesetzt. Wegen der Resonanz, die Luther dank des neuen Mediums des Buchdrucks fand, wegen der Unterstützung durch die Humanisten und der Protektion durch Fürsten kam seiner Identifikation des Papstes mit dem Antichrist aber besondere Bedeutung zu.
1520 veröffentlichte Luther seine drei großen Programmschriften An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung69, Von der Freiheit eines Christenmenschen70 und De captivitate Babylonica ecclesiae.71 In der Adelsschrift kleidete er die Kritik am Papsttum in das Bild von den drei Mauern, mit denen sich das Papsttum gegen jeden Reformversuch abschirme. Diese drei Mauern waren die Lehre von der Überordnung der geistlichen Gewalt über die weltliche, der Anspruch, dass nur der Papst die Vollmacht zur Auslegung der Bibel besitze, und die Überordnung des Papstes über das Konzil. Luther entkräftete die drei Mauern durch seine Lehre vom Allgemeinen Priestertum aller Getauften, womit sich − anders in der Lehre vom gemeinsamen Priestertum in der katholischen Kirche seit dem II. Vaticanum72 − der Unterschied von Klerus und Laien auflöste, und mit seiner Aufforderung an die weltlichen Obrigkeiten zur Durchführung der Kirchenreform. Hier begegnet erneut das sich anbahnende Bündnis von Reformation und weltlicher Obrigkeit. In der lateinischen Schrift über die Babylonische Gefangenschaft der Kirche ging es um die Sakramentslehre. Luther trat für die Gewährung des Laienkelchs ein, kritisierte die Transsubstantiationslehre der Wandlung von Brot und Wein in Fleisch und Blut Christi und verwarf den Opfercharakter der Messe, womit er auch der Messopferfrömmigkeit seiner Zeit entgegentrat. Der Traktat Von der Freiheit eines Christenmenschen entfaltete unter dem Obersatz „Eyn Christenmensch ist eyn freyer Herr über alle Ding und niemandt unterthan. Eyn Christenmensch ist eyn dienstpar Knecht aller Ding und yederman unterthan.“73 die Lehre von Gesetz und Evangelium und die Rechtfertigungslehre.
Luthers Adelsschrift, die im Juli 1520 erschien, war seine letzte Schrift vor dem großen Bruch, vor der Verurteilung als Ketzer und vor der Exkommunikation aus der bestehenden Kirche. Bernd Moeller hat darauf hingewiesen und die Bedeutung der Adelsschrift als Schlüsseltext der Reformation betont.74 Nachdem der Prozess gegen Luther in Rom im Februar 1520 wieder aufgenommen worden war, erging am 15. Juni 1520 die Bannandrohungsbulle Exsurge Domine Leos X. Darin wurden 41 Sätze aus Luthers Schriften als ketzerisch verurteilt.
Luther ließ die ihm für den Widerruf eingeräumte Frist von 60 Tagen verstreichen und schuf am 10. Dezember 1520 mit der öffentlichen Verbrennung der Bannandrohungsbulle ein Fanal, das dem endgültigen Bruch mit der römischen Kirche gleichkam und den päpstlichen Bann durch die Bulle Decet Romanum Pontificem vom 3. Januar 1521 und die Exkommunikation nach sich zog. Am 8. Mai 1521 sprach Kaiser Karl V. mit dem von dem päpstlichen Legaten Hieronymus Aleander entworfenen Wormser Edikt die Reichsacht gegen Luther aus. Luther war damit auch vonseiten des Heiligen Römischen Reiches als Ketzer verurteilt. Die Lektüre oder die Weitergabe seiner Schriften wurde verboten, obwohl diese Schriften damals schon in mehr als einer halben Million Exemplaren verbreitet waren.
Erst im Februar 1522 erschien Luthers 1521 verfasste Schrift De votis monasticis iudicium75, in der er den lebenslänglich verpflichtenden Charakter der Mönchsgelübde verwarf und − in Anknüpfung an die Adelsschrift − nicht mehr die besondere Verpflichtung des Mönchs, sondern die alltägliche Arbeit im weltlichen Beruf als Erfüllung des göttlichen Willens verstand. Mit dieser Schrift erreichte Luthers Auseinandersetzung mit der römischen Kirche ihren vorläufigen Höhepunkt und gewissermaßen ihren Abschluss, bevor er Anfang Oktober 1524 das Ordensgewand eines Augustiner-Eremiten ablegte und − bis dahin zölibatär lebend − im Juni 1525 die ehemalige Zisterziensernonne Katharina von Bora heiratete.