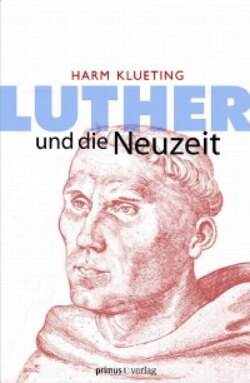Читать книгу Luther und die Neuzeit - Harm Klueting - Страница 8
Einleitung
ОглавлениеAm 31. Oktober 2009 erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus Anlass des Reformationstags1 ein Leitartikel von Heike Schmoll2, der sich auf die „Luther-Dekade 2008 bis 2017“3 bezog. Es heißt darin unter dem Titel „Am Beginn der Neuzeit“:
„Beim Stichwort Reformation durchfährt so manchen Katholiken ein leichtes Zucken. Katholische Christen fragen sich, was sie denn eigentlich bei dem für 2017 von den evangelischen Kirchen geplanten Reformationsjubiläum zu feiern haben. […] Zunächst war die Reformation jedoch ein universitätsgeschichtliches Ereignis, denn Luther hatte seine Gedanken für den akademischen Kontext formuliert. Er wollte die Wissenschaft aus dem engen Korsett scholastischen Denkens befreien. Durch die Bildungsreformen seines Wittenberger Mitstreiters Philipp Melanchthon […] entstanden ein Schulwesen und eine Universität als Institutionen von freier Wissenschaft und höherer Bildung. Beide standen nicht mehr unter unmittelbarer kirchlicher Leitung. Die Befreiung aus der Vormundschaft der Kirche ist das kulturgeschichtliche Ereignis der Reformation, das in seiner Bedeutung für die Geschichte der Individualisierung meist unterbewertet wird. Es ist für moderne Menschen schlechterdings nicht mehr vorstellbar, was es für den Einzelnen hieß, nicht mehr priesterlichen oder kirchlichen Weisungen unterworfen zu sein. Den Menschen direkt Gott gegenüberzustellen war ein geradezu revolutionärer Akt Luthers. Der Verzicht auf eine kirchliche Vermittlung, religiös gesprochen auf das kirchliche Heilsinstitut und sämtliche Geschäftszweige der Gnadenbürokratie, war ein ungemein befreiender Schritt, dessen Folgen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden können. Hier beginnt neuzeitliche Individualisierung mit all ihren Möglichkeiten, aber auch Gefährdungen, die in jeder Gewissensentscheidung des gläubigen Einzelnen liegen. Luthers Befreiungsakt liegt die Einsicht zugrunde, dass Kirche und Theologie prinzipiell irren können. Das ist die Geburtsstunde der Theologie als Wissenschaft. Es ist aber auch der Anfang einer freien Wissenschaft überhaupt. Ende des 19. Jahrhunderts hat der Jenaer Pädagoge Wilhelm Rhein die kulturelle Leistung der Reformation auf den Punkt gebracht: ‚Die Reformation bedeutet den Geist innerer Freiheit für den Christenmenschen. Freiheit setzt Bildung voraus.‘ Mit Melanchthons Aktivitäten zur Reform und neuen Einrichtung von Volksschulen habe der Geist der Reformation ‚die Demokratisierung der Bildung‘ eingeleitet, die bis heute gilt. Die Lehre von der Freiheit und Mündigkeit des Christenmenschen gab den Anstoß zur Bildung der Massen. Lesen lernen, um beim Verständnis der Bibel nicht mehr allein von kirchlicher Deutung abhängig zu sein, war der Grundgedanke.“
Schmoll nimmt das Credo des Kulturprotestantismus des 19. Jahrhunderts auf, der das – oft längst kirchenferne – evangelische Bürgertum im Protestantismus eine Kraft des Fortschritts in Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur sehen ließ und so nicht nur eine Abwertung des Katholizismus möglich machte, sondern auch „der sich säkularisierenden Modernität ihre lang nachwirkende protestantische Tönung“4 verschaffte. Was ist im Übrigen dazu bzw. dagegen zu sagen?
1 Luther „wollte“ die Wissenschaft nicht „aus dem engen Korsett scholastischen Denkens befreien“. Das war nie sein Anliegen. Außerdem war das philosophische und theologische Denken schon lange aus diesem Korsett ausgetreten. Längst hatte die Scholastik selbst die Vielfalt der Gestalten angenommen, wie sie uns mit der via antiqua und der via moderna und den verschiedenen Formen des Nominalismus entgegentritt. Längst war auch der – antischolastische – Humanismus in die Universitäten eingedrungen.
2 Durch die Reformation Luthers und das Wirken Philipp Melanchthons entstand die „Universität als Institution von freier Wissenschaft“ nicht. Züge von Institutionen freier Wissenschaft trugen schon die Universitäten des 13. Jahrhunderts, vor allem die Pariser Universität, und das nicht nur in den „freien Künsten“, den artes liberales. Universitäten als Institutionen freier Wissenschaft im modernen Sinne entstanden aber erst seit der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, beginnend mit der 1737 eröffneten Universität Göttingen – der ersten Universität, an der die Zensurrechte der Theologischen Fakultät über die anderen Fakultäten endgültig beseitigt wurden – und danach mit der 1810 gegründeten Universität Berlin.
3 Die Universitäten standen vor der Reformation nicht „unter unmittelbarer kirchlicher Leitung“, weder die Pariser Universität oder die Kölner Universität von 1388 noch Universitäten wie Ingolstadt (1472), Tübingen (1477), Wittenberg (1502) oder Frankfurt an der Oder (1506), bei denen der landesfürstliche Einfluss stärker war als der der Kirche.
4 Die „Befreiung aus der Vormundschaft der Kirche“ hatte lange vor der Reformation eingesetzt, mit dem Investiturstreit des 11. und 12. Jahrhunderts, mit dem Denken eines Marsilius von Padua und eines Wilhelm von Ockham im 14. Jahrhundert oder mit dem Aufkommen des gegen den päpstlichen Universalismus gerichteten Nationalismus im Frankreich jener Zeit.
5 „Neuzeitliche Individualisierung“ beginnt nicht mit der Reformation, sondern viel früher im Humanismus Italiens – wobei Individualisierung durch die Subjektstellung des Menschen dem christlichen Glauben von Anbeginn an eigentümlich war, sichtbar auch in der Personalität des Menschen bei Augustinus in der Spätantike. Gewiss hat der Protestantismus „für die Gewissensentscheidung des gläubigen Einzelnen“, die aber dem Katholizismus des 16. oder 17. Jahrhunderts keineswegs fremd war, auch seinen Beitrag geleistet, aber mehr durch den Pietismus des 17. und 18. Jahrhunderts als durch die Reformation.
6 Luthers Reformation war nicht die „Geburtsstunde der Theologie als Wissenschaft“. Diese Geburtsstunde schlug, als an der Pariser Universität des 13. Jahrhunderts die monastische Theologie durch die scholastische Theologie verdrängt wurde; im Sinne des modernen Wissenschaftsbegriffs schlug sie erst mit der protestantischen Aufklärungstheologie des 18. Jahrhunderts.
7 Der „Anfang der freien Wissenschaft überhaupt“ liegt nicht in der Reformation, sondern – abgesehen von der Frage, was „freie Wissenschaft überhaupt“ ist – einerseits an der Pariser und an einigen anderen Universitäten des 13. Jahrhunderts, andererseits in der Aufklärung des 18. und im humboldtschen Ideal der Wissenschaftsfreiheit des 19. Jahrhunderts.
8 „Demokratisierung der Bildung“ wurde nicht im Wittenberg Luthers und Melanchthons „eingeleitet“. Die Auflösung des klerikalen Bildungsmonopols und die Entstehung weltlicher Schulen fand lange vor der Reformation statt. Die Demokratisierung der Bildung, die auch Mädchen und Kindern der Unterschichten zugute kam, verdankt sich in den Anfängen den Bemühungen – katholischer – Schulorden des 17. und 18. und philanthroper Pädagogen der Aufklärung des 18. Jahrhunderts sowie den Bestrebungen der Staaten, der Kirchen – auch der katholischen –, der bürgerlichen Frauenemanzipationsbewegung und der sozialistischen Arbeiterbewegung des 19. und auch noch des 20. Jahrhunderts.
9 Martin Luther steht mittendrin – zwischen Mittelalter und Neuzeit. Das nimmt ihm nichts von seiner Größe.
Heike Schmolls Darlegungen sind nicht nur sachlich zu kritisieren und als in den Grundaussagen falsch zurückzuweisen; sie reihen sich auch ein in die fragwürdige Tradition der Lutherfeiern und Reformationsjubiläen – 16175, 1717, 1817, 1917 – und der Instrumentalisierung Luthers als des siegreichen Kämpfers gegen mittelalterlichen Aberglauben und kirchlichen Machtanspruch6, des deutschen Nationalhelden und des „Großen Deutschen“ bis hin zu den „15 Thesen des Zentralkomitees der SED über Martin Luther“7 von 1981 zu dem in den beiden damaligen deutschen Staaten – der Bundesrepublik Deutschland und der DDR – begangenen Lutherjahr 1983, die Luther zum Helden der „frühbürgerlichen Revolution“8 machten.
Viel klarer als Schmoll sieht der Historiker Hartmut Lehmann die Probleme in seinem am 26. August 2008 ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienenen Artikel „Die Deutschen und ihr Luther“.9 Lehmann fragt zur „Luther-Dekade 2008 bis 2017“:
„Wie kann man der Gefahr einer neuerlichen Instrumentalisierung Luthers im Jahre 2017 begegnen? Wie kann Luthers Botschaft in die heutige Zeit übersetzt werden, ohne dass es zu fatalen politischen und kirchenpolitischen Akzentuierungen kommt? Und vielleicht noch wichtiger: Was hat Luther im Deutschland des Jahres 2017 noch zu sagen in einer säkularisierten und in religiöser Hinsicht pluralisierten Gesellschaft, in einer Gesellschaft zudem, in der die kirchlich aktiven Protestanten sich in einer Minderheit befinden […]?“
Der Protestant Lehmann macht in seinem Artikel auch auf die im Vorfeld und im Zusammenhang des Zweiten Vatikanischen Konzils durch „reformbereite katholische Theologen“ – zu nennen sind vor allem Joseph Lortz10 und Erwin Iserloh11 – erfolgte positive katholische Entdeckung Luthers aufmerksam:
„Für viele von ihnen galt er nun als ein ‚Reformkatholik‘, der auf tragische Weise mit seinen Anliegen gescheitert war, weil ihn die katholische Hierarchie, anstatt auf seine Vorschläge einzugehen, aus der Kirche vertrieben hatte.“
Die Entdeckung Luthers als Reformkatholik ist die Entdeckung des Wirkens Luthers als Teil der Katholischen Reform – bis zu jenem Zeitpunkt, an dem sie bei Luther „aus dem Ruder“ lief.12 Wir werden sehen, was das für die Frage nach „Luther und die Neuzeit“ bedeutet. Lehmann fügt in seinem FAZ-Artikel von 2008 an:
„Noch ein Wort zur Luther-Dekade 2008 bis 2017. Im Jahr 1508 war Luther ein eifriger, geradezu skrupulös auf sein Seelenheil bedachter Mönch. Im Laufe der folgenden Jahre konzentrierte er sich auf das Studium der Heiligen Schrift und machte sich viele Gedanken über den Zustand der römischen Kirche. Als er 1517 seine 95 Thesen ausarbeitete, konnte man ihn als ‚Reformkatholiken‘ bezeichnen. Erst als seine kirchlichen Oberen seine Vorschläge ablehnten und ihn maßregelten, kam es zum endgültigen Bruch. Läge in der Auseinandersetzung mit dieser Entwicklung nicht eine Chance für die Luther-Dekade, noch einmal über die Ursachen der konfessionellen Spaltung der westlichen Christenheit nachzudenken? Vielleicht könnte man in diesem Zusammenhang sogar das ökumenische Gespräch wiederbeleben und nach Wegen zur Überwindung der für alle Teile schmerzhaften konfessionellen Trennung suchen?“
Die Überwindung der konfessionellen Trennung heute und die Wege, die dazu vor dem Hintergrund der Kirchen- und Theologiegeschichte beschritten werden könnten, sind aber nicht das Thema dieses Buches. Das Thema ist vielmehr die Frage nach Luther – und nach der Reformation13 – zwischen Mittelalter und Neuzeit.