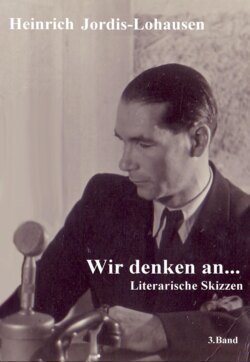Читать книгу Wir denken an.... - Heinrich Jordis-Lohausen - Страница 10
Rembrandt
ОглавлениеRembrandt van Rijn ist am 8. Oktober 1669 völlig vereinsamt und gemieden von seinen Mitbürgern in seinem Amsterdamer Atelier gestorben. Seine ganze Verlassenschaft bestand aus ein paar zerschlissenen Gewändern, etwas Leinwand zum Malen, einigen Pinseln und Farben.
Das war das Ende des größten niederländischen Malers, und vielleicht bezeichnet nichts besser den seitherigen Wechsel seiner Einschätzung als die Veröffentlichung eines Buchs, das in den 1890-iger Jahren in Deutschland berechtigtes Aufsehen erregt hat:
Es hieß „Rembrandt als Erzieher“ und sank wie manches ähnlich zeitgebundene Werk bald in Vergessenheit, nur Sinn und Name blieben bedeutsam, denn nie bisher noch war das Vermächtnis eines bildenden Künstlers (statt wie üblich das eines Dichters oder Denkers) zum Ausgangspunkt einer Weltbetrachtung gemacht worden.
Dass das 19. Jahrhundert einen solchen Versuch unternahm und die Gestalt eines zu Lebzeiten Vergessenen und Geächteten zum Sinnbild seiner eigenen Zukunftshoffnungen erhob, beleuchtet die außergewöhnlichen Spannungen, denen das Leben dieses phantastischen Einzelgängers unterworfen gewesen war.
Sie begann, als sich der junge, in einer Windmühle aufgewachsene Rembrandt endgültig als freier, unabhängiger Künstler in Amsterdam niederlies. Hören wir Verhaerens Beschreibung des Rembrandt´schen Amsterdam:
„…. Der Anblick ist der einer satten Wohlhabenheit. Frauen mit gesteiften Halskrausen schauen stundenlang hinter den Fensterscheiben auf die gegenüberliegenden Fassaden, die doch ganz so sind, wie die ihren. Es gibt wenig Lärm, alles ist gleichmäßig, geregelt und vorausgesehen, denn die Bürger von Amsterdam sind Puritaner; sie haben die Reformation mit ihrem Blut erkämpft und nun befürchten sie nichts mehr, als die mögliche Unterbrechung ihrer abgezirkelten Existenz.
Und da sie die Freiheit des Gedankens gerade noch dulden, beschränken sie die des Benehmens. Sie haben die Ideen frei gemacht, aber die Taten gebunden.“
Und Rembrandt? Er war der Unbändigste der Unbändigen in jenen flachen Ländern am unteren Rhein und ist es geblieben – bis zuletzt, in seinen Tugenden, wie seinen Fehlern.
Er trank das Dasein hinunter wie ein durstiger Zecher – ganz, und in einem Zug. Und alle Höhen und alle Tiefen, die es zu bieten vermochte, sind ihm gewährt worden – und mitgegeben mit ihrer Lust und ihrem Schmerz der unbezähmbare Drang, ihre Flüchtigkeit einzufangen und festzuhalten für ewig.
Man umarmt nicht das Leben, um es immer wieder zu entlassen. Klang und Duft und Geschmack und alle Sensationen des Tastsinns sind vergänglich, Farbe und Form aber lassen sich fesseln, lassen die ganze Welt in einer phantastischen, zweiten Dimension von Tusche- und Kohlenstrichen, Öl- und Wasserfarben, geritzten Metallplatten und geschnitzten Holzbrettern wiederholen. Und so eindringlich wiederholen, dass sie sich erst so und zum ersten Mal (und wie in einem großen Staunen) ihrer selbst bewusst werden. Natur und Kunst sind wie Eva und ihr Spiegel: So also bin ich? So bin ich wirklich? Ein oft bezaubernder, oft entsetzlicher Anblick - ein flüchtig unbefangenes Stück des Lebens – fest gebannt und fest gefroren zu ewiger Dauer. „Ich will dieses Leben halten wie eine Geliebte und nimmer von mir lassen.“ So denkend kam der junge Rembrandt nach Amsterdam und sein Denken fiel in diese Stadt der Konventionen und Vorurteile, wie ein glühender Meteor in feuchtkalten Nebel.
Alsbald heiratete er, der unbekannte Müllersohn und Plebejer, eine lebensprühende, blutjunge, und heidnisch-leichtfertige Patrizierin, Saskia von Uylenburg. Und alsbald wurden die beiden, so wie sie waren und so wie sie lebten, dem steifhochmütigen, puritanischen Amsterdam ein ständiger Anlass zu ständigem Ärgernis. Aber was kümmert das Rembrandt? Seinen leicht entflammbaren Sinnen genügt Saskias strahlender Teint, genügt der kleine, fein geschwungene Mund und das frische, übermütige Lachen über blitzenden Zähnen. Was zählt daneben ganz Amsterdam? Was seine totlangweiligen Verwandten? Ist sich von zarten Händen überwinden, Tag für Tag neu überwinden zu lassen, nicht das Köstlichste im Menschenleben? Ein Bild der Dresdner Galerie zeigt beide bei Schmaus und Schwelgerei. Der ungeschlachte, riesige Rembrandt hält seine feine, zierliche Frau auf den Knien und schwingt einen gewaltigen Becher schäumenden Weins. Was kümmert´s ihn auch, ob solch übermütiges Sichbrüsten als geschmackvoll empfunden wird oder nicht, und keinerlei Angst, unvornehm oder herausfordern zu wirken, wird seine breitspurige Männlichkeit je daran hindern, ein anderes Maß anzuerkennen, als das seiner eigenen Kraft und seiner eigenen Leidenschaften. Und ob er Saskia – nackt und entschleiert – in der klassischen Umrahmung griechischer Göttinnen malen wird oder im überladenen Prunk jüdischer Bräute oder orientalischer Königinnen – immer wird s i e „Rembrandts ewiger, Körper gewordener Traum“ bleiben. Da Saskia keine Bedenken kennt, ihrem Mann gleichzeitig Gattin und Geliebte zu sein und seinen Träumen mit kapriziösen Launen und phantastischen Wünschen immer von neuem Nahrung zu geben, baut Rembrandt einen Palast rund um sie und schafft alles heran, was Amerika und Indien über den Ozean senden, um sie und sein Haus mit einer Welt von Sonderbarkeiten zu schmücken.
Bald allerdings beschuldigt ihn seine Verwandtschaft, Erbteil und Mitgift zu vergeuden. Rembrandt führt Prozess und verliert. Und von da an überwacht eine peinliche und krämerhafte Kontrolle sein Haus und vereitelt jeden Versuch, in das unbekümmerte Dasein der ersten Jahre zurückzufallen.
Plötzlich, am 19. Juni 1642, stirbt Saskia und zerreißt die buntfärbigen Schleier seines einstigen, glanzvollen Lebens. Mit unbarmherziger Hand wirft die verachtete Wirklichkeit den übermütigen Träumer zu Boden und entlässt ihn als Bettler. Nun aber, in der entscheidenden Wende seines Lebens, wandelt Rembrandt seinen Schmerz genauso zu Traum wie einst seine Freude und schafft sich aus Trümmern ein neues unangreifbares Reich. Von Saskia blieb ein Kind und dank der Aufopferung einer Magd – Henrikje Stoffels – der Schein eines Haushalts. Und das genügt, dem Gezänk aller Gläubiger und Gerichtsvollzieher zum Trotz, das eigene Werk zu vollenden.
Hätten jene gekonnt, sie hätten den größten Maler Europas an den Rand des Selbstmords getrieben. Aber Rembrandts unverwüstliche Bärennatur war stärker als sie und seine Phantasie zäher als Gold.
Nun er nichts mehr hat, als Titus, Henrikje und sich, umkleidet er ihre und die eigene lumpige Armut mit dem Gold und der Seide seiner Erinnerung, und verzaubert Sohn und Magd zu Pagen und Prinzessinnen sagenhafter Vergangenheiten, nicht ohne zuletzt in Stolz und Trotz, Freude und Trauer doch wieder sich und sich allein vor den Spiegel zu stellen, in knabenhafter Selbstliebe die eigenen Züge nachzubilden und die eigenen Gebärden nachzugestalten.
Denn stets bleiben er und die Seinen seiner naiven, barbarischen Natur die einzig wirklichen Menschen, die einzigen Träger einer großen, vielfärbigen Illusion, die stärker ist als alles Schicksal, stärker sogar als alle Erinnerungen, genügt es doch, dass sie sich einer einfachen Magd wie Henrikje bemächtigt, und selbst Saskia, die vergötterte Saskia, wird in der Einsamkeit einer elenden Kammer vergessen.
Und doch ist diesem Phantasten und Träumer das Bild der Wirklichkeit heilig. Und je selbstherrlicher der Privatmann Rembrandt alle Peinlichkeiten des öffentlichen Lebens beiseiteschiebt, mit umso größerer Sorgfalt zeichnet der Künstler die der Natur, umso unbestechlicher wird sein Pinsel, umso schonungsloser gegen die ihn umdrängenden Unvollkommenheiten von Menschengesichtern und Menschengestalten.
Und malt er mit Vorliebe das Hässliche, um es der leuchtenden Pracht seiner Farben entgegenzuhalten, so liegt darin mehr als ein nur malerisches Gefühl für Kontraste. Die Suche nach einer tieferen Wahrhaftigkeit, als eine bloß gefällige Kunst sie je darbieten kann, erlaubt ihm als begnadeten Zauberer, alle Schwächen der irdischen Menschennatur in Wundern von Licht aufzulösen.
So sind denn auch keine von Rembrandts Frauengestalten und nur wenige seiner Männer und Greise im üblichen – apollinischen – Sinne des Wortes als schön zu bezeichnen – und nur in seinen Landschaften gesellt sich die natürliche Schönheit der gemalten Natur der übernatürlichen seiner eigenen Schau. Gerade jene anderen aber, gerade seine Menschenbilder überwältigen die Beschauer durch die aus Maß und Gebärde, aus Farbe und Schatten auf sie eindringende Wucht ihres Anrufs: „Seht her, so sind wir! Nackt und ungeschminkt! Weist uns ab, wenn ihr könnt!“.
Und niemand vermag es! Auch die Krämer und Wucherer von Amsterdam mit ihren von Geiz und Selbstgerechtigkeit zerfressenen Seelen können es nicht. Und ob sie den Künstler auch verabscheuen und verfolgen, seine Werke wägen sie mit Gold.
So kann es geschehen, dass Rembrandt, völlig unbekümmert, was da gegen ihn vorgebracht wird, sich vor dem Schuldgericht in aller Ruhe damit vergnügt, die Züge seiner Widersacher zu zeichnen. Und dabei auf unerwartet eindringliche Weise das übergeschichtlich Ewige und hoffnungslos Erdverhaftete dieser verknöcherten Menschengesichter erfährt und – weil er anders den Sinn ihres trostlosen Erdendaseins nicht zu begreifen vermag – IHN in ihre Mitte stellt: „Christus, die Kranken heilend“.
Das Blatt ging ab für hundert Gulden. Das Genie begann seinen Tribut einzufordern und es forderte ihn frech von denen, die es unverhohlen verhöhnte. Denn die seines Geistes waren und die zu ihm hielten, die Zecher in den Schenken und Hafenspelunken, die hatten weder Truhen, sich Bilder zu stapeln noch Wände, sie aufzuhängen. Rembrandt war nie über die Grenzen seiner Heimat hinausgelangt. Er hat nie inmitten adeliger, rassiger Menschen gelebt wie seine italienischen Vorgänger. Und der einfache Weg auf die Straße – genug, um in Florenz oder Venedig einem Überfluss an menschlicher Anmut zu begegnen – war ihm, dem Holländer verwehrt.
Als er die ersten Bilder der Saskia malte, war seine Palette noch reich und prunkvoll. Dann beginnt sich die blühende Pracht seiner Farben zu dämpfen und während er immer mehr und immer bewusster die alleinige Herrschaft des Lichts über Farbe und Umriss verkündet, gelangt auch er – wie einst Tizian – in letzter Stunde an den äußersten Rand seines Könnens.
Was sich hier im armseligen Atelier eines einzelnen Mannes abspielte, war mehr als ein persönliches Drama. Es war das Ringen der abendländischen, faustischen Seele um die letzten, unübersteigbaren Grenzen der Malerei.
Und nicht umsonst ist dieser abschließende Kampf nicht im freien Feld der alten klassischen Farben, sondern im entlegenen Bereich jenes sprichwörtlich Rembrandt´schen Braun ausgefochten worden.
„Dieses, früheren Jahrhunderten vollkommen fremde, Braun“ nennt Oswald Spengler „die letzte, die unwirklichste Farbe, die es gibt. Es ist die einzige, die dem Regenbogen fehlt; es gibt weißes, gelbes, blaues, grünes, rotes Licht in vollkommenster Reinheit. Aber ein nur braunes Licht liegt außerhalb der Möglichkeiten unserer Natur. Alle jene silbrigen, feuchtbraunen, tiefgoldenen Töne, die schon bei Giorgione in prachtvollen Spielarten erscheinen, entkleiden den Raum seiner greifbaren Wirklichkeit und lösen seine sinnlichen Beziehungen in einer Welt reinster Innerlichkeit auf“, bis schließlich in den späten Gemälden Rembrandts jene äußerste Schwelle erreicht war, die mit malerischen Mitteln nicht mehr überschritten und über die hinaus nur mehr in Noten zu Ende geschrieben werden konnte, was hier in Lichtern und Schatten starr auf Leinwand festgebannt lag.
Dazu allerdings bedurfte es neuer Jahrhunderte und bedurfte es der Meisterschaft eines Bach, eines Beethoven oder eines Bruckner.