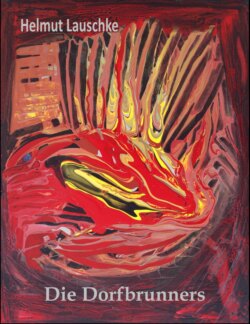Читать книгу Die Dorfbrunners - Helmut Lauschke - Страница 7
Der Koordinatenstand
ОглавлениеEs war das Jahr 1918. Lenin verkündete die Weltrevolution. Er sah Deutschland, nicht Russland, als das Land der Entscheidung an, aus dem diese Revolution kommen sollte. Für ihn stand es fest, dass nach der Geschichte der Ausbeutung der unteren Klassen durch die oberen die Völker sozialistisch sein würden, so dass es allein die bolschewistische Partei sein würde, die den Völkern die Selbstbestimmung brächte. Das deutsche Militär hatte Polen und Teile der baltischen Provinzen besetzt. Es wäre in der Lage gewesen, auch Finnland und die Ukraine zu besetzen, weil der russisch-imperiale Widerstand von innen heraus zerbrochen war. Deutsche Politiker, wie der Staatssekretär von Kühlmann, meinten in dem russischen Machtzerfall und seiner Folgen bereits die Anwendung der Selbstbestimmung jener Völker zu erkennen, die sich vom einstigen Zarenreich loslösten. So gab es in jenem Jahr Gespräche über die Selbstbestimmung zwischen dem russischen Unterhändler Leo Trotzki und der deutschen Diplomatie. Trotzki erwies sich als der klügere, weil er keine Garantien für die später in den baltischen Provinzen abzuhaltenden freien Volksabstimmungen gab. So stand Trotzki als Vorkämpfer des Selbstbestimmungsrechts da, ohne diesem Recht irgendeine Garantie unterzulegen. Nur weil das deutsche Militär in jenem Jahr noch eine starke Präsenz an der russischen Westfront hatte, waren es weniger die Grundsätze als das Gerangel um die Macht, dass sich die Verhandlungen dahinschleppten. Unter dem Druck des deutschen Vormarsches ins Baltikum und bis zum Peipussee, mit der Vertreibung der Bolschewiken, gab Lenin schließlich nach und ließ den Friedensvertrag von Brest-Litovsk, ohne ihn selbst gelesen zu haben, unterzeichnen, weil er diesen Vertrag für bedeutungslos hielt. Das osteuropäische Chaos blieb ungelöst und unlösbar, solange der Krieg im Westen mit dem Abschlachten von Menschen weiterging. Die Politik mit dem überfälligen Friedensangebot versagte auf ganzer Linie, weil auf deutscher Seite die Generäle mit von Ludendorff und von Hindenburg an der Spitze auf Macht und Schlacht um die riesige Landbeute mit den polnischen Kohlerevieren setzten und sich einer politischen Vernunft bis zur letzten Stunde mit Dummheit und Intrige widersetzten. Zwar hatte Deutschland 1916 ein polnisches Königreich ausgerufen, weil sich das Militär davon Vorteile gegen Russland versprach; doch die polnische Sympathie blieb aus. Es blieb das polnische Misstrauen gegenüber den Deutschen, die an den polnischen Teilungen so hartnäckig mitgewirkt hatten. Auch war der Traum der Wiedererrichtung des polnischen Großreiches von der Ostsee bis ans Schwarze Meer für die Polen selbst längst ausgeträumt. So ein Polen passte politisch nicht mehr in die europäische Landschaft. Ludendorff argumentierte militärisch, als er die Annektierung eines breiten Streifens aus dem russischen Polen an Deutschland forderte. Der Friedensvertrag von Brest-Litovsk war seines Papiers nicht wert. So bemerkte der General Groener: „Auch der so genannte Ostfriede ist eine höchst problematische Sache; der Krieg geht auch hier weiter, nur in anderer Form.“ Man erhoffte das ukrainische Getreide und kaukasische Öl, dass sich die deutschen Truppen dort selber holen mussten. Die chaotische Lage im Osten machte es unmöglich, genügend Truppen von der Ostfront an die Westfront zu verlegen, was immerhin fast eine Million waren. Die anderen Truppen blieben, wo sie waren, und rückten immer tiefer in den einst russischen Herrschaftsraum ein. Deutschland geriet in die vielfache russische Versuchung der Eroberung, Ausbeutung und Herrschaft, als die Flammen der proletarischen Revolution bereits hoch und blutrot loderten.
Die Westmächte sahen im „Friedenschluss“ von Brest-Litovsk den letzten Beweis für die deutsche Brutalität ihrer Kriegsziele, mit der dem russischen Verbündeten ein Gebiet weggenommen wurde von der Größe Österreich-Ungarn und der Türkei zusammen, mit über 50 Millionen Einwohnern, 80 Prozent der Eisen- und 90 Prozent der Kohleproduktion. Für die Westmächte eignete sich ein solches Deutschland kaum noch als ein Verhandlungspartner in Sachen Friedensschluss. In seiner Analyse des Zeitgeschehens soll der Politikprofessor und amerikanische Präsident Thomas W. Wilson von der ‘Gewalt bis zum Äußersten’ gesprochen haben. Der Vertrag von Brest-Litovsk, den Lenin gar nicht gelesen hatte, weil er ihm keine Bedeutung beimaß, schwächte dagegen die deutsche Stellung in der Welt und ihre ohnehin angeschlagene Verhandlungsposition mit dem Westen. Der erhoffte Zustrom ukrainischen Getreides und kaukasischen Öls blieb aus. Mit der Aussichtslosigkeit der militärischen Lage spitzte sich die Katastrophe mit dem Hunger und der Truppenverzehrung an beiden Fronten zu. Über die deutsche Verhandlungsfähigkeit entschied der Geist der Generäle, die von Politik nichts wussten, politische Wege als Umwege betrachteten und an Ludendorffs Ausspruch festhielten, dass Kriege auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Das kam schließlich den Deutschen bitter zu stehen. Es war eine Tragik, dass die verheerenden Kriegsereignisse mit der deutschen Aussichtslosigkeit auf einen Sieg die Machtstellung der Generäle nicht zu schmälern vermochte, dass an ihrer Spitze Hindenburg und Ludendorff den Kaiser wie eine Puppe vor sich her schoben, der es sich aus angeborener intellektueller Engstirnigkeit und ebenso angeborener kaiserlich prunkhafter Dünkelhaftigkeit noch gefallen ließ und die erschöpfte Truppe Ende Mai zur Großoffensive mit dem Ziel Paris beschwor. Da fragte der Prinz Max von Baden den General Ludendorff: „Was geschieht, wenn die Offensive misslingt?“ Dann muss Deutschland eben zugrunde gehen“, soll ihm der General geantwortet haben. Es gab verlustreiche Anfangserfolge, dann kam die Offensive ins Stocken und die Schlacht wurde abgebrochen. Prinz Rupprecht von Bayern schrieb in sein Tagebuch, was viele dachten, doch nur wenige aussprachen: „Nun haben wir den Krieg verloren.“ Im Reichstag wurde von der Notwendigkeit neuer politischer Methoden gesprochen, da es sich gezeigt hatte, dass die militärischen Unternehmungen nicht zum Ziel führten. Das empörte die in Arroganz erstarrte Generalität, und einer von den Umdenkern mit dem Mut des Aussprechens, der Staatssekretär des Auswärtigen, wurde auf Geheiß von Ludendorff gefeuert. Der letzte Versuch, die belgisch-französische Verteidigungsfront an der Marne zu durchbrechen, wurde im Juli gemacht und am 17. Juli unter den schwersten Verlusten wieder abgebrochen. Für die erschöpften deutschen Soldaten quälte sich das fürchterliche Ende in die Länge, denn nun übernahmen die westlichen Alliierten die Angriffsinitiative, die am 8. August zu ihrem ersten großen Erfolg führte. Nach dem gegnerischen Erfolg teilte Ludendorff dem Kaiser mit, dass nicht mehr damit zu rechnen sei, „den Kriegswillen unserer Feinde durch kriegerische Handlungen zu brechen.“ Es waren die Borniertheit und Verblendung der Generäle mit dem Kaiser als die oberste Heeresleitung an der Spitze, dass die Mahnungen, die sich mehrten, nicht zur Kenntnis genommen und die neuen politischen Methoden nicht zur Anwendung kamen. Der militärische Apparat steckte fest, die Offiziere warteten auf die Befehle Ludendorffs, die nicht kamen, und taten nichts. Sie erstarrten im Phlegma der Befehlshörigkeit. Es jammerte und verbitterte die ausgemergelten Soldaten, dass aus den Siegern von vor vier Jahren nun die Verlierer wurden, dass die unsagbaren und unzählbaren Opfer alle umsonst gewesen waren. Während die Truppe an der Front hungerte, am Senfgas erstickte und sinnlos verblutete, passierte in Berlin nichts. Mit dem Zerfall der deutschen Front lösten sich die Verbündeten, die Bulgaren und Österreicher, die sich um die russische und rumänische Beute zankten, aus dem deutschen Verband. Sie ergaben sich dem Gegner bedingungslos. Österreich suchte nach einem Sonderfrieden, als die Front in Italien wankte und die türkische Front zusammenbrach. Die Parteien im Reichstag, vom Zentrum über die Fortschrittler bis zu den Sozialdemokraten und den annexionsfreudigen Nationalliberalen, übten ihre Kritik an der miserablen Situation, ohne deshalb ein Programm zur Lösung aufzustellen noch an die Macht zu drängen, in deren Ausübung sie ja auch völlig ungeübt waren, vielmehr erwarteten sie die Entscheidung mit der Tat vom Kaiser, der am 30. September den Erlass verkündete, dass das Volk wirksamer als bisher an der Bestimmung der vaterländischen Geschicke mitwirken solle. Darauf nahm nach kurzer Tätigkeit der sensible Reichskanzler, Georg Freiherr von Hertling, seinen Abschied. Der Erlass ging in Richtung parlamentarische Monarchie, war aber unseligerweise mit dem Erlass vom Vortag verknüpft, den Gegner um einen sofortigen Waffenstillstand zu ersuchen, währenddessen man in die Friedensverhandlungen eintreten könnte. Als neuer Reichskanzler versuchte sich der vom Kaiser vorgeschlagene badische Thronfolger, Prinz Max, weil er in der verfahrenen Situation aufgrund seiner politischen Klugheit, Redegewandtheit und sittlichen Integrität als der beste Vermittler zwischen den alten und neuen Mächten und zwischen den Kriegsgegnern auserkoren wurde. Es ging nun darum, die belgische Souveränität wiederherzustellen und durch kluge Zugeständnisse auf die angelsächsische Meinungsbildung einzuwirken. Im März hatte man auf den Prinzen nicht gehört, als der Augenblick für eine Verhandlungspolitik günstig gewesen war. Nun, nach der Kette von Niederlagen war dieser Augenblick vertan. Der Prinz dachte an eine Schadensbegrenzung durch einen Verlustfrieden, der sich in Grenzen halten sollte, um einer bedingungslosen Kapitulation vorzubeugen. Um dieser Politik Nachdruck zu verleihen, forderte er die Heeresleitung um das Durchhalten der Truppe für einen weiteren Monat auf, um die deutsche Armee zu retten, sie vor der letzten Schande der Niederlage zu bewahren. Doch Ludendorff bestand auf dem sofortigen Waffenstillstand, dem schließlich der Prinz nachgab, der Forderung nachgeben musste und damit seine, die bessere deutsche Verhandlungsposition aufgab, die dann auch für immer verloren ging. Der bornierte Ludendorff hatte das politische Problem der Aushandlung des Waffenstillstandes nicht kapiert; das sollten die erschöpften und verstümmelten Soldaten noch bitter zu spüren bekommen. Die Alliierten gönnten den Deutschen keine Waffenruhe. Von Ritterlichkeit war keine Spur; nur der Vorteil galt. Die Arroganz der Generalität, gepaart mit der größten politischen Dummheit, musste der deutsche Soldat auf den blutigsten Schlachtfeldern bis zur eigenen Blutlosigkeit ausbaden. Ein deutscher General bemerkte zu der sich anbahnenden Katastrophe: „Das haben wir unserer Torheit und Selbstüberhebung zuzuschreiben. Seit Jahr und Tag war meine große Sorge, dass Ludendorff den Bogen unserer Kraft überspannen würde.“ Die oberste Heeresleitung dachte weder politisch noch psychologisch an die Folgen, die ihr Waffenstillstandsangebot auf die Massen in Deutschland haben musste. Dort war es still, wo man noch vor wenigen Monaten im Taumel des russischen Beutefriedens schwelgte.
Durch den Regen hatte sich der Postmann verspätet. Es war gegen zwölf, als er sein Fahrrad vor dem Haus anhielt und die Post durch den engen Briefschlitz in der Tür warf. Luise Agnes hörte das dumpfe Geräusch beim Durchschieben der Sendung, die auf den Flur fiel, und das Zuschlagen der metallnen Klappe über dem Schlitz. Sie öffnete die Tür, um dem Postmann einen guten Tag zu wünschen, sah ihn aber mit Postmütze und Regenjacke für alle Fälle auf dem Fahrrad davonfahren. Nach einem Blick auf die Straße, auf der große Pfützen standen, das ablaufende Wasser in den Gossen floss, und nur wenige Menschen waren, die zu Fuß oder auf Rädern unterwegs waren und sich um die Pfützen herum bewegten, schloss sie die Tür, hob die Post vom Boden und brachte sie ihrem Mann, der in seinem Arbeitszimmer am kleinen Schreibtisch saß und zu Papier brachte, was zu schreiben er für notwendig hielt. „Hier ist die Post; ich hatte nicht mehr mit ihr gerechnet nach dem schweren Regenguss am Morgen.“ Sie legte ihm den Schlesischen Anzeiger und die zwei Briefe auf den Tisch. „Ich danke dir“, sagte Eckhard Hieronymus und bat seine junge Frau um eine Tasse Kaffee. Er unterbrach seine Schreibarbeit, öffnete mit dem Bleistift beide Umschläge und zog die zwei handbeschriebenen und zusammengefalteten Blätter aus dem ersten Umschlag. Es war der Brief von seinem Vater, der andere mit dem offiziellen Schreiben kam vom Konsistorialrat Braunfelder. Natürlich begann er das Lesen mit dem Brief seines Vaters, Georg Wilhelm Dorfbrunner, der Oberstudienrat und stellvertretender Rektor am Stiftsgymnasium für Knaben in Breslau war, an dem er Geschichte und Geographie in der Oberstufe unterrichtete. Es war ein langer Brief mit drei beschriebenen Seiten. Am Schriftbild, dem eine gewisse Nervosität abzulesen war, weil manche Zeilen schief hingen, meist am Ende leicht kurvig abfielen, einige Worte durchgestrichen und durch andere überschrieben waren, und der Schriftzug im Allgemeinen nicht mehr die flüssige Eleganz und Schönheit hatte, wie er sich in früheren Briefen auszeichnete, sondern sich in ihm etwas Krakelhaftes eingenistet hatte, erkannte der Sohn nicht nur das zunehmende Alter des Vaters, der drei Jahre vor dem Pensionsalter stand, sondern vielmehr eine innere Unruhe, die ihm Sorgen machte. Kannte er doch seinen Vater als einen willensstarken Mann von hoher Disziplin und großem Fleiß, der fest im reformierten Glauben stand und sich von Dingen, selbst wenn sie unvorhergesehen hereinbrachen, nicht so schnell erschüttern ließ. Dann setzte Eckhard Hieronymus zum Lesen der väterlichen Briefes an, schaute zuvor noch einmal ans Ende auf der dritten Seiten, wo der Brief mit „In Liebe und Gott befohlen! Dein sich sorgender Vater“ abschloss. Dann las er von Anfang an und ließ sich beim Lesen viel Zeit, suchte und untersuchte den Inhalt nicht nur eines jeden Satzes, sondern eines jeden Wortes, achtete, wo der Vater Punkt und Komma setzte und fuhr mit dem Wunsch, sich an die Kindheit möglichst genau zurück zu erinnern, und mit der Anhänglichkeit eines Kindes dem Schriftzug buchstäblich nach.
Der Brief sei seiner Bedeutung wegen, die er für den Sohn Eckhard Hieronymus Dorfbrunner zeitlebens behielt, hier wiedergegeben:
Breslau, den 3. November 1918
Mein lieber Sohn!
Deine Mutter und ich hoffen, dass es Dir und Luise Agnes gut geht. Unsere Gedanken sind täglich bei Euch. Auch nachts, wenn wir nicht schlafen können, sprechen wir immer wieder von Euch, wie es Euch wohl gehen mag, wie Du Dich in Deinem Beruf entwickelst, ob Du stark genug bist, den Herausforderungen kraftvoll entgegenzutreten, ob Du das Vertrauen der Menschen Deiner Gemeinde gewinnst, was Du heraushören kannst aus dem, was sie Dir sagen, und wie sie zu Dir sprechen. Wir sprechen von Luise Agnes und ihrer Schwangerschaft, die sie hoffentlich gut verträgt. Es erfüllt uns mit Dankbarkeit und Glück, dass Ihr auf gutem Wege seid, eine Familie zu gründen; wenn wir uns auch Sorgen um die Zukunft machen, in die Ihr mit dem Kind hineingehen werdet.
Wie Ihr wisst, gehen wir in eine Zukunft hinein, die voller Ungewissheit ist, die für viele Menschen Elend, Trauer und bittere Armut bringen wird. Der Vaterländische Krieg ist so gut wie verloren; und verloren sind so viele unserer besten Söhne. Deutsche Männer, die mit Elan und Idealismus an der F ront gekämpft haben, werden nicht mehr zurückkehren; sie sind auf den Schlachtfeldern für das Vaterland verblutet, sie haben das größte Opfer gebracht. Wer weiß, wer von den Soldaten zurückkommen wird; wer weiß, wie verkrüppelt sie heimkommen werden, dass sich die Väter erschrecken und die Mütter in Ohnmacht fallen werden. Diese Ungewissheit gilt ebenso für Deine Brüder Friedrich Joachim und Hans Matthias, von denen uns die letzten Feldpostbriefe vor gut einem Jahr erreichten. Ob sie noch leben oder auch ihr Leben dahingeopfert haben, wir wissen es nicht. Die Mutter trauert bereits um ihre Söhne, sie hat den Appetit verloren und wacht nachts mit schrecklichen Träumen auf. Ich warte ab und versuche mich zu fassen, wenn die Söhne vor der Tür stehen werden oder der Postbote mit der Nachricht vom Schlimmsten. Du kannst Dir vorstellen, wie das Warten an unseren Kräften zehrt. Seit Wochen leide ich daran, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. So habe ich kürzlich im Unterricht Geschichtsdaten durcheinander geworfen, wo ich den ersten punischen Krieg mit dem Kampf um Troja verwechselte. Ein Schüler hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Das hatte keinen guten Eindruck hinterlassen. Auch in der Geographie bin ich mir vor Verwechselungen nicht mehr sicher. Soweit ist es also mit mir schon gekommen! Da überkommt mich das Gefühl des Schämenmüssens, wo ich doch ein guter Lehrer mit fundierten Kenntnissen war. Die Sorgen haben unsere Haare grau, Mutters Kleider und meine Anzüge weit gemacht. Nein, es steht nicht gut um unsere Zukunft! Die Menschen bangen und fürchten das Schlimmste. Die Armut grassiert schon jetzt wie eine unheilbare Krankheit; bald wird das Elend unbeschreiblich werden, wenn erst die Trauer mit dem Wissen um die verlorenen und verstümmelten Männer, Väter und Söhne dazukommt.
Wie Du sicher in der Zeitung gelesen hast, steht das deutsche Staatswesen kurz vor dem Zerfall. In Berlin ist die Hölle los. Im Reichstag beschimpfen sich die Abgeordneten. Da ruft der Konservative von Heydebrand in den Saal, dass die Deutschen von der Generalität belogen und betrogen wurden, von Ludendorffs Siegeszuversicht nichts weiter als eine böse Täuschung war; der Sozialdemokrat Ebert erlitt einen Schwächeanfall, der Nationalliberale Stresemann rang mit seiner Stimme und wurde nieder gebrüllt. Die Ordnung ist aus den Fugen geraten! Wir haben das Gold für das Eisen gegeben, und wir gaben es im guten Glauben und in bester Absicht. Das Gold ist weg, und mit ihm so viele unserer Söhne. Das Ergebnis des Krieges ist die blanke Katastrophe. Es ist kaum zu fassen. Ich muss Dir sagen, dass die Heeresleitung (‘die Heeresleitung’ durchgestrichen und mit ‘der Kaiser’ überschrieben) das deutsche Volk verraten hat. Es ist schon unglaublich, was die Führung tat und sich nun zum Ergebnis in Schweigen hüllt. Die Führung lässt das Volk im Stich, lässt es verhungern, im Meer des Elends ertrinken; das dann, wenn das Volk die Führung am nötigsten braucht. Nein, um unsere Zukunft ist es nicht gut bestellt! Es ist an der Zeit, dass wir uns auf die Knie begeben, uns tief vor unserem Schöpfer verneigen und um seine Vergebung und seinen Schutz bitten. Wir müssen das Beten lernen, dass uns nicht auch noch der Herr verstößt.
Grüße bitte Deine liebe Frau. In Liebe und Gott befohlen! Dein sich sorgender Vater
Eckhard Hieronymus Dorfbrunner las den Brief dreimal und ging dann mit ihm in die Küche, um ihn seiner jungen Frau zu zeigen, die mit vorgebundener Schürze und leichter Wölbung ihres Unterbauches das kochende Kartoffelwasser in einen Eimer abschüttete. Mit schnellem Blick begriff sie die Betroffenheit ihres Mannes und damit den Inhalt des Briefes in seiner Zusammenfassung. Doch der zweite Blick in sein Gesicht, nachdem sie den Topf mit den Kartoffeln auf den Herd zurückgesetzt hatte, sagte ihr, dass sie die Spannung mildern, auflösen, dass sie sprechen solle. „Wie geht es den Eltern? Sind sie gesund? Was schreiben sie; was wissen sie von deinen Brüdern zu berichten?“ Es waren viele und doch wenige Fragen, die Luise Agnes in ihrem Versuch stellte, Entspannung in das Gesicht von Eckhard Hieronymus Dorfbrunner zu bringen. „Lies ihn selbst, er ist sehr reichhaltig; Vater hatte sich viele Gedanken gemacht!“ Er hielt sich mit seinem Kommentar zurück, weil er wollte, dass seine Frau unbeeinflusst den Brief lesen sollte. Auch sagte er nichts über die schräg nach unten gehenden Zeilenenden, über die durchgestrichenen und überschriebenen Worte sowie über das Krakelhafte, das sich in seinen Schriftzug eingeschlichen, ihm die Eleganz und Schönheit genommen hatte. „Lass mich das Mittagessen bereiten, es ist schon spät; ich werde den Brief nach dem Essen lesen“, sagte Luise Agnes. Eckhard Hieronymus verstand ihre Bitte und legte den Brief an ihren Platz auf den Esstisch, der mit den zwei großen flachen Tellern und dem dazugehörigen Besteck sowie den eingerollten Servietten in ihren Ringen bereits gedeckt war. Er ging in sein Arbeitszimmer zurück, um den zweiten Brief zu lesen, den Konsistorialrat Braunfelder geschickt hatte. Das war ein förmlich gehaltener, auf der Schreibmaschine getippter Brief, auf dem sich oben links der Absender in fett gedruckten Buchstaben des größeren Formats, wie folgt, zu erkennen gab: Lic. August Braunfelder (1. Zeile), Konsistorialrat (2. Zeile), wobei ‘Lic’ für Lizentiat stand, dem Abschluss des Studiums mit dem theologischen Hochschulgrad, vergleichbar mit dem „D. theol.“. Der Adressat war dagegen in mageren Druckbuchstaben des kleineren Formats zu lesen. Wie schon gesagt, es war ein förmliches Schreiben, das in fünf Zeilen mitteilte, dass Herr Eckhard Hieronymus Dorfbrunner die Stelle
als zweiter Pfarrer an der Elisabethkirche der Großgemeinde Dubrau zunächst auf Probe erhalten habe. Die Probezeit erstrecke sich auf ein Jahr. Das Monatsgehalt im Probejahr entspreche der Hälfte des normalen Pfarrgehalts. Zum Gehalt komme noch die Heizungszulage, die ungekürzt ausgezahlt wird. Im letzten Satz wünschte der Konsistorialrat dem Neuling alles Gute und endete sein Schreiben mit „Gott befohlen, Ihr A. Braunfelder, D. theol., Konsistorialrat“. Die Unterschrift stand an Größe dem Briefkopf vom größeren Format nicht nach. Handschriftlich hatte der Konsistorialrat unter „P.s.:“ noch angemerkt, dass er der Predigt am kommenden Sonntag über den 1. Korintherbrief, 8. Kapitel, mit großem Interesse entgegensehe.
Es entging dem Leser nicht, dass er zwei Briefe erhielt, in denen sich die Absender in gleicher Weise verabschiedeten, indem sie den Empfänger Gott befahlen, gemeint war wohl, ihn (gedanklich) zum lieben Gott schickten, ihm anbefahlen, ihn ans „göttliche Herz“ legten, im Sinne von angelegen sein lassen, wenn von der „Liebe“ im Brief des Vaters und vom handgeschriebenen Zeilenzusatz des Konsistorialrats mit der Interessenbekundung an der noch zu haltenden Predigt einmal abgesehen wird. Im zweiten Brief stach durch die Kürze mit dem auf eine Fünfzeilenlänge gerafften Inhalt die Symmetrie von oben und unten, und umgekehrt, unwillkürlich ins Auge. Da begann der Brief oben so, wie er unten endete; es waren Name und Titel, mit dem er begann und endete. Man könnte auch von einer Art Spiegelung sprechen, die immer dann in Funktion tritt, wenn es mit einem Mal nicht getan ist, weil da zu Wichtiges mitzuteilen und dem Leser wie ein Balken aufs Auge zu drücken war, damit er den Schwerpunkt nicht aus dem Auge und der Nachschaltung zum Gehirn verliert. Von der großen, Platz einnehmenden Fläche füllenden Unterschrift des Konsistorialrates nahm sich die kleine, leicht verkrakelte Unterschrift mit dem „Dein sich sorgender Vater“ recht bescheiden aus. Überhaupt gab es Unterschiede im Anliegen und Inhalt der beiden Briefe. So lag der Schwerpunkt des väterlichen Briefes zweifelsfrei im Inhalt, der so voll und schwer war, dass er sich nach unten ausbauchte, mit dem Kiel tief in die Katastrophe des Zeitgeschehens hineinragte, wo es auf den Namen des Schreibers nur noch wenig, oder gar nicht mehr ankam. Diese Versenkung des Bauches mit dem Kiel nach unten gab es im zweiten Brief nicht, dafür war der Inhalt nicht schwer genug, nein, er war geradezu dürftig. Die fünf, auf der Schreibmaschine getippten Zeilen spannten sich wie ein Seil von einem Namensturm zum andern, auf dem in luftiger Höhe von der Kirche zum Rathaus, und wieder zurück balanciert werden konnte, mit Balancierstange und kreppsohligen Seilschuhen. So inhaltlich schwer der eine Brief war, dessen Schwere erschütterte, so wenig wog der andere. Dieser andere Brief mit der fünfzeiligen Dürftigkeit und der angefügten handgeschriebenen Warnzeile war ein Höhen- oder Luftbrief, an dem bis auf die existentielle Erschwerung durch das angekündigte Probejahr mit dem halben Pfarrgehalt sonst keinerlei inhaltliche Gravidität zu ermessen war.
Sie hatten das Mittagessen ohne die übliche Gesprächigkeit eingenommen, weil es Eckhard Hieronymus nach den Briefen, vor allem den des Vaters, nicht zum Sprechen zumute war. Er dachte an seine Brüder, fragte im Stillen, ob sie noch lebten, dachte an die Eltern, wie sie sich in der Sorge verzehrten, dachte an die Schwangerschaft seiner Frau und an die Zukunft, um die es nach den Worten des Vaters schlecht bestellt sei. Luise Agnes sah die gedrückte Betroffenheit seinem Gesicht an, die sich abträglich auf seinen Appetit niedergeschlagen hatte, dass sie ihn zum Essen regelrecht anhalten musste. Sie wollte ihn in dieser Situation in Ruhe lassen, weil sie, das wusste sie, auf die möglichen Fragen, die er stellen würde, auch keine Antwort wusste, die ihm die Last vom Herzen nehmen könnte. Sie hatten das Dankgebet gesprochen, als ihn Luise Agnes zu einem Spaziergang ermunterte, während sie den Tisch abräumen, Geschirr, Bestecke und Töpfe spülen und in der Küche Ordnung machen wolle. Auch hatte sie vor, den Brief des Schwiegervaters zu lesen, was sie mit Muße tun wolle. Eckhard Hieronymus nahm den Vorschlag mit dem gemischten Gefühl an, weil er seine junge Frau in einer Zeit wie dieser nicht gern allein lassen wollte. Sie machte ihm die Entscheidung leichter, holte Schal und eine warme Jacke aus dem Schrank, legte ihm mit zarter Hand den Schal um den Hals, den sie unter dem Kinn verschlang, half ihm in die Jacke, stellte die wasserfesten Schuhe vor den Stuhl, auf den er sich setzte, um die Füße hinein zu schieben und die Schuhe über den Laschen zu verschnüren. Sie begleitete ihn bis zur Tür, gab ihm einen Kuss auf die rechte Wange und sah ihm noch eine Weile nach, wie er mit seinen Gedanken die Straße entlang ging und in Pfützen stapfte, die er nicht zu registrieren schien. Als er nach etwa hundert Metern rechts abbog, die enge Straße in Richtung Elisabethkirche einschlug, schloss sie die Tür und begann mit dem Abräumen des Tisches. Sie änderte ihren Plan mit dem erst das Spülen und Aufräumen der Küche und dann dem Lesen des Briefes. Nachdem der Tisch abgeräumt und die Tischdecke glatt gezogen war, setzte sie sich auf ihren Stuhl, holte die zwei Blätter des auf drei Seiten beschriebenen Briefes aus dem Umschlag und las. Da sie Briefe des Schwiegervaters Georg Wilhelm Dorfbrunner früher schon gelesen hatte, fiel auch ihr die verlorene Eleganz im Schriftzug mit dem Krakelhaften und die Wortdurchstreichungen mit den Überschreibungen auf, denn das war ihr bisher in den Briefen so krass nicht aufgefallen. Es wird seine Gründe haben, dachte Luise Agnes und las behutsam Satz für Satz. Sie spürte die Sorge, aber auch die Wärme, die aus dem ersten Abschnitt sprachen, als von ihren täglichen und nächtlichen Gedanken, vom Beruf ihres Mannes, den Anforderungen und der Kraft die Rede ist, die zur Bewältigung der Aufgaben erforderlich ist, wenn der Vater von ihrer Schwangerschaft schreibt, dass sie, die Eltern, die Familiengründung mit Dankbarkeit und Glück erfüllt, aber sich Sorgen um die Zukunft macht. Beim Lesen des zweiten Abschnittes fühlte sie, wie die Übelkeit in ihr aufstieg, als da die Rede vom verlorenen Krieg, der Ungewissheit mit dem Verlust der Söhne, von der Trauer, dem Elend und der bitteren Armut ist. Ihr schwammen die Zeilen vor den Augen davon, als es auf das unsägliche Leid mit der Schlaflosigkeit und körperlichen Verzehrung, auf den Konzentrationsverlust im Unterricht mit den Verwechselungen von Geschichtsdaten zuging. Die Zeilen schlugen wie ein Gewitter auf sie ein; ihr wurde schwarz vor Augen, musste sich am Tisch festhalten, um nicht vom Stuhl zu kippen. Hier wurde ausgesprochen, was sie mit ihren Jahren noch gar nicht fassen konnte. Da fühlte sie sich doch noch als ein hilfloses Kind, das die Hand hebt, sie weinend dem Älteren entgegenstreckt, um über so einen Menschenplatz geführt zu werden, wo der Tod und das Leben als Zwillinge herumhuschen, ihre Grimassen schneiden, Laute machen und nicht nur Kinder erschrecken, sondern selbst Schreckerprobte in der Sprachlosigkeit erstarren lassen, als würde ihnen mit einem Schlag das Auge erblinden, das Ohr vertauben, die Zunge und Atmung erlahmen. Luise Agnes weinte, sie weinte heftig, und das Weinen dauerte Minuten, dass sie das Lesen unterbrach. Tränen tropften auf den Brief, die sie unvollständig wegwischte und dabei vollständiger die Tinte mit den Buchstaben und Worten verschmierte. Sie kam sich nicht neu, aber anders geboren vor, als sie die Sinne einigermaßen eingefangen und sich in ihrer Persönlichkeit gefangen hatte und von neuem den Versuch unternahm, den zweiten Abschnitt mit den angeführten Punkten zu lesen. Es wurde ihr schwer beim Lesen, fürchterlich schwer ums Herz, als kämen von jeder Zeile Pfeile geschossen, die sie träfen, was gar nicht die Absicht des Schreibers war; das fand sie heraus, je mehr sie darüber nachdachte, von Zeile zu Zeile, ja, von Wort zu Wort nachdachte, was sie im Augenblick gelesen hatte.
Eckhard Hieronymus hatte den Weg zur Elisabethkirche tatsächlich genommen. Beim Gang durch die Straßen trug er den Brief des Vaters über den Augen, dass er auf das Pfützige, und was der schwere Regenguss sonst noch auf die Straße geschwemmt hatte, nicht achtete. Er betrachtete sich die Kirche von außen, deren Glocke mit dem Zweifachschlag den Beginn der zweiten Stunde verkündete. Um die Kirche herum stand der Rasen unter Wasser; ein See lag auf dem Kirchplatz und den abgehenden Wegen vor dem Westportal. Er setzte sich auf eine der drei Bänke im See und blieb mit den Gedanken bei den Eltern, den Brüdern, und was der Vater in seinem Brief sonst noch geschrieben hatte. Eckhard Hieronymus meditierte und ließ den Blick vom Turm zur alten Portaltür mit dem Bogen, zur geschwungenen Klinke mit dem schmiedeeisernen Knauf, zur Türaufhängung mit den langen, aufgeschraubten, kunstvoll gewirkten Scharnieren, die Südfront entlang mit den drei buntgläsernen Kirchenfenstern der mittleren Höhe streifen. Er sah in alte Lindenbäume, von denen einige die Kirche säumten, sah in die vollblättrigen Kronen hinein, aus denen das Wasser tropfte. Der Kirche gegenüber stand das zweistöckige Haus, in dem der Konsistorialrat unten das Büro und oben die Wohnung hatte. Ein Fenster im Parterre stand offen; da hinein schickte Eckhard Hieronymus Dorfbrunner einen Teil seiner Gedanken, die dem inhaltsdürftigen Fünfzeilenbrief mit dem handgeschriebenen Zeilenzusatz mit der Interessensbekundung an der zu haltenden Predigt über den 1. Korintherbrief, 8. Kapitel, galten. „Ich werde die Predigt halten“, schrie er im Geiste über den Kirchplatz dem Konsistorialrat in das eine, dann in das andere Ohr, dass sich dieser Herr, der im Körperbau mehr untersetzt war, als ihm lieb sein mochte, in seinem Schreibtischstuhl zurücklehnte und große Augen machte. Überhaupt war der Rat dem angehenden Pfarrer mit der verordneten einjährigen Probezeit zum halben Monatsgehalt nicht gerade sympathisch. Die Sympathie verscherzte sich der kurze Rat mit dem Lic. vor seinem großformatig gedruckten Namen im Briefkopf durch sein lehrerhaft wichtigtuerisches Auftreten mit der nicht aufzuhaltenden, bis auf den Geist gehenden, belehrenden Geschwätzigkeit. Hätte er die Weisheit des Zuhörens, das Gespräch könnte durchaus fruchtbar sein. Es waren der verlorene Weltkrieg, der so viele Opfer gekostet hatte, der Verrat an den hohen vaterländischen Idealen, der Besorgnis erregende Zustand der Eltern, die Ungewissheit, ob die Brüder noch lebten, wenn ja, wie sie wohl zurückkehren würden, die Schwangerschaft seiner Frau mit dem zu rwartenden Zuwachs, wenn keine Probleme zwischendrin auftreten, die Situation als Pfarrer der zweiten Pfarrstelle auf Probe mit dem halben Monatsgehalt, und die Predigt am kommenden Sonntag, die ihn beschäftigten, so stark beschäftigten, dass er es zu spät bemerkte, als das Wasser bereits in seine Schuhe drang. Er sah über das Wasser und kam sich auf der Bank wie auf einer einsamen Insel vor, die für ihn zurückgelassen war, wo er keinen ansprechen oder um Rat, oder gar um Hilfe fragen konnte. Doch das hatte er von seinem Vater, dem Oberstudienrat Georg Wilhelm Dorfbrunner gelernt, der ihm da einige Beispiele aus seinem Leben nannte, dass in einer schwierigen Situation nicht mit der Hilfe anderer, in Ausnahmefällen vielleicht mit einem guten Rat von Menschen zu rechnen sei, die oft nicht einmal angestammte Freunde waren. So saß Eckhard Hieronymus Dorfbrunner noch auf der Bank, als die Kirchenglocke ihre vier Schläge tat. Das Wasser stand in den Schuhen, in den Zehen kribbelte die Kälte, und im Kopf überschlugen sich die Gedanken im Salto mortale. Er trat den Rückweg an, stapfte durch das Wasser, zog sich die Mütze tief in die Stirn, steckte die Hände tief in die Jackentaschen und nahm den Weg, auf dem er gekommen war. Beim Wassertreten über den Kirchplatz ist ihm entgangen, dass der Konsistorialrat aus dem Fenster schaute, wobei er ihn gesehen haben musste und sich seine Gedanken machte, was denn der neue Pfarrer auf Probe auf dem Kirchplatz suchte, der doch weit und breit unter Wasser stand.
Es waren wenige Menschen unterwegs, die meist Frauen mit Körben und Taschen waren, weil es zum Austausch der Männer in den Gruben, dem Schichtwechsel, erst gegen fünf kam. Ohnehin gab es mehr Frauen als Männer in der Stadt, weil viele der Männer, der Väter und Söhne, wenn sie sich nicht im ersten Kriegsjahr freiwillig zum Fronteinsatz gemeldet hatten, später, als die Zahlen der Toten bereits ins Astronomische gingen, per Befehl zum Kampf mit der Waffe einberufen wurden. Die Einsicht kam spät, dass die Siegeszuversicht, wie sie Ludendorff und andere Generäle verkündeten, nicht mehr als eine Parole zum Durchhalten im gnadenlosen Kampf an der Front, im Spenden des restlichen Goldes und der sonst noch verbliebenen Wertsachen für die vaterländische Sache, und vor allem zum Durchhalten des Hungers und der rapide zunehmenden Armut. Die Zuversicht gründete sich auf ein Kartenhaus der falschen Tatsachen und wäre geräuschlos zusammengeklappt, wenn die Wahrheit zur rechten Zeit erkannt worden wäre. Nun kam sie zu spät, viel zu spät, und mit fürchterlichen Schlägen. So war es kein Wunder, dass etliche der vielen Männer nicht mehr in die Stadt zurückkehren würden. Das war den ernsten, teils melancholischen, teils depressiven Frauengesichtern ebenso anzusehen wie den blassen Faltengesichtern der Alten, die es meist stumm ertrugen, dass ihre Söhne auf den Schlachtfeldern blieben. Es waren die Alten, die das Leben bereits verbraucht hatte, die sich nun um die jungen Familien kümmerten, mit ihnen das Letzte des Ersparten teilten und sich den schulischen Aufgaben der Enkelkinder widmeten, wenn die Mütter als Haushaltshilfe in Häusern der gehobenen Mittelklasse, als Putzfrau in Büros oder als Serviererin oder Barfrau verdingten oder als Animierdame mit den animierten Folgen den Lebensunterhalt, mehr schlecht als recht, bestritten. In Anbetracht der Armut, die epidemische Ausmaße angenommen hatte, mit dem schneidenden Schmerz von Verlust und Hunger verwunderte es nicht, dass die Zahl der Jugendlichen mit den Kindergesichtern in erschreckendem Maße zugenommen hatte, die da in die Schächte untertage befördert wurden, um die Quoten der Kohleförderung in etwa zu halten. Es gab wieder Kinderarbeit in den Gruben, obwohl mutige Leute, wie der linksliberale Abgeordnete, der Anthropologe und Pathologe Rudolf Virchow, die skandalösen Verhältnisse der Kinderarbeit in den schlesischen Gruben mit den frühen Gesundheitsschäden, und die erbärmlichen, unhygienischen Lebensbedingungen der Arbeiter und ihrer meist kinderreichen Familien im preußischen Landtag auf das Heftigste angeprangert hatten.
Eckhard Hieronymus Dorfbrunner war auf dem Heimweg zur Wagengasse 7, als er an einer Kneipe vorbeikam, deren Tür offen stand, vor der eine junge Frau mit einer leeren Tasche um ein Almosen bat, weil sie zu Hause drei Kinder habe, die an diesem Tag noch nichts zu essen bekommen hatten. Irritierend war das Stimmengewirr vor der Theke, wo sich offensichtlich Männer die Meinungen so laut sagten, dass sie auf der Straße zu hören waren. Nun kommt zum verlorenen Krieg und der Armut der Alkohol dazu, dachte er bei sich, holte eine Münze aus der linken Jackentasche und gab sie der jungen Frau. Zu Hause wartete Luise Agnes nicht ohne Sorge, weil sie mit einem so langen Spaziergang ihres Mannes nicht gerechnet, ihn auch nicht für einen so ausgedehnten Gang ermuntert hatte. „Wo warst Du denn gewesen, es ist gleich fünf, und Du wolltest noch an der Predigt arbeiten“, fragte sie ihn, als er sich die Schuhe und nassen Strümpfe an der Türschwelle auszog. Barfüßig und leicht irritiert stand er vor seinen jungen, besorgten Frau, mit den Schuhen in der linken und den Strümpfen in der rechten Hand, gab ihr einen Kuss auf die Stirn und begann beim Gang in die Küche, den sie gemeinsam taten, von der Bank im See vor der Elisabethkirche zu erzählen, auf der er sich wie ein Einsiedler auf einer einsamen Insel vorgekommen sei. Er listete die Gedanken auf, die ihm auf der Bank durch den Kopf gegangen waren, und sagte im Versuch, sie zusammenzufassen, dass der Vater so unrecht nicht habe, wenn er in seinem Brief von einer schweren Zukunft spricht. Luise Agnes, die den Brief mit einigen Unterbrechungen gelesen hatte, korrigierte ihn, als sie sagte, dass der Vater in seinem Brief einen Schritt weiter geht und von einer Zukunft spricht, um die es nicht gut bestellt ist. „Ja, so hat er sich ausgedrückt, und ich glaube, dass schwere Zeiten auf uns zukommen“, bestätigte Eckhard Hieronymus die Sorge seines Vaters. Er erzählte von der Frau, die vor der Kneipe stand und um ein Almosen bat, die von drei Kindern sprach, die an diesem Tage noch nichts gegessen hatten. Luise Agnes bekam ein trauriges Gesicht, während sie am Herd stand und einen Kaffee aufbrühte. „Das ist ja schlimm!“, sagte sie entsetzt. „Konntest Du ihr etwas geben?“ „Ja, ich gab ihr die letzte Münze, die ich in der Jackentasche hatte.“ Sie setzten sich an den Tisch, schauten einander an und tranken an ihrem Kaffee. „Wie fühlst Du dich?“, fragte er seine junge Frau und dachte bei der Frage auch an das Kind, das, wenn alles gut verläuft, in einigen Monaten in diese Welt kommen würde, der der Vater eine schlechte Zukunft voraussagte, in der, so dachte er weiter, viele Frauen nicht nur vor den Kneipen stehen und um Almosen für ihre hungrigen Kinder bitten werden. Luise Agnes sagte, dass sie von der Schwangerschaft her außer der Zunahme der Brüste und des Bauchumfanges keine Probleme habe; sie müsse jedoch Kleider und Röcke den Gegebenheiten anpassen, sie weiter machen. „Freust Du dich auf unser Baby?“ „Ja, ich freue mich sehr. Was meinst Du, wird es ein Junge werden?“ „Vielleicht. In den Dorfbrunner-Familien gab es mehr Jungen als Mädchen. Das ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir ein gesundes Kind bekommen“, sagte er und lächelte seiner Frau in die Augen. Ihr Lächeln war allerdings verhalten; bei ihr bewegte sich etwas im Kopf, das sie ernst blieben ließ. Eckhard Hieronymus spürte, dass seine Frau etwas auf dem Herzen hatte, das sie bedrückte. Doch wollte er nicht gleich in sie eindringen, wollte ihr den freien Lauf ihrer Gedanken und Gefühle überlassen. „Ich habe den Brief des Vaters gelesen“, sagte Luise Agnes nach einer Minute des nachdenklichen Schweigens, „da sind mir doch die Tränen gekommen, die unglücklicherweise auf den Brief tropften, dass ich beim Wegwischen die Schrift an einigen Stellen verschmierte.“ Er sah sie an und sah, dass ihre Augen feucht wurden. „Das macht doch nichts, meine Liebe, auch mir sind die Tränen gekommen. Der Brief hat mich durchgerüttelt und bis ins Herz erschüttert. Die Eltern verzehren sich in der Ungewissheit über den Verbleib ihrer Söhne.“ „Ja, das tut weh; leid tut mir, dass wir ihnen nicht helfen können. Sie bräuchten jemand, der ihnen in ihrer Not beisteht“, sagte sie mit dem Ausdruck der Trauer. Sie schauten sich an in gegenseitiger Anteilnahme und Betroffenheit. „Vielleicht sollten wir die Eltern besuchen und uns über ihren Zustand vergewissern“, sagte Eckhard Hieronymus. „Das wird schwer sein“, erwiderte seine Frau, „Du fängst als Pfarrer hier gerade an, am Sonntag deine erste Predigt, dann kommen die anderen Gottesdienste mit den Taufen, die Bibelstunden und abendlichen Vespern. Trauungen werden selten sein, weil die Männer fehlen; dafür wird es viele Beerdigungen geben, weil es mehr Menschen sein werden, die das Leben in Armut, Einsamkeit und Hunger nicht mehr aushalten.“ „Ich gebe dir recht, ich kann hier nicht so schnell fort, nicht für eine Woche. Ich will die Menschen nicht enttäuschen. Auch glaube ich, dass Konsistorialrat Braunfelder es nicht verstehen würde, wenn ich ihm sagte, dass ich nach meinen Eltern sehen muss. Der würde erst ein neugieriges Gesicht machen, wenn er fragt, wer von den Eltern denn gestorben sei, weil es sich als schlechte Sitte mehr und mehr einbürgert, dass man nach den Eltern dann sieht, wenn es zu spät ist, wenn sie im Sterben liegen oder bereits tot sind. So würde aus dem neugierigen ein missmutiges Gesicht, wenn Herr Braunfelder erfährt, dass beide Eltern noch leben. Dann würde er womöglich sagen, dass es hier größere Aufgaben zu erledigen gibt, als nach den Eltern zu sehen, von denen keiner gestorben ist, beziehungsweise im Sterben liegt.“ „Was wir aber tun können und mit dem heutigen Tage tun sollten“, setzte Luise Agnes hinzu, „wir werden die Eltern und deine Brüder noch mehr als bisher in unser Gebet einbeziehen. Das sind wir deinen Eltern schuldig, die sich die Entsagungen auferlegt haben, um euch Söhne aufzuziehen, euch die Möglichkeit gaben, das Gymnasium und die Universität zu besuchen; deinen Brüdern sind wir es schuldig, weil sie für das Vaterland gekämpft und im Kampf ihr Leben eingesetzt haben.“ „Ja, das hast Du schön gesagt; wir werden für sie beten, werden ihre Namen im Gebet nennen und sie dem Schutz des Herrn anbefehlen.“
Eckhardt Hieronymus Dorfbrunner erhob sich vom Tisch, während seine Frau mit dem Brief in der Hand, als wollte sie ihn noch einmal lesen, sitzen blieb. Er küsste sie auf die Stirn und bat um ihr Verständnis, dass er nun an der finalen Abfassung der Predigt arbeiten wolle. Er ging in sein kleines Arbeitszimmer, machte die Tür hinter sich und das Fenster vor sich zu und setzte sich an den kleinen Schreibtisch, der den Verfasser der Predigt seit dem zweiten Studienjahr begleitet. Er las noch einmal das 8. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief, obwohl er den Text so gut wie auswendig kannte, dass er ihn in umgekehrter Versfolge hätte aufsagen können. Nach Minuten der Andacht mit dem Blick aus dem Fenster, wo er ein altes Ehepaar mit grauem Kopfhaar, faltigen Gesichtern und nach vorn gekrümmten Rücken nebeneinander gehen sah. Der alte Mann ging links, stützte sich mit der rechten Hand am Stock, die alte Frau ging rechts und hielt den Stock in der linken Hand. Für Eckhard Hieronymus war es ein Blick in die Vergangenheit, denn er sah den vorübergehenden Gesichtern an, dass sie nach was suchten, was sie offensichtlich verloren hatten. Die Last auf den Schultern krümmte ihre Rücken auf eine bedauernswerte Weise; aus den Augen sprach die große Müdigkeit der Erschöpfung. Die beiden Alten gingen nebeneinander. Sie sprachen kein Wort. Es muss wohl so gewesen sein, dass sie sich im Schweigen alles sagten. Er begann, den Predigttext niederzuschreiben:
Liebe Brüder und Schwestern!
Wir leben in einer schweren Zeit, in der Dinge entschieden sind, vor denen wir fassungslos stehen. Das Opfer, das wir brachten, so groß, gewaltig und bitter es auch war, es reichte nicht aus, um ein gutes Ergebnis für unser Vaterland zu erzielen. Wie sagt der Prophet: Wundert euch nicht, ihr werdet es erleben, andere werden die Früchte von den Bäumen ernten, die ihr mit Fleiß und Mühe gepflanzt und verschnitten habt. Der Apostel Paulus, dessen Leben ein einziger Umbruch war, würde sagen: Ihr möget säen; ob ihr die Früchte eurer Saat ernten werdet, das, allerdings, steht in der Allmacht Gottes. Es war die tiefe Betroffenheit des Apostels über das sündige Verhalten der Menschen in ihrer lieblosen Überheblichkeit, der Ichbezogenheit mit der Raffgier nach Geld und Reichtum, dem Streben nach Wohlstand und weltlicher Macht, der Vernachlässigung in der Fürsorge für die Kinder, Schwachen und Waisen, der Zerstörung der Tugenden und Ideale, der Versteinerung der Herzen, wenn gegeben und geteilt werden soll, dass seine Rede, in welcher Gemeinde er auch war, eine Mahnrede zur Besinnung und Läuterung war. Paulus nahm da kein Blatt vor den Mund, wenn er in der Rede versucht, auf verständliche Weise die Ausschweifungen und Irrungen, die der Mensch täglich begeht, aus dem großen Hirnareal des Verdrängens und Vergessenwollens herauszuholen, zu entfalten, den Menschen vor die Augen zu halten und neu zu bezeichnen. Schon zu seiner Zeit war es so, dass die Menschen nicht an ihre schlechten Taten, denen ja die schlechten Gedanken vorausgehen, erinnert werden wollten. Oft waren es gerade die Menschen aus den besseren Kreisen, die sauber gekleidet waren, genug zu essen hatten und sich das Gesicht der Leutseligkeit aufsetzten. Das hatte Paulus auch gesehen, wenn ihm die Falschgesichter mit der gelogenen Betretenheit gegenübertraten, ihre scheinheiligen Sprüche klopften und sich enttäuscht, ja beleidigt abwendeten, wenn ihnen der Apostel den Spiegel der Schlechtigkeit vorhielt, den er zuvor vom Sandstaub des Weges gereinigt hatte. Er hielt praktisch den Spiegel direkt vor die Gesichter, dass sich die Betroffenen selbst in ihren Lügen und Betrügereien sehen konnten. Manche mochten sich im Spiegel nicht erkennen, einige drückten das eine oder andere Auge zu, andere stellten sich blind. Da platzte dem Apostel der Kragen, der dann mit Worten nachhalf, die scharf genug waren, um die Heuchler und Täuscher mit dem scheinheiligen, leutseligen, unbekümmerten Falschgesicht ins Fleisch zu schneiden.
In dieser klärenden Weise, der stets die Beispiele der Taten vorangestellt wurden, tat es Paulus auch mit den Menschen von Korinth. Da gab es viele wohlhabende Menschen, dass es nicht in den Kopf der Güte ging, wenn bei all dem Reichtum, der sich da durch den Handel in der Ägäis und über das Ionische Meer häufte, es Menschen und vor allem Kinder gab, die in jämmerlichen Hütten oder hinter Brettern lebten, die sich in ihrem Leben nicht satt essen konnten, sich zu Tode hungerten, denen die Armut das Kleid der menschlichen Würde und Scham zerriss, ja vom Leibe gerissen wurde, die dann, weil sie bettelarm waren, von denen, die genug zum Leben hatten, verachtet, geschlagen und verstoßen wurden. Was waren das für Menschen in Korinth, oder anders gefragt, waren das noch Menschen in Korinth?
Paulus war entsetzt, ja er war bestürzt, als er den Reichtum der einen und die Armut mit dem grenzenlosen Elend der andern sah. Sicher klaffte die Schere zwischen Wohl und Wehe in den anderen Gemeinden auch, doch nicht so weit. Hier in Korinth haben die Menschen das Groteske auf die Spitze getrieben, wo hinter dem blendenden Reichtum die Flecken der Schlechtigkeit durchschimmerten, wo hinter dem aufgetürmten äußeren Glanz die Fürsorge und Liebe um Nächsten, wie über einen steilen Abhang, abgestürzt war, als wäre hinter dem Reichtum die Gletscherwand, an der es keinen Halt mehr gibt. Darum spricht der Apostel vom Götzenopfer, das ein falsches Opfer ist, zumal wir das Wissen haben. Denn wir wissen, was gut und schlecht, was gut und böse ist. Es ist das Wissen der Verleugnung vor der Tat, das sich aufbläht, eine Blase wird, je länger wir reden, herumreden, diskutieren, herumdiskutieren, wenn wir die Entscheidung nicht treffen, die Liebe in unser Denken, Reden und Tun einzubeziehen. Für die, die da begriffsstutzig zurückbleiben, sagt es der Apostel mit seinen Worten, dass es die Liebe, nicht das Wissen, ist, die aufbaut, ob in der Familie oder der Gesellschaft. Denn ohne die Liebe ist auch das Wissen wertlos. Paulus formuliert es schärfer, wenn er sagt, der, der zu wissen meint, weiß noch nicht einmal, wie er zu dieser Meinung kommt, weiß nicht, was und wie er erkennen soll, ob es die Welt im großen oder der Mensch in seiner Persönlichkeit ist. Denn die Erkenntnis ist gekoppelt an die Liebe; wer Gott aufrichtig liebt, der erkennt auch den Menschen in der Liebe zu ihm. Dann baut Paulus am Bekenntnis, dem großen Monument, dass es nur den einen Gott gibt, dem der Mensch nicht mit dem falschen, dem Götzenopfer kommen, näher kommen kann. Es mögen sich Menschen wie Götter verhalten, wie Götter tragen, sich vergöttern lassen; sie bleiben Menschen mit all ihren Fehlern, deren größter die Hybris ist, mehr scheinen zu wollen, als der Mensch wirklich ist. Der Apostel schreitet um das Monument, das dem Universum seines Glaubens, seiner Denk- und Sichtweise entspricht, wenn er mahnend den Finger hebt, dass wir nur einen Gott haben, den Vater, von dem alle Dinge sind und kommen, so auch Jesus Christus, der die Sünden der Welt auf sich nahm, um die Menschheit zu retten.
Liebe Brüder und Schwestern! Kann einer von uns die Größe, die Tragweite dieser Tat, die Lichtwelt, die sich hinter dem Kreuz auftut, ermessen? Ich kann es nicht, auch wenn ich um diese Erkenntnis gebetet habe und nicht aufhöre, um diese Erkenntnis zu beten. Denn aus eigener Kraft kann ich sie nicht erringen; sie muss mir geschenkt werden, wenn nur mein Herz sauber und bereit ist, sie zu empfangen. Der Apostel drückt es so aus, dass, solange wir am Götzenopfer festhalten, wir schwach bleiben, weil unsere Seele mit der Sünde befleckt ist, die vom falschen Opfer kommt. Die reiche Speise mit dem Reichtum, aus dem wir die Speise in egoistischer Weise nehmen, macht uns Gott nicht nur nicht wohlgefällig, sie entfernt uns von ihm, von dem die wahre Erkenntnis mit dem Licht des wahren Lebens kommt. Wenn wir uns bessern wollen, dann nur über die Demut mit dem Bekenntnis, dass wir schwach und sündig sind. Von den Übeln müssen wir uns befreien, müssen uns aus der Schwachheit erheben. Das bedarf allerdings der gegenseitigen Hilfe mit dem einander Helfenwollen. Wir dürfen im Streben nach Freiheit den Schwachen weder aus den Augen verlieren, noch ihm mit Überheblichkeit vor den Kopf stoßen; wir müssen das Wort der Versöhnung finden und dem entgegen sprechen, der es so dringend braucht, weil er es aus eigener Kraft nicht schafft. Wir müssen die helfende Hand dem entgegenstrecken, der mit dem Leben ringt. Wir müssen wieder lernen, aufeinander zuzugehen, den andern nicht weniger zu achten als sich selbst. Das geht aber nur, wenn wir uns aus den Ketten der Ichbezogenheit befreien. Es muss wieder das Du geben, wenn die Dinge in unseren Familien in Ordnung kommen sollen. Denn nur durch das Du kann sich das Ich läutern, bessern und in der größeren Umfassung finden. Mit dem Du im Zentrum des Denkens, Fühlens und Handelns wächst aus dem schwachen das starke Ich heraus, das dann in der Du-Bezogenheit auch das Wissen hat, die Dinge richtig zu erkennen und durch das bessere Tun richtig zu stellen.
Liebe Brüder und Schwestern! Im 11. Vers des 8. Kapitels berührt der Korintherbrief ganz unmittelbar unsere Befürchtungen und Sorgen, wenn Paulus vom Bruder spricht, der durch das vorgegaukelte, falsche Wissen ins Verderben stürzt, um dessen Willen doch Jesus Christus den Tod am Kreuz auf sich genommen hat. Unsere Gedanken gehen zu unseren Brüdern, Vätern und Söhnen, die mit den großen Idealen für das Vaterland kämpften. Das Wissen der Obrigkeit stimmte mit der Erkenntnis, um die es Paulus im Korintherbrief geht, nicht überein. Nun haben wir die Folgen zu tragen, die schwer sein w erden. Nur der Herr kann uns die Kraft zum Tragen dieser Folgen geben. Wir kehren zur Demut zurück und bitten den Herrn um seine Gnade. Amen.
Eckhard Hieronymus las den Text noch zweimal durch, brachte Verbesserungen an, die er dann noch einmal verbesserte, bis ihm die Erleuchtung kam, dass die ursprüngliche Fassung doch die treffendere war. Es war spät geworden. Der Abendtisch war längst gedeckt. Luise Agnes saß am Tisch und setzte ihre Häkelarbeit an der weißen Wolldecke fort. Sie machte schnelle Fortschritte. Ihr Mann hielt geschriebenen Text in der Hand, als er in die Küche kam und sich auf seinen Stuhl setzte. Sie zog die Wärmekappe von der Kanne, goss den Tee in die Tassen und rührte in beiden Tassen den Zucker ein. „Bist Du zufrieden mit deiner Predigt?“, fragte sie nicht ohne Neugier über die Auslegung des 8. Kapitels aus dem 1. Korintherbrief, den auch sie durch mehrmaliges Lesen so gut wie auswendig kannte. Jedes Mal war sie von der Sprache des Apostels ergriffen, weil sie bildhaft plastisch, auch im weiteren Sinne der Bildung, war. Eckhard Hieronymus begann über die Abfassung der Predigt zu sprechen, die noch einige Ecken und Kanten habe. „Wenn ich daran feile, dass die Ecken und Kanten verschwinden, dann verliert die Predigt die Würze, ohne die der Text fahl und geschmacklos wird. Die Botschaft muss rüberkommen, muss an den Nervenenden ansetzen. Das Wort muss zünden, muss unter die Haut gehen, muss an der Lunte der Nervenstränge entlang glimmen und die Botschaft wie ein Geschoss in den Herzen zur Explosion bringen. Da kann ich doch nicht alle Ecken und Kanten glatt feilen, dass man darüber mühelos mit den Rollschuhen laufen oder mit den Schlittschuhen darüber gleiten kann. Ohne den Stolperstein kommt der Mensch doch nicht zur Besinnung.“ Luise Agnes sah ihren Mann an; ihre Neugier wuchs, und noch während des Essens bat sie, dass er den Text doch vorlesen möchte. Er kam ihrer Bitte nach, legte die angebissene Scheibe Brot auf den Teller zurück, fuhr mit der Serviette über den Mund, nahm noch einen Schluck Tee, griff nach den Bögen und las. Luise Agnes unterbrach das Essen und hörte ihm zu. Ihr gefiel die sonore Stimme ihres Mannes; es lag Bestimmtheit in ihr, die man nicht so leicht kippen konnte. Alle Dorfbrunners, der Vater, wie auch die Brüder Friedrich Joachim und Hans Matthias, hatten die kräftige Stimme. Wenn sie sprachen, wusste der Hörer, woran er war. Der Inhalt des Textes sprach sie an. Es gab Abschnitte, die ihr direkt aus dem Herzen sprachen. So gefiel ihr der Satz mit dem Propheten, der da sagt: Andere werden die Früchte von den Bäumen ernten, die ihr mit Fleiß und Mühe gepflanzt und verschnitten habt. Nicht weniger gefiel ihr der Satz zu: Ihr möget säen; ob ihr die Früchte euer Saat ernten werdet, das steht in der Allmacht Gottes. Tief berührte sie der Satz von den Armen, denen die Armut das Kleid der menschlichen Würde und Scham zerreißt, oder vom Leibe gerissen wird. Bei der Frage, ob das noch Menschen in Korinth waren, übertrug sie die Frage in die schlesische Stadt, in der sie mit eigenen Augen die bittere Armut an den geputzten Häusern der Wohlhabenden vorbeigehen sah. Auch hier klaffte die Schere zwischen Wohl und Wehe auf eine unerträgliche Weise, wenn die Kinder barfuß, oder die Füße in Lappen gewickelt, durch die Straßen liefen, und das bei Wind und Wetter. Das Wort „begriffsstutzig“ gefiel ihr gut, wo dann der Apostel von der Liebe spricht, die aufbaut, während das Wissen nur aufbläht. Luise Agnes merkte sich das Wort, um nach der Lesung ihren Mann zu fragen, ob das Wort „verstockt“ nicht doch stärker wäre. Das Bild, wie der Apostel um das Monument des Glaubens herum schreitet und mit dem Finger nach oben zu dem einen Gott zeigt, von dem alle Dinge sind, fand sie anschaulich und einprägsam. Die selbstkritische Frage, ob einer die Größe und Tragweite der Tat mit dem Kreuzestod ermessen könne, berührte sie tief. Denn sie wusste um das Ringen mit dem Glauben ihres Mannes. Als dann der Satz kam, dass er um die Erkenntnis, die man nicht erringen kann, bete, bekam sie doch feuchte Augen. „Großartig!“, das einzige Wort, das sie zwischendrin sprach, kam, als gesagt wird, dass dem Menschen die Erkenntnis geschenkt werden muss, wenn nur das Herz sauber und bereit ist, sie zu empfangen. Das mit dem Du und der Befreiung aus den Ketten der Ichbezogenheit sprach ihr aus dem Herzen. Das Ende der Predigt empfand sie wie die Kuppel der Kathedrale, in die das Sonnenlicht fiel, aus der sich der Friede über die Häupter senkte.
Eckhard Hieronymus Dorfbrunner hatte den Text seiner Jungfernpredigt seiner jungen Frau am Abendbrottisch vorgelesen. Er schaute auf die geschriebenen Bögen, die er in der Hand hielt, herab und schwieg. „Du bist ein starker Prediger“, sagte Luise Agnes, „deine Worte gehen unter die Haut, sie rütteln auf, machen Feuer an den Nerven; du entzündest die Lunte, die zum Herzen geht. Großartig, wie Du das 8. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief auslegst. Der Apostel Paulus hätte seine Freude an dir.“ „Das ist maßlos übertrieben“, wehrte ihr Mann ab, „an die Wortgewalt des großen Apostels komme ich doch nicht heran. Ich bin doch ein kleines Licht gegenüber diesem Feuerriesen.“ „Du bist maßlos in der Untertreibung“, widersetzte sich Luise Agnes, „inhaltlich hast Du gesagt, was zu sagen ist; deine Sprache ist für jedermann verständlich und bildlich dazu. Ich habe die Gesichter vor mir gesehen, denen Du die Maske der Scheinheiligkeit und Unbekümmertheit runtergezogen hast; auch deine Worte haben ins Fleisch der Falschheit geschnitten. Was erwartest Du mehr von einer Predigt?“ „Du sprichst die Gesichter an, denen die Masken runtergezogen wurden. Glaubst Du nicht, dass der Konsistorialrat an der Demaskierung der Gesichter Anstoß nimmt?“ Luise Agnes dachte nicht lange nach, als sie sagte, dass der Wahrheit die höchste Priorität zu geben sei. Da kannst Du von der Falschheit sprechen, die bei so vielen auf den Gesichtern abzulesen ist. Wenn daran der Herr Konsistorialrat Braunfelder Anstoß nimmt, dann ist das seine ganze persönliche Sache. Denn an Eitelkeiten darf sich der Prediger weder aufhalten noch stören lassen, denn schließlich geht es um das Wort, hier um das Pauluswort im 1. Korintherbrief.“ Eckhard Hieronymus sah seine Frau mit großen Augen an. „Du entpuppst dich ja als eine Kämpferin; ich finde das großartig. Ich glaube, dein Kämpfertum würde dem Apostel Paulus sicherlich mehr gefallen als der Text meiner Predigt.“ „Nun übertreibst Du, denn auch deine Worte sind an Klarheit und Schärfe nicht zu überbieten. Und das darf ich dir sagen, dass der, der das Wort Gottes in den Mund nimmt, vor nichts und niemanden Angst haben soll. Denn er braucht den Mut, die Dinge wieder ins Lot zu setzen. Das ist Aufgabe genug.“ „Du würdest also mit dem Text übereinstimmen“, sagte er mit einem fragenden Blick. „Voll und ganz! Besser und kürzer wären die Probleme nicht aufzuzeigen; die Schlichtheit der Antwort ging unter die Haut. Der letzte Satz, dass wir zur Demut zurückkehren und den Herrn um seine Gnade bitten sollen, wird die Herzen bewegen.“ Mit dieser Feststellung seiner Frau gab sich Eckhard Hieronymus zufrieden. Er aß das Abendbrot mit Erleichterung zu Ende; Luise Agnes goss ihm die zweite Tasse Tee ein und rührte den Zucker im hellen Porzellanklang der Tasse um.
So ging ein Tag zu Ende, der im Zeichen der schrecklichen Erkenntnis des verlorenen Weltkrieges mit all seinen Opfern, den unübersehbaren, fürchterlichen Folgen und im Pauluswort des 8. Kapitels des 1. Korintherbriefes stand. Eckhard Hieronymus hatte seine Predigt zu Papier gebracht, und Luise Agnes hatte dem Text ihre Zustimmung gegeben. Der Tag klang aus mit dem 1. Brandenburgischen Konzert auf dem Plattenteller, bei dessen Wiedergabe die Nadel des Tonarms in regelmäßigen Abständen in den Rillen quietschte. Die weiße Wolldecke, die dem Nachwuchs galt, war fast fertig; da hatte Luise Agnes ihre Geschicklichkeit bewiesen, die bei der Häkelarbeit oft an das Kind und die Welt dachte, in die es wohl hinein geboren würde. Eckhard Hieronymus blätterte während des Zuhörens im Schlesischen Anzeiger und las die ersten Seiten mit den Artikeln über die Streitereien im preußischen Landtag und die politischen Veränderungen im Lande mit dem Linksrutsch in der Parteienlandschaft, aus der die Stimmen zur Abdankung des Kaisers und der Bildung einer Republik immer lauter wurden. Auch las er mit Gründlichkeit die Todesanzeigen, wie er es von jeher tat. Da füllten sich die Spalten mehr und mehr; es waren vorwiegend die Männer im jungen Alter, jene die auf den Schlachtfeldern geblieben waren, denen nun das ehrende Andenken galt mit dem abschließenden „Ruhe in Frieden!“ Die Namen, die dem Verblichenen den Frieden wünschten, waren aufgrund der jungen Jahre, in denen das Leben so plötzlich zu Ende ging, die Eltern mit den noch verbliebenen Kindern. „Da gibt es viel zu tun“, und er dachte bei der Vielzahl der Anzeigen an die Beerdigungen, die der geistlichen Begleitung mit den Worten der Erlösung und dem gemeinsamen Gebet über dem weiß und merkwürdig anders, weil so jenseitsfriedlich und jenseitssprachlos im Sarg Liegenden [man hörte nicht den leisesten Ruf nach der Mutter, nicht einen Namensruf; man hörte kein Klopfen gegen den Sargdeckel: „wartet, es ist noch nicht soweit!“], und definitiv Diesseitsverstummten vor der Grabzuschüttung bedurften, sondern auch an die wachsende Zahl der Hinterbliebenen in ihrer Ratlosigkeit und Verzweiflung, um die sich seelsorgerisch gekümmert werden musste. Nun war es so, dass die meisten der jungen Männer an der Front des unnatürlichen Todes gestorben waren, die aufgrund der Vielzahl und der Schwere der Verstümmelungen gar nicht mehr zu identifizieren waren. Ihnen wurde, wie es in Kriegen nach dem Abschlachten von Menschen üblich ist, das Massenbegräbnis ohne Sarg und ohne geistliche Begleitung zuteil. Deshalb war bei der Vielzahl der Anzeigen in der Donnerstagsausgabe des Schlesischen Anzeigers nicht mit der entsprechenden Zunahme geistlich zu begleitender Beerdigungen auf dem städtischen Friedhof, der von der Elisabethkirche in Sichtweite lag, zu rechnen.