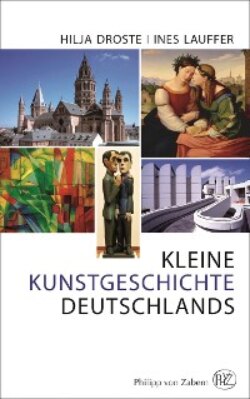Читать книгу Kleine Kunstgeschichte Deutschlands - Hilja Droste - Страница 10
DIE KAROLINGISCHE RENAISSANCE
ОглавлениеDer Begriff karolingische Renaissance, entstanden im 19. Jahrhundert, ist häufig kritisiert worden, impliziert er doch missverständlicherweise eine Nähe zum Renaissance-Humanismus des 15. und 16. Jahrhunderts. Dennoch wird der Begriff häufig verwendet, da er die Wiederbelebung der Antike in der Karolingerzeit beschreibt. Man spricht jedoch auch von der Bildungsreform Karls des Großen oder der karolingischen Renovatio (Erneuerung). Um das Römische Reich nicht nur politisch, sondern auch kulturell wieder aufleben zu lassen, versammelte Karl der Große an seinem Hof Gelehrte aus aller Welt, wie den Angelsachsen Alkuin, den Westgoten Theodulf von Orléans und den Langobarden Paulus Diaconus. Hier wurde die lateinische Sprache gepflegt und hier sammelte man in der Hofbibliothek wichtige Schriften der Theologie ebenso wie der antiken Literatur. Der Kaiser selbst setzte sich dafür ein, dass eine neue Schrift, die sogenannte karolingische Minuskel, entwickelt wurde, die sich durch ein klares und folglich leichter lesbares Schriftbild auszeichnet. Das Bemühen um eine gemeinsame geistige Kultur und die Entwicklung neuer Bildungsideale wurde von den Klöstern übernommen und weiterverbreitet.
Für die Genese der Kirchenausstattung selbst sind die um 790 am Hof Karls des Großen verfassten Libri Carolini bedeutsam, welche die karolingische Linie des kirchlichen Einsatzes von Bildern festlegen. Sie sind im Zusammengang mit der zunächst in Byzanz, dann ab dem 9. Jahrhundert aber auch im Westen geführten Diskussionen um die Bildverehrung zu sehen. Die Libri Carolini zeigen nicht nur das Interesse des Kaisers an kunstpolitischen Fragen, sie zeugen auch von einer überaus spannenden Mittlerposition: Die Anbetung wie auch die Verehrung der Bilder werden zwar abgelehnt (Position der Ikonoklasten, der Bilderstürmer), denn Gott habe sich in der Schrift, nicht im Bild offenbart, doch akzeptierten und legitimierten die Karolinger Bilder als Dekoration eines sakralen Raumes oder als Verbildlichung der Heilsgeschichte. Auf diese Weise wurden Bilder als Erinnerungshilfen für die illitterati (die des Lesens nicht Mächtigen) funktionalisiert und pädagogisiert. Die Libri Carolini ließen Bilder zwar im Kircheninnern zu, aber sie sprachen sich nicht für eine Bildverehrung aus; Bilder waren nicht in die Liturgie eingebunden und standen folglich hierarchisch unterhalb von Reliquien. Trotz dieser kritischen Haltung entwickelte sich unter den Karolingern eine reiche sakrale Kunst, die sich in Goldschmiedearbeiten, Elfenbeinschnitzerei, Wand- und Buchmalerei ausdrückte.