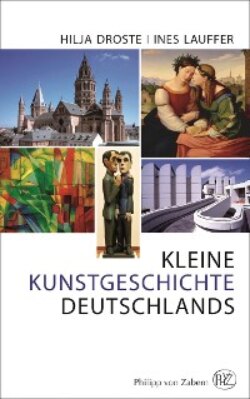Читать книгу Kleine Kunstgeschichte Deutschlands - Hilja Droste - Страница 13
DIE LORSCHER TORHALLE
ОглавлениеDie Gründung des Lorscher Klosters geht auf ein adliges Eigenkloster zurück, das im Jahr 764 in den Besitz des Bischofs Chrodegang von Metz überging. Auf seine Bitte hin schenkte Papst Paul I. dem Kloster 765 Reliquien des hl. Nazarius. Vermutlich aufgrund der steigenden Zahl der Pilger fing man im selben Jahr mit dem Neubau der Kirche an, die heute noch in Fragmenten erhalten ist. Die Bedeutung des Lorscher Klosters stieg nochmals mit der Ernennung zum Reichskloster 772, wodurch es dem direkten Schutz Karls des Großen unterstellt wurde. Die dem Klosterskriptorium angegliederte Klosterbibliothek zählte zu den bedeutendsten ihrer Zeit. Im fränkischen Reich übernahm das Kloster damit eine wichtige Rolle in der Bildungsreform und wurde zu einem geistlichen und kulturellen Zentrum.
In der Klosteranlage lag die sogenannte Torhalle oder auch Königshalle gegenüber dem Westwerk der Klosterkirche – ob sie frei in einem Atrium stand, wird seit Kurzem wieder diskutiert, zumal nach neuesten Grabungen die Existenz eines Atriums überhaupt infrage gestellt wird. Die Funktion der Torhalle innerhalb des Klosterkomplexes ist ebenfalls nicht sicher belegt, doch erscheint es als durchaus wahrscheinlich, dass sie dem Kaiser bei seinen Aufenthalten im Kloster als Gerichts- und Audienzhalle diente. In ihren Ausmaßen ist die Torhalle eher bescheiden; ihre auf antike Stadttore rekurrierende Architektur sowie die reiche Gestaltung der Fassade zeugen jedoch von herrschaftlichem Anspruch und verleihen dem Bau einen repräsentativen Charakter.
In unmittelbarem Zusammenhang mit der Funktion der Torhalle steht ihre Datierung. Während die ältere Forschung diese um 774 vornimmt, hält man es heute für durchaus plausibel, dass sie erst etwa 100 Jahre später entstanden ist, denn seit den 870er-Jahren ließen sich hier die Mitglieder der fränkischen Königsfamilie begraben (Werner Jacobsen).
Die Torhalle besteht aus einem Untergeschoss, einer nach Osten und Westen offenen Halle mit drei gleichdimensionierten Arkaden, und einem Obergeschoss, dessen einziger Raum durch zwei, seitlich angesetzte halbrunde Treppentürme zu erreichen ist. Licht erhält der Raum durch schmale Rundbogenfenster. Das heutige Dach der Torhalle gehört nicht zum karolingischen Bestand; ursprünglich hatte sie ein flaches Satteldach.
Dominierend in der Fassadengestaltung und zugleich eine karolingische Neuerung ist die Inkrustation aus hellen und rotbraunen Sandsteinen. Die Elemente, welche die Architektur gliedern, treten verhalten auf. Zwischen den Bogenöffnungen stehen vorgeblendete Halbsäulen, die Kompositkapitelle aus weißem Kalkstein tragen. Diese stützen ein Gesims mit Blattfries, auf dem kannelierte Pilaster mit ionischen Kapitellen stehen. Sie sind durch Giebelspitzen, die wie ein Zickzackband die ganze Breite der Fassade einnehmen, miteinander verbunden. Der Bau wird oben von einem kräftigen Konsolgesims abgeschlossen.
Inwieweit man der Lorscher Torhalle eine solitäre Stellung bezüglich ihrer Funktion und Gestaltung einräumen kann, ist schwer einzuschätzen, da sie der einzige profane Bau aus karolingischer Zeit ist, der sich nördlich der Alpen erhalten hat. Während insgesamt nur wenige Baudenkmäler aus dieser Zeit die Jahrhunderte überdauert haben, steht es um die Handschriften, die unter anderem in dem im Mittelalter so bedeutenden Lorscher Skriptorium angefertigt wurden, besser.