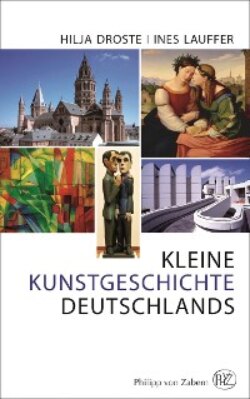Читать книгу Kleine Kunstgeschichte Deutschlands - Hilja Droste - Страница 9
Das Zeitalter der Karolinger
ОглавлениеDie Voraussetzungen der karolingischen Renaissance oder auch Renovatio (Erneuerung) liegen in einer noch früheren Spaltung, nämlich jener des Römischen Reiches. Es zerbrach Ende des 4. Jahrhunderts in zwei Teile, in ein Westreich mit Rom und ein Ostreich mit Konstantinopel beziehungsweise Byzanz als Hauptstadt. Als der Kaiserthron des Weströmischen Reiches ab 476 unbesetzt blieb und das Land in Bürgerkriegen versank, wurde aus dem Reich der Franken die bedeutendste Macht im Westen. Sie bildeten allerdings keine ethnische Gruppe, die Bezeichnung hatte vielmehr ihren Ursprung in der Spätantike und bedeutete so viel wie „mutig“ und „kühn“. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts verwendete man diese Bezeichnung dann für jene Menschen, die sich am Niederrhein und im heutigen Belgien niedergelassen hatten und für deren Expansion das Geschlecht der Merowinger bedeutend werden sollte. Sie stellten die Herrscher der Franken. Im 8. Jahrhundert löste die Dynastie der Karolinger die der Merowinger ab: 751 fand die Krönung Pippins des Jüngeren (714–768) in Soissons statt, nach dessen Tod die Herrschaft auf seinen Sohn Karl den Großen (747/748–814) überging, der am Weihnachtstag des Jahres 800 durch Papst Leo III. zum Kaiser gekrönt wurde. Unter ihm erstreckte sich das Frankenreich von den Pyrenäen und Oberitalien bis nach Norddeutschland, vom Atlantik bis nach Thüringen. Sein erklärtes Ziel war die Renovatio Imperii Romanorum, die Wiederherstellung des Römischen Reiches. Karl dem Großen, der auch als Vater Europas bezeichnet wird, gelang dies in einem erstaunlichen Maße, und zwar nicht nur im Hinblick auf die territorialen Grenzen, sondern auch auf Kunst und Kultur. In der sogenannten karolingischen Renovatio belebte er die seit den Völkerwanderungen brachliegende Kultur im Westen nach dem Vorbild der Antike.
Zwei Voraussetzungen ebneten den Weg Karls des Großen zur Errichtung eines Imperium Romanum: die Christianisierung und die Verbindung von Kirche und Herrschaft. Die Christianisierung Germaniens ging einerseits von den kiroschottischen Mönchen aus, die zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert aus Irland nach Gallien und Germanien kamen und weitgehend unabhängig von Rom diese Gebiete missionierten. Andererseits war der Papst selbst an der Christianisierung und der Vergrößerung seines Einflusses interessiert. Als die Langobarden in den 750er-Jahren das Patrimonium Petri, die Ländereien des Papstes, bedrohten, suchte der Hilfe bei Pippin dem Jüngeren. Von der Verbindung weltlicher mit geistlicher Macht profitierten beide Seiten. Die päpstliche Zustimmung zur Krönung Pippins zum fränkischen König und seine (zweite) Salbung im Jahr 754 durch Papst Stephan II. in Saint-Denis gaben der königlichen Herrschaft eine quasi göttliche Rechtmäßigkeit. Einige der wichtigsten Bistümer und Klöster wurden in der Folgezeit gegründet (Würzburg, Erfurt, Büraburg bei Fritzlar und Fulda) oder neu organisiert (Regensburg, Freising und Salzburg). Immer ging es dabei auch um eine Ausrichtung der Kirche am römischen Vorbild, um eine Vereinheitlichung in der organisatorischen und theologischen Struktur, um eine Stabilisierung der politischen Verhältnisse im Frankenreich.