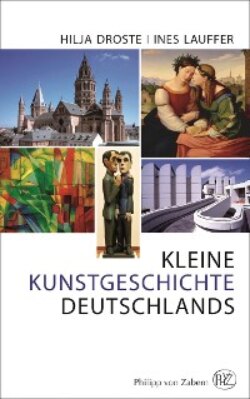Читать книгу Kleine Kunstgeschichte Deutschlands - Hilja Droste - Страница 17
ST. MICHAEL IN HILDESHEIM
ОглавлениеAls herausragender Sakralbau der ottonischen Zeit gilt St. Michael in Hildesheim (996–1033). Es gab bereits seit annähernd 200 Jahren einen Bischofssitz mit einem Dom in Hildesheim, als sich Bischof Bernward 996 dazu entschloss, außerhalb der Mauern ein Kloster zu gründen. Trotz vieler Unklarheiten in der Forschung – selbst ob es sich tatsächlich um ein Benediktinerkloster gehandelt hat, scheint fraglich zu sein – zählt die Klosterkirche in Hildesheim zu den am besten erhaltenen Beispielen ottonischer Kirchenkunst. Es sind jedoch lediglich die Grundmauern und das aufstrebende Mauerwerk vom Ursprungsbau erhalten geblieben, alles Weitere ist ein Ergebnis des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wie schon der Hildesheimer Dom, so ist auch die Michaeliskirche ein mächtiger Steinbau. Die dreischiffige Basilika ist um zwei Querhäuser im Osten und Westen erweitert und von sechs Türmen bekrönt: zwei Vierungstürme und je zwei an den Querhäusern. An der Südseite des Langhauses, der Stadt zugewandt, befand sich vermutlich der Haupteingang mit der berühmten Bernwardstür, während die Mönche vom Kloster kommend im Norden ihren Zugang hatten. Im Westen mündet das Gotteshaus in einen zentralen Chor, im Osten in einen mit drei Apsiden; es handelt sich also um eine doppelchörige Anlage, für die ein Eingang auf der Längsseite nicht ungewöhnlich ist. Nicht nur im Hildesheimer Dom, sondern auch in Mainz und Münster, in Paderborn und Worms findet sich diese Lösung.
Im Innern trennen breite Arkaden das Mittelschiff mit seiner Flachdecke von den Seitenschiffen. Hier fällt der Stützenwechsel auf: Die Bögen werden von Säulen und Pfeilern getragen, wobei auf zwei Säulen immer ein Pfeiler folgt. Dieses hier in Hildesheim zum ersten Mal auftretende System wird als „sächsischer Stützenwechsel“ bezeichnet. Eine derartige Rhythmisierung des Mittelschiffs ist ein Charakteristikum ottonischer, später auch romanischer Bauten und lässt sich in der Frauenstiftskirche St. Cyriakus in Gernrode oder auch am Halberstädter Dom nachvollziehen – allerdings wechseln hier je eine Säule mit einem Pfeiler (rheinischer bzw. einfacher Stützenwechsel).
Betrachtet man das Quadrat, das je zwei Pfeiler und zwei Säulen im Grundriss von St. Michael umschreiben, so wird offensichtlich, dass das Vierungsquadrat sich dreimal im Langhaus wiederholt. Solchermaßen wird das Vierungsquadrat zur Maßeinheit erhoben, weshalb man auch von einem gebundenen System oder quadratischen Schematismus spricht, der in späteren Bauten noch konsequenter zum Einsatz kommen sollte. Auch die erstmals in Hildesheim nachgewiesene „ausgeschiedene Vierung“ (Abb. 4) wird uns immer wieder begegnen: Die quadratische Vierung, die dort entsteht, wo sich Quer- und Längsschiff durchdringen, ist im Aufriss durch hohe Vierungsbögen und Vierungspfeiler hervorgehoben („ausgeschieden“).
Erstmals sind in St. Michael auch die doppelten Emporen in den Querhäusern realisiert worden, deren Bogenstellung von unten nach oben immer enger wird (den zwei Bögen im Erdgeschoss folgen vier im ersten und sechs im zweiten Obergeschoss). Nicht zuletzt fällt in Hildesheim die besondere Gestaltung der Säulenkapitelle ins Auge, die deutlich macht, wie weit sich die ottonische Kunst von der Antikenrezeption zu lösen wagte: Ein schlichter Würfel, der zum Kämpfer hin abgerundet ist, bildet den oberen Abschluss der Säulen. Neben solchen Würfelkapitellen finden sich an ottonischen Bauten auch sogenannte Pilz- oder Trapezkapitelle, etwa in Quedlinburg in der Wipertikrypta. Diese Lösungen zeugen allesamt von einem Streben nach neuen, einfachen Formen. Orientierte man sich im Hinblick auf einzelne Bauformen (Basilika) und Materialien (Spolien) an der Antike, so sind klassische antike Ornamente wie kannelierte Pilaster, Palmettenfries oder Eierstab, wie sie noch an der Lorscher Torhalle oder in der Aachener Pfalzkapelle (vgl. Abb. 1) verwendet wurden, eher atypisch.
In den Details schlicht, in der Gesamtwirkung aber monumental wie St. Michael in Hildesheim sind auch die übrigen ottonischen Gotteshäuser, die, wehrhaften Gottesburgen gleich, um 1000 zahlreich gegründet wurden (St. Maximin in Trier oder der Magdeburger und der Mainzer Dom). Es war jedoch weniger eine Zunahme an Gläubigen, die den Anlass zu Umbauten, Erweiterungen oder Neugründungen, ja zu einem „wahren Bauboom“ um das Jahr 1000 lieferte, als vielmehr eine neue Dominanz der Bischofssitze.
Dabei ging es nicht nur um die einzelnen Bauwerke, sondern immer auch um ganze Stadtanlagen. Während unter den Karolingern die einem Bischofssitz angemessene Stadt häufig noch gar nicht existierte (in Hildesheim genauso wenig wie in Halberstadt, Münster oder Paderborn), galt es unter den Ottonen, diese „Städte“ zu nobilitieren. Nun reichte die Domkirche nicht mehr aus: In Köln zählte man neun geistliche Gemeinschaften außerhalb der Domkirche, in Mainz sieben, in Trier sechs. Es entstanden regelrechte Sakrallandschaften, die häufig wie in Konstanz dem großen Vorbild Rom nacheiferten. Ihre Kirchen sollten über Prozessionswege miteinander verbunden sein, um nach alter stadtrömischer Praxis Stationsgottesdienste im Rhythmus der Woche und des Festkalenders an wechselnden Schauplätzen zu feiern. Auch in Hildesheim blieb es nicht bei den beiden Kirchen: Unter Bernwards Nachfolgern wurden weitere Kirchen errichtet, die ein nach allen vier Himmelsrichtungen weisendes Kirchenkreuz in den Stadtplan einzeichneten.
4 Hildesheim, St. Michael, Langhaus, Innenansicht nach Osten
Bischof Bernward hat nicht nur als Kirchengründer, sondern auch als Auftraggeber bedeutender Ausstattungswerke Spuren in St. Michael hinterlassen. Seine memoria (Gedächtnis, Totengedenken) wurde in der Westkrypta raffiniert inszeniert, wo sein Grab so ausgerichtet war, dass er am Jüngsten Tag auf den aus dem Osten wiederkehrenden Christus hätte blicken können, wie die Inschrift auf dem Sarkophag vermerkt, ebenso wie auf das erlösende Kreuz, das auf einer Christussäule angebracht war. Diese bronzene Christussäule (auch Bernwardsäule genannt), die sich heute im Hildesheimer Dom befindet, erinnert an die römischen Siegessäulen eines Trajan oder eines Marc Aurel, wenn auch in den Dimensionen wesentlich bescheidener. Bernward konnte sie als Begleiter Ottos III. während seiner Romreise im Jahr 1001 gesehen haben. Das bronzene Kruzifix der Bernwardsäule existiert heute nicht mehr, dennoch war dieser Abschluss thematisch stringent, zeigt doch das von unten nach oben umlaufende Reliefband von fast einem halben Meter Breite Szenen aus dem Leben Christi, die neben seiner Passion vor allem seine Wundertaten nachzeichnen und schließlich mit seinem als Triumph dargestellten Kreuzestod enden.
Aus derselben Werkstatt wie die Christussäule stammt auch die bronzene Bernwardstür, die sich heute ebenfalls im Dom befindet. Sie ist aus einem Guss gefertigt und damit eine technische und künstlerische Meisterleistung, eines der ersten Großwerke deutscher Plastik überhaupt. Bronzetüren fanden sich zwar schon in Aachen, doch ist das Hildesheimer Werk kein einfaches Türblatt mehr, sondern aufwendig gestaltete Reliefkunst. Die beiden Türflügel sind in je acht längsrechteckige Bildfelder von jeweils etwa 120 auf 60 Zentimeter unterteilt. Der linke Flügel zeigt von oben nach unten alttestamentliche Szenen der Genesis (Erschaffung Adams bis Brudermord), der rechte stellt ihm die neutestamentliche Erlösergeschichte, diesmal von unten nach oben erzählt, gegenüber. Auf diese Weise können die Geschehnisse nicht nur chronologisch, sondern auch als Vorausdeutungen des Alten auf das Neue Testament gelesen werden: Ein Auslegungsverfahren, das man als typologische Exegese bezeichnet, die hier jedoch nicht über das Wort, sondern über das Bild betrieben wird.
Schlicht gekleidet treten die schlanken, in das Geschehen vertieften und gestikulierenden Figuren dem Betrachter aus dem Reliefgrund entgegen. Dabei springen die Gebärden vor allem deshalb ins Auge, weil die Fläche um sie herum fast wie leergefegt wirkt. Der Hintergrund des Geschehens ist, wenn überhaupt, nur angedeutet, eine perspektivische Ausgestaltung des Bildraums durch Architektur oder Landschaft ist sekundär, die Figuren agieren im Vordergrund. Vorbild für die Bernwardstür war ein Werk der Buchmalerei, und zwar eine karolingische Bibel aus Tours, die noch unter Abt Alkuin, dem Hoftheologen Karls des Großen, um 840 geschaffen wurde (Alkuinbibel, Staatsbibliothek Bamberg). Zwar nahm die Buchmalerei in der ottonischen Zeit noch eine Vorreiterrolle ein, aber eine wie zu Zeiten Karls des Großen zentrale Hofschule gab es nicht mehr. Mehrere Zentren traten hervor: St. Gallen, das Kloster Fulda oder Echternach (heute Luxemburg) und eines der bedeutendsten, das Reichenauer Skriptorium. Sie alle trugen dazu bei, dass die ottonische Buchmalerei führend in Europa wurde.