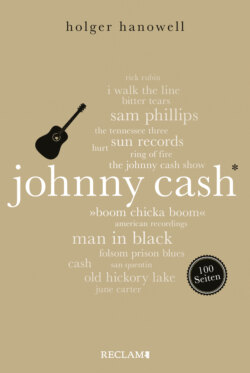Читать книгу Johnny Cash. 100 Seiten - Holger Hanowell - Страница 5
Оглавление»A new sun risin' on the way we sing«: Der Weg zu Sun Records in Memphis
Johnny Cash kommt am 26. Februar 1932 im ländlichen Arkansas in ärmlichen Verhältnissen zur Welt, als viertes von insgesamt sieben Kindern. Schon früh arbeitet J. R., wie er zu Hause genannt wird, mit seinen Geschwistern auf den Baumwollfeldern, die der Vater im Zuge eines staatlichen Hilfsprogramms nach der Großen Depression im Dyess County gepachtet hatte (gemeinsamer Gesang bei der Feldarbeit und am Abend das Radio halten am Leben). Nach dem Besuch der High School hat Cash keine genauen Berufsvorstellungen, nimmt Gelegenheitsjobs an und meldet sich schließlich 1950 zu Beginn des Koreakriegs freiwillig bei der Air Force. Von Oktober 1951 bis Juni 1954 leistet er seinen Militärdienst in Deutschland, ist auf einem Fliegerhorst bei Landsberg/Lech in Bayern stationiert und überwacht als Abhörspezialist den Funkverkehr der sowjetischen Luftwaffe. Bereits dort ›jammt‹ er mit Kameraden, den ›Landsberg Barbarians‹. Für fünf Dollar kauft er sich eine Gitarre, schreibt Songtexte und träumt davon, eines Tages im Radio singen zu können. Für ihn ist Musik immer schon wie die Luft zum Atmen gewesen. Seine Mutter Carrie war sehr musikalisch, sie spielte Klavier, hatte ihrem Sohn die erste Gitarre gekauft und ihn ermuntert, weiter zu singen.
Johnny Cash ist ein Kind der Südstaaten. Sein Musikgeschmack ist von klein auf von Countrymusik geprägt, schon als Junge hat er über das Radio Countrysänger wie Roy Acuff, Ernest Tubb oder Hank Williams gehört, aber auch Bing Crosby, die Andrew Sisters und die Gospelsängerin und Gitarristin Sister Rosetta Tharpe.
Cashs musikalische Karriere beginnt dann aber nicht in Nashville, der Herzkammer der Countrymusik, sondern in Memphis, genauer gesagt: auf der Union Avenue im legendären Sun Studio, das Sam Phillips (1923–2003) gehört. Der Produzent Phillips hat mit schwarzen Rhythm & Blues Musikern wie Howlin’ Wolf oder B. B. King gearbeitet – in den Südstaaten für einen weißen Plattenboss nicht selbstverständlich –, ehe ihm 1954 mit dem neunzehnjährigen Elvis Presley ein ganz besonderer Fisch ins Netz geht. Phillips hat ein Gespür für junge Talente. Im Juli 1954 erscheint Presleys erste Single »That’s All Right«, die die Karriere dieses Ausnahmekünstlers einläutet. Nach und nach geben sich junge, aufstrebende Sänger und Musiker in Phillips’ Studio die Klinke in die Hand, neben Johnny Cash Carl Perkins, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Billy Lee Riley, Charlie Rich oder der etwas unbekanntere, gleichwohl einflussreiche Charlie Feathers.
»All of us ran through when Elvis opened up the door«
aus: »I will Rock and Roll with You«
Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Elvis und Johnny Cash in den Sun Records Studios (v.l.n.r.)
Im Dezember 1956 kommen vier Sänger zusammen, die alle noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Die Jam Session erhält später den Namen »Million Dollar Quartet«, eine Anspielung auf das kommerzielle Potenzial der vier Stars. Elvis sitzt am Klavier (nicht der »Killer« Lewis), umringt von den drei anderen Sängern. Mag sein, dass das Bild gestellt ist, die Gelegenheit für den Fotografen war aber sicher zu verlockend, denn so jung sollten die vier nicht mehr zusammenkommen. Eigentlich hat Carl Perkins das Studio gebucht, Elvis schaut nur kurz vorbei, die anderen beiden haben offenbar auch nichts Besseres zu tun …
Nach dem Wechsel zu RCA Records legt Elvis Presley eine kometenhafte Karriere hin und verglüht mit 42 Jahren. Carl Perkins landet einen Riesenhit mit »Blue Suede Shoes«, kann nach einem Unfall nicht mehr an seine frühen Erfolge anknüpfen, spielt später einige Jahre in Cashs Band und erlebt in den 1980ern im Zuge des Rockabilly Revivals ein Comeback. Jerry Lee Lewis, einer der wildesten Rock ’n’ Roller, der sein Klavier mit Händen und Füßen traktiert und nach dem Ende der heißen Rock ’n’ Roll Phase und einem handfesten Skandal erfolgreich ins zahmere Countryfach wechselt, ist der »Last Man Standing« des Quartetts.
»Hätte es Sam Phillips nicht gegeben, würde ich wahrscheinlich noch heute auf einem Baumwollfeld arbeiten«
aus: Cash. The Autobiography (1997)
Mit der Mixtur aus weißen Countryelementen und schwarzem Rhythm & Blues setzt sich der neue Rockabilly Stil auch im Sun Studio durch, eine Spielart des Rock ’n’ Roll, die hauptsächlich auf die Südstaaten beschränkt bleibt. Rockabilly ist eine Wortschöpfung aus »Rock ’n’ Roll« und »Hillbilly«: noch in den 1950ern eine gängige Bezeichnung für Countrymusik. Memphis, Tennessee, ist etwas Besonderes, ist eine Musikmetropole, ein musikalisches Babylon aus Weiß und Schwarz, Arm und Reich, neben New Orleans ein Zentrum des Blues. B. B. King besitzt dort einen Club. Der klassische Memphis Blues mit Rhythmus- und Leadgitarre setzt Maßstäbe, Blues und Gospel verschmelzen. Neben dem Blues wird in Memphis dem Rock ’n’ Roll der Weg geebnet.
Die Entlassungsurkunde von der Air Force in der Tasche, zieht es auch Johnny Cash 1954 nach Memphis. Er ist frisch verheiratet mit Vivian Liberto, die er 1951 in San Antonio kennengelernt hatte. Zunächst arbeitet er als Vertreter für Haushaltsgeräte, abends jammt er mit seinem älteren Bruder Roy und zwei Freunden: Marshall Grant und Luther Perkins werden später seine Bandkollegen als die legendären Tennessee Two. Elvis hat sozusagen »die Tür aufgestoßen«, wie Cash es in seinem nostalgischen Song »I will Rock and Roll with You« formuliert. Presleys »That’s All Right« wird 1954 von den lokalen Radio DJs quasi ununterbrochen gespielt. In Memphis brodelt es musikalisch, und so träumt auch Cash weiterhin davon, Musik zu machen und eines Tages seine Stimme im Radio zu hören. Sein Lieblingsplattenladen: ›Home of the Blues‹ in der Beale Street in Memphis. Besonders angetan ist er im Nachhinein von Alan Lomax’ Album Blues in the Mississippi Night.
Ende 1954 nimmt Cash all seinen Mut zusammen und stellt sich im Sun Studio vor, aber mit der Absicht, Gospelsongs aufzunehmen. Gospel verkaufe sich aber nicht, lässt ihn der Studioinhaber wissen. Es wird für den jungen Mann hart werden, überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Als Sam Phillips dann endlich etwas mehr Zeit für den Dreiundzwanzigjährigen hat, spielt Cash ihm Lieder von Hank Snow und Ernest Tubb vor, aber auch ein, zwei Songs, die er während seiner Dienstzeit bei der Air Force in Deutschland geschrieben hat (u. a. »Hey, Porter«). Phillips ist nicht sonderlich begeistert, stellt Cash jedoch in Aussicht, er könne noch einmal wiederkommen, mit eigenem Material.
Cash nimmt ihn beim Wort und bringt seine beiden Freunde mit. Doch auch mit seinem kleinen Jam-Session-Trio kann er zunächst nicht überzeugen – doch irgendetwas muss Phillips in dem Kerl mit der dunklen, tiefen Stimme gesehen haben: »Dieser Junge hatte etwas an sich, man hatte zwangsläufig den Wunsch, mehr von dem zu hören, was er einem zu sagen hatte.« Er nimmt die drei jungen Männer im April 1955 unter Vertrag. Sein Rat an Cash, der sich als »John Cash« vorgestellt hat: Aus kommerziellen Gründen solle er sich »Johnny« nennen – fortan steht auf den Sun-Singles: Johnny Cash and the Tennessee Two.
Im Frühjahr 1955 spielen Cash und seine Freunde mit »Hey, Porter« und »Cry, Cry, Cry« zwei Songs aus Cashs Feder ein. Die erscheinen am 21. Juni als Single – stilistisch geht es in Richtung Rockabilly und Country Blues, es sind keine Countrylieder der alten Schule. Die Memphis DJs spielen die Single, kleinere Auftritte und Touren in der näheren Umgebung der Musikmetropole folgen. Im Sommer 1955 wechseln sich Cash und Presley oft auf denselben Kleinstbühnen ab. Eine wichtige Etappe für die aufblühende Karriere: Die im Radio übertragene Countrymusik-Show Louisiana Hayride aus Shreveport. Cashs früher Stil ist kein echter Rock ’n’ Roll, als Sänger hat er sich auch nicht der Art der Rockabillys verschrieben, singt nicht mit deren markantem »Schluckauf«.
Er hat anscheinend das Talent dafür, gute Songs zu schreiben. Mit »Hey, Porter« leitet Cash sozusagen seine Begeisterung für Züge ein. Der junge Mann im Song kann es auf der Fahrt durch »Dixie«, den Süden der USA, gar nicht abwarten, endlich wieder im geliebten Tennessee anzukommen: »I’m gonna set my feet on Southern soil / And breathe that Southern air.« Eine schnelle, prägnante Nummer. Das Motiv der Eisenbahn sollte noch in vielen Cash-Songs auftauchen – so auch in »Like the 309«, dem letzten Song, den Cash schrieb. Man solle seinen Sarg ruhig auf den Zug legen: »Write me a letter, sing me a song / Tell me all about it, what I did wrong / Meanwhile, I will be doin’ fine / Then load my box on the 309.« Der Titel »Cry, Cry, Cry« ist langsamer gehalten und setzt sich auch vom Text her gesehen vom üblichen Countrymaterial ab. Ein Mann beklagt sich über seine Frau und lässt kein gutes Haar an ihr. Für die eigenen Songs übernimmt Cash die Rolle des Ich-Erzählers aus den Klageliedern von Hank Williams, allerdings erliegt der Sprecher in »Cry, Cry, Cry« nicht dem Selbstmitleid, sondern lässt die Frau wissen, sie werde noch bereuen, was sie ihm angetan habe: »It’ll hurt when you think of the fool you’ve been / You’re gonna cry, cry, cry.«
Bereits zu Beginn seiner Karriere ist klar, dass Cash nicht nur eingängige Melodien findet, sondern auch gute Texte schreiben kann, Texte voller Atmosphäre, die oft ernst und etwas melancholisch wirken. Vor allem nimmt man dem Sänger ab, was er singt, etwa in den autobiografischen Songs wie »Five Feet High And Rising«, Cashs Beschreibung der Flutkatastrophe am Mississippi im Januar 1937. Und selbst wenn es einmal erdenschwer und verzweifelt daherkommt wie im »Folsom Prison Blues«, kauft man dem 23-jährigen Mann ab, was er einem über die Trostlosigkeit im Knast mitzuteilen hat: »I hang my head and cry.« Tatsächlich stammen viele der Lieder, die später zum Standard-Repertoire von Cash gehören, aus der frühen Phase bei Sun Records, wie etwa »Get Rhythm« über einen Schuhputzjungen, der großartige Titel »Big River«, das getragene Stück »Give My Love to Rose« oder eben »Hey, Porter«. Schon bei dieser Auswahl zeigt sich, dass Cash ein Storyteller ist, ein Geschichtenerzähler, der ohne viele Metaphern auskommt, um mit Einsamkeit in der Stimme von Liebe, Trauer, Erlösung oder von Killern zu erzählen.
In »Big River« verliebt sich ein Mann Hals über Kopf in eine Schönheit und folgt ihr den Mississippi hinab bis zum Golf, doch die Schöne erhört ihn nicht, lässt ihn abblitzen. Das Ganze ist musikalisch im Rockabilly-Stil gehalten auf die satten Gitarren reduziert. Der arme, liebeskranke Kerl könnte der »Trauerweide das Weinen beibringen« und den »Wolken zeigen, wie man den Himmel bedeckt«. Höhepunkt der komischen Selbstüberschätzung: »And the tears I cried for that woman are gonna flood you, Big River, then I’m gonna sit right here until I die.« Weltschmerz des Zurückgewiesenen. Cashs »Give My Love to Rose« fängt so unvermittelt an wie eine amerikanische Kurzgeschichte. Der Erzähler muss dem sterbenden Exsträfling, über den er buchstäblich stolpert, versprechen, Frau und Kind von ihm zu grüßen. Cashs Vortragsweise wirkt authentisch, auch wenn der später hinzugefügte Chor bei der Sun-Aufnahme nervt.
Besonders zwei Songs aus der Sun-Phase werden später zu Cashs Markenzeichen und ebnen dem Sänger den Weg in die Charts: »Folsom Prison Blues« und »I Walk the Line«. Mit »Folsom Prison Blues« nimmt Cash die zweite Single für das Sun-Label in Angriff, und auch bei Sam Phillips scheint der Funke übergesprungen zu sein: Das ist nicht der Honky Tonk-Stil mit Fiddle und Slide-Gitarre, wie man ihn von älteren Country-Stars wie Ernest Tubb oder Ray Price kennt. Der Sound von »Folsom Prison Blues« ist ungeschliffen, schroff, stampfend. Cashs Rhythmusgitarre scheppert wie eine Fußfessel, Marshall Grant schlägt auf den Bass ein, als würde man ein Handtuch durch die Luft knallen. Die Single vom Dezember 1955 steigt im Frühjahr 1956 in die Country-Charts ein, erreicht Platz 4 und wird fester Bestandteil der ersten Touren. Von da an brauchen sich Johnny Cash und seine Frau Vivian, die das zweite Kind erwartet, finanziell keine Sorgen mehr zu machen.
Die Single »Folsom Prison Blues«