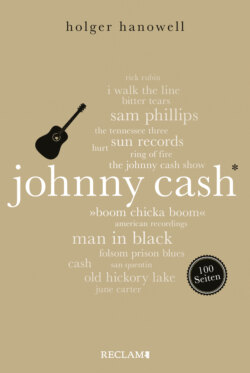Читать книгу Johnny Cash. 100 Seiten - Holger Hanowell - Страница 8
Der Sound von Johnny Cash:
»Boom-chicka-boom«
ОглавлениеCashs Songs liegen irgendwo zwischen klassischer Countrymusik und dem aufblühenden Rock ’n’ Roll, zu rebellisch für den alten Countrystil und doch in der Countrymusik à la Jimmie Rodgers, der Carter Family und von Hank Williams verwurzelt: Seinen vielleicht einzigen »echten« Rock ’n’ Roll Song – »Rock ’n’ Roll Ruby« (1956) – überlässt Cash seinem Sun-Kollegen Warren Smith. Die Band Johnny Cash and the Tennessee Two besteht nur aus drei Musikern, die blutige Anfänger sind: An der Rhythmusgitarre Cash, ein Vertreter mit Ambitionen, Radiosprecher zu werden, am Kontrabass mit Slap-Technik Marshall Grant und an der E-Gitarre Luther Perkins – beide hauptberuflich Automechaniker. Cashs Gesang steht klar im Mittelpunkt und bekommt in den Sun Studios einen charakteristischen Hall-Effekt. »Auf seinen Platten haben wir Johnnys Stimme hervorgehoben«, erzählt Phillips. »Die drei Instrumente ergänzen sie. Ich wollte nichts anderes haben, wollte nicht, dass irgendetwas von der beherrschenden Art und Weise ablenkte, die Johnny allein mit dem Klang seiner Stimme erzielte.« Schlagzeug ist bei Country noch verpönt. Cash imitiert daher die Snare Drum, indem er zwischen Saiten und Griffbrett seiner Gitarre einen Streifen Papier legt, der ein schnarrendes Geräusch erzeugt. Das muss reichen. Tatsächlich erzählt der Bassist Grant später, dass der Sound der Tennessee Two nicht aus mehreren Alternativen heraus entwickelt wurde, sondern dass dies das Einzige war, das die Jungs zustande brachten. Und genau diese spärliche Besetzung wird der Schlüssel zu dem Cash-Sound der frühen Jahre: Johnny Cash and the Tennessee Two ist im Grunde eine schnörkellose Rhythmus-Combo mit straffem Beat und einem Sänger mit ungewohnt tiefer, markanter Stimme. Alles reduziert und ohne die üblichen Countryverzierungen wie Pedal-Steel-Gitarre und Fiddle. Selbst Luther Perkins, der Mann an der Leadgitarre, nimmt sich zurück, spielt allenfalls kurze, an der Gesangsmelodie orientierte simple Soli, um dann wieder in eine Spieltechnik zurückzufallen, die den charakteristischen ›Boom Chicka Boom‹-Sound der Cash-Band unterstützt: Beim Spielen dämpft Perkins mit der rechten Hand die drei tiefen Saiten auf der Bridge seiner Fender Esquire, da er die Lautstärke nicht herunterregeln kann, und schlägt mit dem Plektrum ein rhythmisches Pattern mit Wechsel-Bass-Technik. Zusammen erzeugen die drei Bandmitglieder einen stampfenden, treibenden, schnarrenden, eigentlich sehr simplen, aber zündenden Rhythmus, der zu einer fahrenden Dampflokomotive passt.
In die Kategorie train songs fallen zwei weitere Titel aus der Sun-Zeit: »Train of Love« (ein Cash-Song von 1956) ist wieder ein Beispiel für den schnörkellosen, kraftvollen und staubtrockenen Sound von Cash und den Tennessee Two jener Jahre. Bob Dylan steuerte 1999 eine Version von »Train of Love« zu dem All-Star Tribute to Johnny Cash bei und bemerkte in seinem kurzen Intro, er habe diesen Song schon gespielt, als er selbst noch gar keinen Song aufgenommen hatte. Liebe und Sehnsucht mit Zugmetaphorik: »Trainman tell me maybe, ain’t you got my baby / Every so often everybody’s baby gets the urge to roam / But everybody’s baby but mine’s comin’ home« – erneut ein von Schwermut getragener Song.
Während »Train of Love« später nicht mehr häufig auf der Setlist von Johnny-Cash-Konzerten stand, blieb mit dem Klassiker »Rock Island Line« ein weiterer train song im Live-Repertoire. Der Bluessänger Leadbelly war wohl der Erste, der den Song aufnahm, danach gab es zahlreiche Coverversionen, unter anderem von dem britischen Skiffle-Musiker Lonnie Donegan. In einer Live-Version aus dem Jahr 1975, aufgenommen im Londoner Palladium, zelebrieren Cash und Band zu Ehren von Donegan, der damals im Publikum saß, den langsam anrollenden Song über den schlitzohrigen Lokführer, der bei der Zollstelle die Unwahrheit sagt: Er gibt nämlich an, seine Ladung bestehe nur aus Vieh, das er nicht zu verzollen braucht. Als der Zug mächtig Fahrt aufnimmt, dreht sich der Lokführer noch einmal um und ruft: »Well I fooled you / I fooled You / I got pigiron / I got pigiron / I got all pigiron« – zollpflichtiges Roheisen. Im temporeichen Finale des Songs werden die Zeilen so schnell gesungen, dass man sich fast die Zunge bricht: »Well if you want to ride you got to ride it like you find it / Get your ticket at the station of the Rock Island Line«.
1960 stößt W. S. Holland (1935–2020) als Schlagzeuger zur Cash-Band, die sich dann, wenig einfallsreich, Johnny Cash and the Tennessee Three nennt. Zunächst entstehen weitere frühe Sun-Songs in der Standardbesetzung, etwa »Doin’ My Time«, »Don’t Make Me Go« oder »So Doggone Lonesome«.
Es bleibt nicht bei der spärlichen Besetzung. Sam Phillips will den Sound etwas voller klingen lassen, bei den Aufnahmesessions gesellen sich bereits Ende 1956 nach und nach Klavier, Schlagzeug und Hintergrundchöre dazu, vornehmlich die Gene Lowery Singers, die im Sun Studio immer abrufbar zur Verfügung stehen. Einige Songs werden später im Overdubbing-Verfahren bearbeitet. Phillips hat mit Jack Clement (1931–2013) einen fähigen, umtriebigen Tontechniker und Musiker an der Hand, der sich mit der festen Sun-Studioband der Lieder von Cash annimmt.
Das Ergebnis sind Songs, die auf den Pop-orientierten Markt abzielen und demzufolge aufwendiger produziert werden. Im Januar 1958 erscheint »Ballad of a Teenage Queen« aus der Feder von Jack Clement und mit ihm selbst an der Gitarre. Ein deutlicher Schritt in Richtung Pop-Charts, so ganz anders als der karge Cash-Sound der ersten Jahre. Falsch liegt Clement mit seinem Gespür nicht, denn die »Ballade« schafft es mühelos auf Platz 1 der Country-Charts und immerhin auf Platz 14 der Billboard Hot 100 im Bereich Pop. Die nachträglich hinzugefügten Stimmen der Gene Lowery Singers passen zwar irgendwie in das Arrangement, wirken aber auf Dauer doch anstrengend. Überhaupt ist dieser Song eine – machen wir uns nichts vor – furchtbare Schnulze: Ein hübsches Kleinstadt-Mädel, das von allen angehimmelt wird, liebt den Jungen von nebenan, erliegt dann aber den Verlockungen Hollywoods, verlässt den Jungen, kehrt später desillusioniert zurück in die Kleinstadt und stellt zu ihrer großen Freude fest, dass der Junge sie immer noch liebt: genug Identifikationsmöglichkeiten für Teenies in den 1950ern.
Jack Clement arbeitet über die Jahre hinweg immer wieder für Cash, ist aber stets für pompöse Arrangements bekannt – was den Alben nicht immer zum Vorteil gereicht. »Guess Things Happen That Way«, ebenfalls geschrieben von Clement, klettert im Juni 1958 auf Platz 1 der Country-Charts und belegt Platz 11 der Pop-Charts. Und diesmal geben die Gene Lowery Singers dem Song mit ihrem »Ba-doo-ba-doo« richtig Drive.
Je erfolgreicher Cash wird, desto mehr Meilen legen er und seine Band zurück, um von einem Auftritt zum nächsten zu kommen. Ganz im Stil echter Rocker zerlegt die Band dabei Hotelzimmer und amüsiert sich mit selbstgebauten Feuerwerkskörpern. Ende der 1950er Jahre gibt Cash etwa 300 Shows im Jahr, ist also praktisch immer on the road. Um all den Anforderungen gerecht werden zu können, verlässt er sich bald auf die Wirkung von Amphetaminen, die ihn aufputschen – in der Musikszene nichts Ungewöhnliches; viele Kollegen halten sich mit Mitteln dieser Art wach, um leistungsfähig zu sein. Eine Weile geht das gut mit den »pep pills«, irgendwann jedoch ist er so aufgeputscht, dass er nach den Auftritten nicht mehr zur Ruhe kommt. Also wirft er zur Beruhigung Barbiturate ein. Er wird abhängig von dem Zeug, nimmt die Pillen unkontrolliert – harte Drogen kommen für ihn nicht infrage, doch auch die Mischung aus Amphetaminen und Barbituraten macht ihn auf Dauer fertig.
»Es war eine Flucht, mehr nicht. Als ich damit anfing, verschafften mir die Pillen ein gutes Gefühl. Jedes Mal, wenn ich sie nahm, fühlte ich mich gut. Dann nahm ich so viele davon, dass ich mich irgendwann nicht mehr gut fühlte. Ich war nur noch wach«
aus: C. S. Wren, Johnny Cash. Winners Got Scars Too (1974)
Allmählich leidet seine Ehe, auch unter dem Druck, den das Musikbusiness auf Cash ausübt. Er ist immer seltener zu Hause bei seiner Familie, verbringt kaum noch Zeit mit seinen Töchtern. Später bereut er es, dass er die Kinder nicht hat aufwachsen sehen.
Im Oktober 1957 erscheint die erste Johnny-Cash-LP bei Sun Records: Johnny Cash With His Hot And Blue Guitar, tatsächlich die erste LP überhaupt für Sam Phillips’ Label. Noch ist der Musikmarkt ausgerichtet auf Singles für die Jukebox und die Radio-DJs. Die Sun-LP versammelt Cashs Hits und einige Coverversionen, die zwischen 1955 und 1957 aufgenommen worden waren.
Irgendwann muss in dem Sänger jedoch der Gedanke gereift sein, Sun Records den Rücken zu kehren und bei einem anderen, größeren Label anzuheuern, allerdings ist er zunächst noch vertraglich an seinen Entdecker gebunden. Manche meinen, Cash habe den Absprung gewagt, um später bei Columbia Records eigene Gospelalben verwirklichen zu können. Das mag zum Teil stimmen, realistischer ist aber, dass er bei einem großen Label unterm Strich mehr verdienen wollte, da er natürlich prozentual am Verkauf der Platten beteiligt war. Und vielleicht ist Cash auch nicht mehr ganz glücklich mit den Pop-orientierten Arrangements von Jack Clement. Schließlich wendet sich Sam Phillips verstärkt anderen Talenten zu, etwa Roy Orbison, allen voran aber Jerry Lee Lewis, der auf lange Sicht die Lücke füllen soll, die Elvis seit seinem Weggang von Sun-Records hinterlassen hat. Und tatsächlich heizt Lewis gegen Ende des Jahres 1957 mit Hits wie »Great Balls of Fire« mächtig ein.
Jedenfalls fühlt sich Cash nicht mehr ganz wohl bei Sun Records, hat womöglich den Eindruck, unfair behandelt zu werden. Es kommt zu Unstimmigkeiten, weil er nicht mit offenen Karten spielt und den Plattenboss über seine wahren Absichten im Unklaren lässt.
Nach Cashs Weggang von Sun Records veröffentlicht Phillips, ganz Geschäftsmann, weiterhin Titel, die Cash vor seinem Weggang noch brav für das alte Label eingespielt hat (sein Vertrag lief erst im Sommer 1958 aus). Phillips hat die Songs zurückgehalten, sie werden nachbearbeitet und über die folgenden Jahre in regelmäßigen Abständen veröffentlicht. Bis in die 70er Jahre hinein erscheinen Cash-LPs, die von Sun Records bzw. ab 1969 von der Sun International Corporation veröffentlicht wurden – denn das Label will von Cashs grandiosem Erfolg auch nach seinem Weggang so lange wie möglich profitieren.
Am 1. August 1958 unterschreibt Cash schließlich bei Columbia Records.