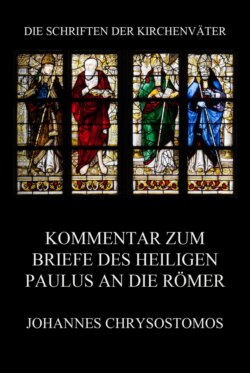Читать книгу Kommentar zum Briefe des Heiligen Paulus an die Römer - Johannes Chrysostomos - Страница 12
SIEBENTE HOMILIE. * Kap. II, V. 17—28 und Kap. III. V. 1—8. *
Оглавление1.
Kap. II, V. 17—28 und Kap. III. V. 1—8. V. 17: „Siehe, du heißt ein Jude und ruhst auf dem Gesetz und rühmst dich in Gott und kennst seinen Willen, weißt klarzulegen das Unterscheidende, belehrt vom Gesetze.“
Der Apostel hat bisher gesagt, daß dem Heiden nichts abgehe zu seiner Rettung, sofern er nur ein Befolger des Gesetzes sei, und hat jenen bewundernswerten Vergleich durchgeführt; nunmehr führt er die Vorzüge der Juden an, auf die sie sich gegenüber den Heiden etwas einbildeten. Der erste große Vorzug war ihr Name, so wie jetzt der Name „Christ“ ein solcher ist. Der Name machte auch damals viel aus. Darum macht er damit den Anfang. Beachte nun, wie scharf er unterscheidet! Er sagt nicht „Du bist ein Jude“, sondern: „Du heißt ein Jude und rühmst dich in Gott“, d. h. als seist du geliebt von ihm und bevorzugt vor den andern Menschen. Es will nur scheinen, als habe der Apostel bei diesen Worten ihre Einbildung und ihre große Ruhmredigkeit im Auge; er deutet an, daß sie dieses große Geschenk nicht zu ihrem Heile benützten, sondern zur Herabsetzung und Verachtung der andern. — „Und kennst seinen Willen, weißt klarzulegen das Unterscheidende“. Auch selbst das ist ein Nachteil, wenn das Werk dazu fehlt. Gleichwohl schien es ihnen ein Grund zum Stolze zu sein. Er wählt darum die Worte mit scharfer Unterscheidung. Er sagt nicht: „Du tust“, sondern: „Du erkennst und weißt klarzulegen“; zur Ausführung kommst du aber nicht.
V. 19: „Du bildest dir ein, ein Führer der Blinden zu sein.“ Auch hier sagt er wieder nicht: „Du bist ein Führer von Blinden“, sondern: „Du bildest dir ein“, du gibst vor, es zu sein. Denn groß war der Dünkel der Juden. Darum gebraucht der Apostel hier fast dieselben Worte, mit denen sich jene rühmten. Sieh, wie sie im Evangelium sprechen: „Du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren?“ 85 Sie dünkten sich hoch erhaben über alle. Das will Paulus rügen. Darum fährt er fort, die einen zu erheben, die andern herabzudrücken, damit er den Juden auf diese Weise mehr zusetze und die Anklage noch schwerer gestalte. Er verstärkt denselben Gedanken, indem er ihn in verschiedenen Gedanken wiederholt.
V. 20: „Da bildest dir ein, ein Führer der Blinden zu sein, ein Licht denen, die in Finsternis sitzen, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der ein Bild der Wissenschaft und der Wahrheit im Gesetze besitze.“
Er sagt abermals nicht: im Gewissen, im Handeln, im Rechttun, sondern: „im Gesetze“. Was der Apostel oben von den Heiden gesagt hat, das sagt er auch hier. Dort sagte er: „Worin du einen andern richtest, darin verurteilst du dich selbst.“ Dasselbe sagt er hier.
V. 21: „Einen andern belehrst du, dich selbst belehrst du nicht.“
Dort gebraucht er übrigens eine schärfere Ausdrucksweise, hier eine gelindere. Er sagt nicht: Darum verdienst du größere Strafe, weil du so große Gnaden empfangen und keine davon, wie du solltest, benützt hast, sondern er kleidet seine Rede in die Form einer Frage, indem er spricht: „Einen andern belehrst du, dich selbst belehrst du nicht?“ — Betrachte indes noch von einer andern Seite das kluge Vorgehen des Paulus! Er führt lauter Vorzüge der Juden an, welche nicht eine Frucht ihrer eigenen Bemühung, sondern ein Geschenk von oben waren, und zeigt, daß sie ihnen bei ihrer Sorglosigkeit nicht nur nutzlos gewesen seien, sondern ihnen sogar noch eine Vergrößerung der Strafe eingetragen haben. Denn der Name „Jude“ war nicht ihr Verdienst, ebensowenig, daß sie das Gesetz empfangen hatten, noch auch das andere, das er aufzählt, sondern das alles war ein Werk der Gnade von oben. Früher hat er gesagt, daß das Hören des Gesetzes nichts nütze, wenn nicht das Handeln dazu komme. „Nicht die Hörer des Gesetzes“, sagt er, „sind gerecht bei Gott.“ Jetzt zeigt er noch mehr: Daß nicht bloß das Hören des Gesetzes, sondern, was viel mehr als das Hören ist, daß auch das Lehren desselben dem keinen Vorzug gewährt der bloß lehrt, aber selbst nicht tut, was er lehrt. Ja, nicht allein keinen Vorzug gewährt es, sondern es gereicht zur größeren Strafe. Er gebraucht dabei einen treffenden Ausdruck. Er sagt nämlich nicht: Du hast das Gesetz empfangen, sondern: „Du ruhst auf dem Gesetze.“ Der Jude brauchte sich nicht abzumühen, er brauchte nicht herumzugehen und zu suchen, was zu tun sei, sondern er hatte es bequem; das Gesetz zeigte ihm den Weg, der zur Tugend führt. Denn wenn auch die Heiden die natürliche Vernunft besitzen, weswegen der Apostel von ihnen rühmt, daß sie, ohne Hörer des Gesetzes zu sein, alles tun, so hatten es die Juden doch viel leichter. Wenn du einwendest: Ich bin nicht bloß Hörer des Gesetzes, sondern ich unterrichte darin, so vermehrt das nur deine Strafwürdigkeit. Weil sich die Juden darauf viel einbildeten, deswegen machten sie sich gerade recht lächerlich. Wenn er sagt: „Führer der Blinden, Erzieher der Unverständigen, Lehrer der Unmündigen“, so drückt er damit ihren Stolz aus. Er zeigt nämlich, wie hochmütig sie ihre Proselyten behandelten, daß sie ihnen solche Namen gaben.
2.
Daß er ihre vermeintlichen Lobestitel anführt, tut er deswegen, weil er weiß, daß sie die Grundlage einer um so schwereren Anklage bilden. — „Der ein Bild der Wissenschaft und der Wahrheit im Gesetze besitze.“ Das ist so, wie wenn jemand, der ein Bildnis des Königs besitzt, ihn trotzdem nicht danach malen kann, während ihn andere, denen keines zur Verfügung steht, auch ohne ein Vorbild richtig darstellen. Nachdem der Apostel ihre Ruhmestitel angeführt hat, die sie von Gott hatten, spricht er von ihren schwachen Seiten, die ihnen die Propheten zum Vorwurf machen, und führt sie einzeln vor. „Du belehrst einen andern, dich selbst belehrst du nicht.“ * „Du predigst, man dürfe nicht stehlen und stiehlst selbst.“
V. 22: „Du sagst, man solle nicht ehebrechen und brichst selbst die Ehe; du verabscheust die Götzenbilder und schändest das Heiligtum.“ *
Es war nämlich streng verboten, Dinge, die mit dem Götzendienst in Beziehung standen, auch nur zu berühren, weil sie als etwas Verabscheuungswürdiges galten. Aber die Geldgier, die euch beherrscht, will der Apostel sagen, hat euch dazu gebracht, das Gesetz auch in diesem Punkte zu übertreten.
V. 23: „Du rühmst dich des Gesetzes, entehrst aber Gott durch Übertretung des Gesetzes.“
Zwei Beschuldigungen wirft er da auf oder eigentlich drei: daß sie (Gott) verunehren, daß sie ihn durch das verunehren, wodurch sie selbst (von ihm) geehrt worden sind, und daß sie den verunehren, der sie selbst geehrt hat, ein Übermaß von Undankbarkeit. Dann führt er den Propheten als ihren Ankläger auf, damit es nicht den Anschein habe, als führe er Klage aus persönlichen Gründen, zuerst kurz, gedrängt und im allgemeinen, später im einzelnen, einmal Isaias, dann, als er die Anklagen häuft, David. Nicht ich, ist der Sinn seiner Worte, sage das, um euch zu schmähen, sondern hört nur, was Isaias sagt:
V. 24: „Der Name Gottes wird eurethalben gelästert unter den Heiden.“
Sieh da, wieder eine zweifache Anklage. Nicht genug, sagt er, daß sie selbst gegen Gott freveln, sie bringen auch andere dazu. Was ist also die Belehrung nütze, wenn ihr euch selbst nicht belehrt? Aber oben spricht er nur davon allein, hier aber geht er auch aufs Gegenteil über. Nicht bloß euch selbst belehrt ihr nicht, sondern auch die andern belehrt ihr nicht über ihr Tun; und was noch viel schlimmer ist, ihr belehrt sie nicht nur nicht über die Forderungen des Gesetzes, sondern ihr lehrt sie gerade das Gegenteil, nämlich Gott lästern, was dem Gesetz entgegen ist. Aber die Beschneidung ist doch etwas Großes, sagst du. Das gestehe auch ich zu, aber nur dann, wenn sie eine Beschneidung des Innern ist. Beachte den Zusammenhang, wie der Apostel gerade an der rechten Stelle die Rede darauf bringt! Er hat nicht gleich mit der Beschneidung begonnen, weil sie in hoher Meinung stand; sondern erst nachdem er gezeigt hat, daß die Juden sich in größeren Stücken verfehlt haben, ja daß sie sogar der Gotteslästerung schuldig sind. Erst als er den Zuhörer dazu gebracht hat, sie zu verurteilen und als er sie ihres Vorzuges entkleidet hat, dann erst bringt er die Rede auf die Beschneidung, dann erst als er sicher ist, daß niemand für sie Partei ergreifen wird. Er sagt:
V. 25: „Die Beschneidung nützt zwar, wenn du das Gesetz erfüllst.“
Es wäre möglich gewesen, die Beschneidung in anderer Weise als unwirksam zu erklären, nämlich zu sagen: Was ist die Beschneidung? Doch nicht eine gute Tat dessen, der sie trägt? Auch nicht die Bekundung eines guten Vorhabens? Sie wird ja in einem unreifen Alter vorgenommen, und die in der Wüste blieben alle lange Zeit unbeschnitten. Aus diesen und vielen anderen Gründen hätte man zur Einsicht kommen können, daß sie nicht gar so notwendig sei. Jedoch gleichwohl geht der Apostel nicht von da aus, um sie als unwirksam zu erklären, sondern von einer Seite, die sehr günstig war — von Abraham. Denn der Sieg ist vollständig, wenn gezeigt wird, daß ihr gerade von der Seite Geringschätzung zuteil wird, von welcher sie den Juden verehrungswürdig war. Er hätte ebenso sagen können, daß auch die Propheten die Juden Unbeschnittene nennen. Aber das ist kein Fehler der Beschneidung, sondern derer, die sie mißbrauchten. Worauf es ihm ankommt, ist, zu zeigen, daß sie im tugendhaftesten Leben keine Rolle spielt. Das folgert er weiter unten. Doch hier führt er den Patriarchen (Abraham) noch nicht an, sondern er geht der Beschneidung von einer andern Seite zu Leibe. Später erst, als er vom Glauben spricht, lenkt er seinen Blick auf ihn, wenn er sagt: „Wie ward der Glaube dem Abraham angerechnet? Als Beschnittenem oder als Unbeschnittenem?“ Solange nämlich der Apostel gegen den Heiden und Unbeschnittenen im Kampfe steht, will er nichts davon sagen, um nicht verletzend zu werden; wie aber die Beschneidung in Gegensatz zum Glauben tritt, zieht er schärfer gegen sie los.
Bis hieher richtet sich der Kampf des Apostels gegen das Nichtbeschnittensein. Darum sänftigt er seine Rede und sagt: „Die Beschneidung nützt wohl, wenn du das Gesetz erfüllst;
bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung Vorhaut geworden.“
— Von zweierlei Unbeschnittensein und von zweierlei Beschneidung spricht hier der Apostel, wie auch von zweierlei Gesetz. Es gibt nämlich ein natürliches Gesetz und ein geschriebenes; aber in der Mitte zwischen beiden liegt das Gesetz, welches sich durch die Werke äußert. Gib nun acht, wie er diese drei (Gesetze) anschaulich darstellt. Er sagt: „Denn wenn die Heiden, die kein Gesetz haben …“ welches Gesetz, sag mir? — Das geschriebene. „… von Natur die Forderungen des Gesetzes erfüllen …“ welches Gesetzes? — Des Gesetzes, das sich durch die Werke äußert, „… so sind sie, welche kein Gesetz haben …“ welches Gesetz? — Das geschriebene, „… sich selbst Gesetz.“ Wieso? Indem sie das natürliche Gesetz anwenden. „Solche tragen zur Schau das Werk des Gesetzes.“ Welches? Des Gesetzes, das sich durch das Tun äußert. Jenes, das Buchstabengesetz, liegt außer uns, dieses, das Naturgesetz, liegt in uns, das dritte liegt im Handeln. Das eine tun Buchstaben kund, das andere die Natur, das dritte die Handlungen. Dieses dritte tut not, seinetwegen bestehen die beiden andern, das Naturgesetz und das Buchstabengesetz; wenn das nicht in Erscheinung tritt, dann sind jene nutzlos, ja sie sind sogar zum größten Schaden. Vom Naturgesetz drückt dies der Apostel aus in den Worten: „Worin du einen andern richtest, darin verurteilst du dich selbst“; vom geschriebenen aber: „Du predigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selbst.“ Ebenso gibt es auch zweierlei Unbeschnittenheit, eine natürliche und eine moralische; auch zweierlei Beschneidung, eine, die am Fleische, und eine andere, die am Willen vollzogen wird. Wenn z. B. jemand am achten Tage beschnitten wird, so ist das die fleischliche Beschneidung; tut aber jemand alles, was im Gesetze steht, so ist das eine seelische Beschneidung. Und das ist die, welche Paulus vor allem fordert oder vielmehr das Gesetz selbst.
3.
Sieh also, wie er sie (die fleischliche Beschneidung) dem Wortlaute nach zwar zugibt, in Wirklichkeit aber aufhebt. Er sagt nämlich nicht: Die Beschneidung ist überflüssig, sie ist Unsinn, sie ist unnütz, sondern was sagt er? „Die Beschneidung nützt wohl, wenn du das Gesetz erfüllst.“ Er gibt sie vorläufig zu, indem er sagt: Ja, ich gestehe zu, ich widerspreche nicht, daß die Beschneidung etwas Gutes ist; jedoch wann? Wenn sie von der Beobachtung des Gesetzes begleitet ist. „Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung Vorhaut geworden.“ Er sagt nicht: Sie nützt nichts, um nicht den Anschein zu erwecken, als wolle er sie beschimpfen; sondern er spricht zuerst dem Juden das Beschnittensein ab, dann verwirft er ihn. Auf diese Weise trifft der Schimpf nicht die Beschneidung, sondern den, der ihrer durch eigene Lässigkeit verlustig gegangen ist. Wie die Richter Männer in hohen Ehrenstellen, die bei Begehung großer Verbrechen verhaftet worden sind, erst ihrer Würde entkleiden und dann erst die Strafe über sie aussprechen, so verfährt Paulus. Nachdem er gesagt hat: „Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes“, fährt er fort: „… so ist deine Beschneidung Vorhaut geworden.“ Auf diese Weise hat er gezeigt, daß der Jude eigentlich unbeschnitten ist; und nun verurteilt er ihn ohne Bedenken.
V. 26: „Wenn nun der Unbeschnittene die Vorschriften des Gesetzes hält, wird da nicht seine Vorhaut in Beschneidung umgewandelt werden?“
Sieh, was er macht! Er sagt nicht, daß die Unbeschnittenheit die Beschneidung übertrifft — dadurch hätte er ja bei seinen Zuhörern sehr angestoßen —, sondern daß die Unbeschnittenheit in Beschneidung umgewandelt worden ist. Er untersucht weiter, was die Beschneidung sei und was die „Vorhaut“. Er sagt, die Beschneidung bestehe in einer guten Handlungsweise, die Vorhaut in einer schlechten. Den Unbeschnittenen, der sich einer guten Handlungsweise befleißt, beansprucht er für die Beschneidung, den Beschnittenen dagegen mit einem verderbten Leben verweist er unter den Begriff „Vorhaut“. Den Vorzug gibt er dann dem Unbeschnittenen. Er sagt aber nicht „dem Unbeschnittenen“, sondern er setzt dafür die Handlungsweise, indem er sagt: „Wird da nicht deine Vorhaut in Beschneidung umgewandelt werden?“ Er sagt auch nicht „angesehen werden“, sondern „umgewandelt werden“, was nachdrucksvoller ist. So hat er auch oben nicht gesagt: „Deine Beschneidung ist als Vorhaut angesehen worden“, sondern „ist Vorhaut geworden“.
V. 27: „Und es wird dich richten die natürliche Vorhaut…“
Du siehst, daß der Apostel zweierlei Vorhaut kennt, eine im natürlichen und eine im übertragenen Sinne; hier spricht er von der natürlichen, aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern fährt fort:
„… die das Gesetz beobachtet, dich, der du bei Schrift und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist.“
— Beachte da seine überaus feinsinnige Unterscheidung! Er sagt nicht, daß die natürliche Vorhaut die Beschneidung richten wird, sondern er setzt zwar immer da, wo etwas Rühmenswertes zu sagen ist, das Wort „Vorhaut“, wo dagegen etwas Nachteiliges ausgesagt werden muß, läßt er nicht die Beschneidung als schuld an dem Nachteil erscheinen, sondern den beschnittenen Juden. Er fürchtet nämlich, sonst beim Zuhörer anzustoßen. Auch sagt er nicht: Dich, der du Gesetz und Beschneidung hast, sondern noch zurückhaltender: „Dich, der du bei Schrift und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist“; d. h. die Vorhaut in diesem Sinne (nämlich bei Gesetzesbeobachtung) rettet der Beschneidung die Ehre, denn ihr ist Unrecht geschehen (nämlich von dem Beschnittenen, der das Gesetz übertreten hat); auch kommt sie dem Gesetz zu Hilfe, denn ihm ist Gewalt angetan worden; so stellt er ein leuchtendes Siegeszeichen auf. Der Sieg ist gerade deswegen ein glänzender, weil nicht der Jude vom Juden, sondern von dem Unbeschnittenen gerichtet wird, so wie wenn es heißt: „Die Männer von Ninive werden aufstehen und dieses Geschlecht verurteilen“ 86. Der Apostel tut also dem Gesetz keinen Abbruch an seiner Ehre — im Gegenteil, er hat große Hochachtung davor —, sondern sein Tadel gilt dem, der sich gegen das Gesetz vergeht. Nachdem er dies klar gemacht hat, umgrenzt er weiter freisinnig den Begriff „Jude“ und legt dar, daß er nicht den Juden und nicht die Beschneidung verwerfe, sondern gerade den Nicht-Juden und den Nicht-Beschnittenen. Scheinbar rettet er der Beschneidung die Ehre, aber doch zerstört er die hohe Meinung von ihr, indem er sie nur insoweit gelten läßt, als sie einen Erfolg (nämlich im sittlichen Leben) aufweist. Er zeigt nämlich, daß gar kein Unterschied bestehe zwischen einem Juden und einem Unbeschnittenen, ja daß sogar der Unbeschnittene höher stehe, wenn er acht hat auf sich; das sei der eigentliche Jude. Darum sagt er:
V. 28: „Denn nicht wer es im Äußeren ist, ist ein Jude, noch ist Beschneidung, die äußerliche, die am Fleische.“
— hier gibt er denen einen Merks, die alles nur des äußeren Scheines wegen tun —,
„sondern wer es im Innern ist, ist ein Jude, und Beschneidung ist eine solche des Herzens, dem Geiste und nicht dem Buchstabe nach.“
4.
Mit diesen Worten schließt er alles Körperliche aus; denn die Beschneidung war etwas Äußerliches, ebenso die Sabbate und die Opfer und die Reinigungen. Das alles ist inbegriffen in den Worten: „Denn nicht das Äußerliche macht den Juden aus.“ Da aber die Beschneidung ein hohes Ansehen genoß, so daß selbst der Sabbat hinter ihr zurückstand, verbreitet er sich mit Recht mehr über sie. Mit dem Worte: „Im Geiste“ arbeitet er der Heilsordnung der Kirche vor und kommt auf den Glauben zu sprechen; denn dieser hat nur sein Lob bei Gott, wenn er im Herzen und im Geiste lebt. Warum zeigt er des weiteren nicht, daß der Heide, wenn er recht handelt, dem Juden, der recht handelt, nicht nachsteht, sondern daß der Heide, wenn er recht handelt, vor dem Juden, der ein Gesetzesübertreter ist, den Vorzug hat? Um den Sieg (über die Beschneidung) nicht zweifelhaft erscheinen zu lassen. Denn wenn das einmal zugegeben ist, dann ist die Beschneidung notwendigerweise abgetan, und es ist klar geworden, daß es ganz und gar nur auf das (gute) Leben ankommt. Wenn nämlich der Heide ohne alles das gerettet, der Jude aber mit allem dem der Strafe verfällt, dann ist das Judentum aufgehoben. Unter einem „Heiden“ versteht aber der Apostel wieder nicht einen Götzenanbeter, sondern einen gottesfürchtigen und tugendhaften Menschen, der nur der Vorschriften des (mosaischen) Gesetzes entbehrt.
Kap. III, V. 1: „Was hat nun der Jude voraus?“
Nachdem der Apostel durch den Satz: „Das Äußerliche macht den Juden nicht aus, sondern das Innere“, alles ausgeschlossen hat: das Hörersein (des Gesetzes), das Lehren (desselben), den Namen „Jude“, die Beschneidung und alles andere, sieht er einen Einwand auftauchen und tritt ihm entgegen. Welches ist dieser Einwand? Wenn alles das, könnte jemand sagen, nichts nützt, wozu ist dann das (jüdische) Volk auserwählt und wozu ist ihm das Gesetz gegeben worden? Was tut nun der Apostel? Wie löst er ihn? Auf dieselbe Weise wie oben. Er hat auch dort sein Loblied auf die Juden gesungen; er hat Gottes Wohltaten, nicht aber ihre guten Werke verherrlicht. Er hat ihnen denselben Vorwurf gemacht wie der Prophet, der spricht: „Nicht also tat er allen Völkern und offenbarte ihnen nicht seine Satzungen“ 87, und Moses wiederum spricht: „Fraget, ob jemals dergleichen geschehen, ob jemals ein Volk die Stimme Gottes aus der Mitte des Feuers gehört habe und am Leben geblieben sei?“ 88 Ebenso verfährt der Apostel hier. Oben, wo er von der Beschneidung sprach, sagte er nicht: die Beschneidung nützt nichts ohne das (rechte) Leben, sondern: die Beschneidung nützt in Verbindung mit dem rechten Leben. Es ist dasselbe, aber milder ausgedrückt. Und wieder nach: „…Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes“, sagt er nicht: So nützt dir die Beschneidung nichts, sondern: „Dann ist deine Beschneidung Vorhaut geworden.“ Und hierauf sagt er wieder nicht: Die Vorhaut wird die Beschneidung richten, sondern: „Dich, den Gesetzesübertreter“. Er läßt die Satzungen unberührt und trifft nur die Menschen. Ebenso macht er es hier. Er wendet sich selbst ein: „Was hat also der Jude voraus?“ und antwortet nicht darauf: Nichts, sondern er gibt dem Wortlaute nach zwar einen Vorzug zu; durch das Folgende hebt er ihn aber wieder auf, indem er zeigt, daß sie eben dieses Vorzuges wegen gestraft werden würden. Wieso? Ich will es sagen, indem ich den Einwand mit seinen eigenen Worten vortrage: „Was hat also der Jude voraus“, fragt er,* „oder was ist die Beschneidung nütze?“
V. 2: „Gar viel allerdings. Zuvörderst nämlich, daß sie mit den Aussprüchen Gottes betraut wurden.“ *
Siehst du, wie ich oben sagte, daß der Apostel nirgends ihre guten Werke, sondern die Wohltaten Gottes aufzählt? Was soll das heißen: Sie wurden betraut? Es soll heißen, daß sie das Gesetz eingehändigt bekommen, daß Gott sie einer so großen Auszeichnung würdig erachtete, wie die ist, ihnen Offenbarungen von oben anzuvertrauen. Ich weiß zwar, daß einige das: „sie wurden betraut“ nicht auf die Juden beziehen, sondern auf die Aussprüche, d. h. daß (von ihnen) das Gesetz geglaubt wurde; jedoch das Folgende schließt diese Deutung aus. Erstlich einmal soll ja in diesen Worten ein Vorwurf liegen; der Apostel will zeigen, daß die Juden eine große Wohltat von oben genossen, daß sie aber dafür großen Undank bewiesen. Ferner ist dies aus dem Folgenden ersichtlich; er fährt nämlich fort:
V. 3: „Was nun, wenn einige nicht glaubten?“ Wenn sie aber nicht glaubten, wie kann man sagen, daß die Aussprüche Gottes geglaubt wurden? Was will also der Apostel sagen? Daß Gott ihnen das anvertraute, nicht aber, daß sie seinen Worten Glauben schenkten. Was hätte dann das Folgende für einen Sinn? Er fährt nämlich fort: „Was nun, wenn einige nicht glaubten?“ Und was darauf folgt, erweist dasselbe; er fügt nämlich bei:
„Wird wohl ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne!“
— Das also, womit sie betraut wurden, nennt der Apostel Gottes Geschenk. Beachte hierbei wieder seine Klugheit! Den Vorwurf gegen sie führt er wieder nicht als seine Behauptung an, sondern in Form eines Einwandes, wie wenn er sagte: Aber du wirst vielleicht fragen: Was ist eine solche Beschneidung nütze? Sie machten ja doch nicht den Gebrauch davon, wie sie sollten; sie wurden mit dem Gesetze betraut und schenkten ihm keinen Glauben. Bisher ist er nicht in der Rolle eines scharfen Anklägers gegen die Juden aufgetreten, sondern indem er scheinbar Gott gegen ihre Anschuldigungen in Schutz nimmt, kehrt er die Anklage gegen sie selbst um. Was machst du geltend, fragt er, daß sie ihm keinen Glauben schenkten? Was beweist das gegen Gott? Wandelt denn die Undankbarkeit der Beschenkten die wohlwollende Gesinnung Gottes um? Bewirkt sie, daß angetane Ehre keine Ehre sei? Das ist gemeint, wenn er spricht: „Wird wohl ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne!“ Es ist, als wenn jemand sagte: Ich habe dem so und so eine Ehre antun wollen; wenn nun er die Ehrung nicht mag, so trägt das mir keinen Vorwurf ein und wirft kein schiefes Licht auf meine menschenfreundliche Gesinnung, sondern ist ein Beweis von der Gefühllosigkeit des andern. Doch Paulus sagt nicht bloß das, sondern noch viel mehr, nämlich, daß ihr Unglaube nicht bloß nicht Gott zur Last gelegt werden könne, sondern daß er seine menschenfreundliche Gesinnung und seine Absicht, sie zu ehren, in einem noch helleren Lichte erstrahlen lasse. Gott steht nämlich da als einer, der auch dem eine Ehre antut, der im Begriffe steht, ihn selbst zu verunehren.
5.
Siehst du, wie er ihnen gerade das, worauf sie so stolz waren, zu ihrer eigenen Verschuldung umstempelt? Gott hat ihnen so große Ehre angetan, er hat von seinem Wohlwollen nicht gelassen, obzwar er voraussah, was kommen wird, und sie haben die Ehrengeschenke selbst dazu benützt, gegen ihn zu freveln. Er sagt: „Was aber, wenn einige ihm keinen Glauben schenkten?“ während es doch wohl alle am Glauben haben fehlen lassen. Um jedoch nicht als ein allzu scharfer Ankläger und als ein Feind der Juden zu erscheinen, spricht er nicht einfach diese geschichtliche Tatsache aus, sondern kleidet das, was wirklich geschehen ist, in die Form eines Annahmesatzes, indem er spricht:
„Gott bleibe wahrhaft, sei auch jeder Mensch ein Lügner.“
—Was er damit sagen will, ist etwa das: Ich behaupte nicht, daß einige Gott keinen Glauben schenkten; wenn du willst, nimm an, alle seien ungläubig gewesen. Was tatsächlich geschehen ist, gibt er bedingungsweise zu, um nicht in den Verdacht der Feindseligkeit zu kommen. Aber auch das, sagt er, dient dazu, Gott nur noch mehr zu rechtfertigen. Was heißt: zu rechtfertigen? Wenn man einmal das sichten und nebeneinanderstellen wollte, was Gott für die Juden getan, und was sie Gott angetan haben, dann steht der Sieg auf seiten Gottes, und alles von ihm ist Rechttun. Nachdem er das mit eigenen Worten klar gemacht hat, führt er noch den Propheten an, der auch ein Verdammungsurteil über sie ausspricht, wenn er sagt:
„Auf daß du gerecht erfunden wirst in deinen Worten und den Sieg zugesprochen erhältst, wenn man über dich urteilt“. 89
—Er hat von seiner Seite alles getan, sie aber wurden keineswegs besser. — Hierauf bringt er noch einen andern Einwand vor, der auftauchen könnte, indem er sagt:
V. 5: „Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht setzt, was sollen wir daraus schließen? * Ist Gott nicht ungerecht, wenn er in seinem Zorne straft? — menschlich gesprochen.“ *
Das sei ferne! — Der Apostel erweist den Einwand als irrig, indem er eine unsinnige Folgerung daraus ableitet. Da das aber etwas unklar ist, muß ich mich deutlicher erklären. Was will er also sagen? Gott hatte den Juden Ehre angetan, sie aber haben ihn frevelhaft mißachtet. Das hat ihm den Sieg über sie verschafft; denn es gab ihm Gelegenheit, seine große Liebe zu den Menschen an den Tag zu legen, die sich darin äußert, daß er ihnen auch dann noch Ehre antut, wenn sie sich so gegen ihn benehmen. Da könnte jemand sagen: Nun gut; wenn wir gegen Gott freveln und Unrecht tun, so verschaffen wir ihm dadurch eigentlich einen Sieg, den nämlich, daß seine Gerechtigkeit in ihrem ganzen Glanze erstrahlt. Warum werde ich aber dann gestraft, da ich, doch durch meinen Frevel die Ursache seines Sieges geworden bin? — Wie löst nun der Apostel diesen Einwand? Wie gesagt, indem er eine unsinnige Folgerung daraus ableitet. Wenn du, sagt er, die Ursache seines Sieges geworden bist und hinterdrein gestraft wirst, so geschieht damit ein Unrecht von Seiten Gottes; bist du aber nicht ungerecht und wirst doch gestraft, so hast du damit Gott nicht zu einem Siege verholten. Beachte auch die Bedachtsamkeit des Apostels (im Ausdruck)! Nach den Worten: „Ist Gott nicht ungerecht, wenn er in seinem Zorne straft?“ fügt er bei: „menschlich gesprochen“. Er will sagen: Wie man nach menschlichen Begriffen zu reden pflegt. Denn das gerechte Urteil Gottes übertrifft bei weitem das, was uns gerecht vorkommt, und hat andere unerforschliche Gründe. — Weil das eben Vorgetragene etwas unklar war, wiederholt er denselben Gedanken noch einmal:
V. 7: „Denn wenn die Wahrhaftigkeit Gottes gerade durch mein Lügengewebe zu seiner Verherrlichung ans Licht kommt, was werde ich da noch als Sünder zur Rechenschaft gezogen?“
Wenn Gott, soll das heißen, infolge deines Ungehorsams als menschenfreundlich, gerecht und gütig offenbar wird, so solltest du nicht gestraft, sondern belohnt werden. Wenn aber dem so ist, dann wird ja zur Wahrheit jene sinnlose Rede, die im Munde vieler ist, daß aus dem Bösen das Gute hervorgehe und daß schuld am Guten das Böse sei; und notwendigerweise muß eines von diesen beiden gelten. Entweder erscheint Gott, wenn er straft, ungerecht, oder er trägt einen Sieg davon infolge unserer Bosheit, wenn er nicht straft. Beides ist über die Maßen ungereimt. Der Apostel erweist dies auch dadurch als falsch, daß er die Heiden als die Erfinder solcher Lehren einführt; er ist offenbar der Meinung, es genüge zur Kennzeichnung solchen Geredes, die Person derer zu kennen, die es aufgebracht haben. Denn sie waren es, die einst uns zum Spott sagten: Lasset uns Böses tun, damit Gutes daraus hervorgehe! Darum sagt er mit offenkundiger Beziehung darauf weiter:
V. 8: „Sollten wir da nicht, wie wir geschmäht werden und wie manche uns nachsagen, daß wir diesen Grundsatz vertreten, wirklich Böses tun, damit Gutes daraus hervorgehe? Die Verurteilung solcher ist offensichtlich.“
Es ist nämlich ein Ausspruch des Paulus: „Wo die Sünde überhand genommen, da war überschwenglich geworden die Gnade“ 90. Manche hatten ihn deswegen verspottet und, indem sie diesen Worten einen falschen Sinn unterlegten, gesagt, man müsse sich ans Böse halten, um das Gute zu genießen. Das hatte aber Paulus nicht gesagt. Indem er nun seinem Worte den richtigen Sinn gibt, sagt er: Was also? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überschwenglich werde? Das sei ferne! Von vergangenen Zeiten, will er sagen, habe ich damals gesprochen, nicht damit wir in Zukunft darnach handeln. Er weist diese Unterstellung auch dadurch zurück, daß er sagt, es sei ein solcher Sinn übrigens auch ganz unmöglich. Wie sollten wir, sagt er, wenn wir der Sünde abgestorben sind, in ihr noch fürderhin leben?
6.
Gegen die Heiden hatte es der Apostel leicht gehabt, loszugehen; denn ihr Leben war sehr verderbt. War dagegen das Leben der Juden auch sichtlich voller Nachlässigkeit, so hatten sie doch wichtige Deckmäntel: das Gesetz und die Beschneidung; ferner daß Gott mit ihnen verkehrt und sie zu Lehrern aller gesetzt hatte. Der Apostel hat sie darum aller dieser Vorzüge entkleidet und gezeigt, daß sie ihretwegen um so mehr würden gestraft werden. Auf dasselbe läuft auch hier seine Schlußfolgerung hinaus. Denn wenn Leute, die solches tun, sagt er, nicht gestraft werden, dann gilt notwendig die gotteslästerliche Rede: „Lasset uns Böses tun, damit Gutes daraus hervorgehe.“ Wenn aber eine solche Rede gottlos ist, und wenn die, welche sie im Munde führen, Strafe verdienen — das liegt in den Worten: „Die Verurteilung solcher ist offensichtlich“ —, dann ist es ganz offenbar, daß die Juden, (von denen der Apostel spricht,) strafbar sind. Denn wenn die schon Strafe verdienen, welche eine solche Rede im Munde führen, wieviel mehr die, welche nach ihr handeln; sind aber die Juden strafbar, dann sind sie es als Sünder. Denn der, welcher die Strafe verhängt, ist ja nicht ein Mensch, daß er auch ein irriges Urteil fällen könnte, sondern der alles gerecht ordnende Gott. Wenn sie aber gerechterweise gestraft werden, dann haben auch die, welche uns zum Spott jene Rede aufbrachten, damit unrecht; denn Gott hat alles getan und tut alles, um unsern Wandel zu einem leuchtenden zu machen und ihm allseits die rechte Richtung zu geben.
Lasset uns nicht sorglos dahinleben, dann werden wir imstande sein, auch die Heiden von ihrem Irrwege abzubringen. Wenn wir aber mit dem Munde zwar weise Reden führen, in unseren Handlungen aber verächtlich sind, mit was für Augen sollen wir da die Heiden anschauen? Mit was für Lippen über die Glaubenslehren (zu ihnen) reden? Der Heide wird nämlich zu jedem von uns sagen: Du handelst nicht recht in den geringen Dingen (des gewöhnlichen Lebens); wie willst du uns viel Höheres lehren? Du hast noch nicht gelernt, daß die Habsucht ein Übel ist; wie willst du uns weise Reden halten über himmlische Dinge? Oder weißt du es, daß sie ein Übel ist? Dann ist deine Verfehlung noch größer, da du sündigst mit Wissen. Doch was rede ich von den Heiden! Auch unsere eigene Religion gestattet uns nicht solchen Freimut im Reden, wenn unser Leben ein verderbtes ist. Denn „zum Sünder“, heißt es, „spricht Gott: Was schwatzest du von meinen Satzungen?“ 91 Als die Juden in der Gefangenschaft von den Persern einmal angegangen und gebeten wurden, ihnen ihre Gesänge des Herrn vorzusingen, da scheuten sie sich, es zu tun und sprachen: „Wie sollen wir singen den Gesang des Herrn im fremden Lande?“ 92 Wenn es aber unerlaubt war, im Lande der Barbaren die Aussprüche Gottes zu singen, um wieviel mehr unerlaubt wird es einer Barbarenseele sein? Eine Barbarenseele aber ist die Seele des Hartherzigen. Denn wenn das Gesetz den Gefangenen, die im fremden Lande Sklaven von Menschen geworden waren, Schweigen auferlegte, so ist es um vieles gerechter, daß die, welche Sklaven der Sünde und so gewissermaßen Angehörige eines fremden Reiches geworden sind, zum Schweigen gebracht werden. Obzwar jene Juden Musikinstrumente besaßen — es heißt ja: „An den Weiden inmitten jenes Landes hingen wir unsere Harfen auf“ —, so war es ihnen doch nicht gestattet. So ist es auch uns, obzwar wir Mund und Zunge — die Sprachwerkzeuge — besitzen, nicht erlaubt, nach Gefallen zu sprechen, solange wir Sklaven der Sünde sind, die härtere Herrschaft ausübt als alle Barbaren. Sag’ mir, was willst du zu einem Heiden sagen, der ein Räuber und ein Geizhals ist? Etwa: Laß ab von deinem Götzendienste? Erkenne den wahren Gott, und lauf nicht dem Silber und dem Golde nach? Wird er dich nicht auslachen und sprechen: Halte zuerst dir selbst solche Reden? Es ist nämlich nicht dasselbe, wenn ein Heide Götzendienst treibt und ein Christ sich derselben Sünde (durch den Geiz) schuldig macht. Wie werden wir imstande sein, andere von jenem Götzendienste abzubringen, wenn wir selbst nicht davon lassen? Wir sind ja uns selbst mehr unsere Nächsten als jenen. Wenn wir nun uns selbst nicht über- zeugen lassen, wie werden wir andere überzeugen? Denn wenn der, welcher seinem eigenen Hause nicht gut vorzustehen weiß, auch die Kirche nicht verwalten kann, wie wird jemand, der seiner eigenen Seele nicht vorzustehen weiß, imstande sein, andere zurecht zu richten? Sag’ mir nicht, daß du ja kein Götzenbild aus Gold anbetest, sondern zeig’ mir lieber, daß du nicht das tust, was dir das Gold befiehlt. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Götzendienst: der eine hält den Mammon für seinen Herrn, ein anderer hält den Bauch für seinen Gott und wieder ein anderer eine andere höchst schmähliche Leidenschaft. Du opferst ihnen nicht Rinder wie die Heiden? Aber du tötest — was noch schlechter ist — ihnen zuliebe deine eigene Seele! Du beugst nicht deine Knie vor ihnen und betest sie nicht an? Aber du tust mit voller Bereitwilligkeit alles, was immer sie dir befehlen mögen, diese deine Herren: der Bauch, das Gold, die Leidenschaft! Die Heiden waren deswegen verabscheuungswert, weil sie die Leidenschaften vergötterten: die sinnliche Gier stellten sie dar als Aphrodite, den Zorn als Ares, die Trunkenheit als Dionysos. Wenn auch du dir nicht Götzenbilder schnitzest wie jene, so unterwirfst du dich doch mit aller Bereitwilligkeit eben diesen Leidenschaften, machst die Glieder Christi zu Gliedern einer Hure und stürzest dich in andere Sünden.
Darum ermahne ich euch, zu beherzigen, wie übergroße Torheit dies ist, und diesen Götzendienst — denn so nennt Paulus die Habsucht — zu fliehen, nicht bloß die Sucht nach Geld, sondern auch die böse Begierde nach Kleiderpracht, nach Tafelfreuden und nach allem andern. Denn viel schwerer werden wir gestraft werden, wenn wir den Gesetzen des Herrn nicht gehorchen. „Der Knecht“, heißt es ja, „der den Willen seines Herrn kennt und ihn doch nicht tut, wird viele Streiche erhalten“ 93. Damit wir dieser Strafe entrinnen und uns und andern nützlich werden, laßt uns alle Bosheit aus der Seele entfernen und der Tugend nachstreben! Das werde uns allen zuteil durch die Gnade und Liebe unseres Herrn Jesus Christus, mit welchem dem Vater zugleich mit dem Hl. Geiste sei Ruhm, Ehre und Herrlichkeit jetzt und allezeit bis in alle Ewigkeit. Amen.