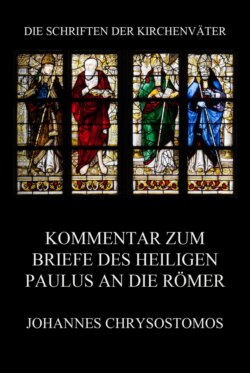Читать книгу Kommentar zum Briefe des Heiligen Paulus an die Römer - Johannes Chrysostomos - Страница 5
ОглавлениеAllgemeine Einleitung
1.
Kaum ein anderes Buch der Hl. Schrift ist so oft und mit soviel Aufwand von geistiger Kraft, freilich auch mit so weit auseinandergehenden Resultaten von den christlichen Theologen aller Jahrhunderte kommentiert worden wie der Brief des hl. Paulus an die Römer.
Daß der Römerbrief den Scharfsinn der Theologen zur Untersuchung reizte, mehr als jede andere der hl. Schriften, liegt in der gewaltigen Gedankenmacht, die in ihm beschlossen ruht. Die schwierigsten Probleme der christlichen Glaubenslehre wirft er auf, wie: Heilserlangung durch alttestamentliche Gesetzestreue und neutestamentlichen Glauben, das Verhältnis von Sünde und Gesetz, Verdienst und Gnade, eigener Mitwirkung zum Heil und göttlicher Vorherbestimmung, die Dogmen von der Erbsünde und der Erlösung durch Christus, und handelt über diese Fragen in oft recht verwickelten Gedankengängen.
Den ersten Kommentar zum Römerbriefe schrieb griechisch 0rigenes. In der Urschrift verloren gegangen, besitzen wir denselben nur in einer lateinischen Bearbeitung durch Rufinus (Migne, P. gr. XIV, 831–1294). Dieser hat jedoch die Urschrift nach eigenem Gutdünken gekürzt oder auch erweitert, so daß sich nicht immer genau feststellen läßt, was Urschrift und was Zugabe ist. Der älteste lateinische Kommentar ist der des Ambrosiaster aus der Zeit des Papstes Damasus (366—384). In der handschriftlichen Überlieferung dieses Kommentars wird als sein Verfasser ein Hilarius genannt, den der hl. Augustinus irrtümlich für Hilarius von Poitiers hielt. Wer dieser Hilarius war, ist nicht festzustellen, jedenfalls war es nicht der hl. Ambrosius, dem seit Kassiodors Zeiten diese „Commentaria in tredecim epistolas B. Pauli“ zugeschrieben wurden. Seitdem Erasmus den Irrtum des Kassiodor aufgedeckt hat, heißt der Autor gewöhnlich Ambrosiaster, d. i. Pseudo-Ambrosius (Migne, P. l. XVII, 45–184). Ein dritter Kommentar des Römerbriefes der in die Zeit vor Johannes Chrysostomus hin aufreicht, ist der des hl. Ephraem des Syrers (ca. 306–373), „eine ziemlich sprunghafte und flüchtige Besprechung ausgewählter Stellen“1. Er ist in armenischer Übersetzung erhalten (herausg. von den Mechitaristen, Venedig 1836) und wurde von derselben Genossenschaft später ins Lateinische übertragen (S. Ephraem Syri comm. in epist. D. Pauli a patribus Mekitharistis translati, Venetiis 1893, 2–46).
2. Eigenart und Echtheit
Die exegetische und homiletische Eigenart des hl. Johannes Chrysostomus spiegelt sich in dem Kommentare so unverkennbar wider, daß er aus diesem inneren Grunde allein als unzweifelhaft echt angesprochen werden darf. Als Exeget war Chrysostomus ein Vertreter der antiochenischen Schule, die im Gegensatz zur alexandrinischen bei der Schrifterklärung ihre Hauptaufgabe darin erblickte, den Wortsinn festzustellen, während die Alexandriner in der Schrift in erster Linie den allegorischen Sinn suchten. An zahlreichen Stellen geht Chrysostomus in der Zergliederung einzelner Worte soweit, daß seine Rede mehr den Ton der Schule als den der Kanzel annimmt.
Nüchtern wie in der Exegese bleibt Chrysostomus auch in der dogmatischen Spekulation, ja hier grenzt seine Sparsamkeit schon fast an Mangel. Die großen dogmatischen Probleme, die der Römerbrief anschneidet, können ihn nicht veranlassen, sich tiefer mit ihnen zu beschäftigen, so daß wir uns oft geradezu enttäuscht fühlen in der Erwartung, etwas Entscheidendes von ihm über jene Fragen zu hören. Dafür entschädigt er uns aber reichlich durch die homiletische Ausmünzung seines Stoffes. Kaum entgeht ihm etwas, was eine Anwendung auf das christliche Leben seiner Zuhörer zuließe, ungenützt. Mit apostolischem Eifer, der aber auch die psychologisch wirksamste Aneinanderreihung der Argumente nicht übersieht und rhetorische Kunstmittel nicht verschmäht, dringt er stets auf die sittliche Besserung seiner Zuhörer. Dabei läßt er sich von seinem Eifer manchmal etwas zu lange bei der Strafrede gegen die Laster festhalten und zu Ausdrücken und Vergleichen hinreißen, die unser feinfühliges Empfinden überraschen. Ein Redner und Menschenkenner wie er hat aber jedenfalls wohl abgewogen, wie weit er mit Rücksicht auf die sittliche und ästhetische Eigenart seiner Zuhörerschaft gehen durfte. Echt chrysostomische Art ist auch die Häufigkeit von Vergleichen und Bildern, die diese Homilien auszeichnet. In ihrer sinnenfälligen Darstellung und praktischen Tendenz sind sie vielfach auch für den heutigen Prediger mustergültig und des Studiums wert; weniger nachahmenswert ist des großen Redners μακρολογία — manche seiner Homilien würden wohl zwei Stunden zum Vortrag in Anspruch nehmen — und seine ἀκρίβεια in der Untersuchung des Schrifttextes, die eine mit dem Wortlaut der Hl. Schrift sehr vertraute Zuhörerschaft voraussetzt. Der an Chrysostomus oft bewunderte Attizismus der Sprache zeichnet die Homilien zum Römerbrief hervorragend aus und läßt sie auch stilistisch als echte Geisteskinder des größten Redners der Ostkirche erscheinen.
Sprechen somit unabweisbare innere Gründe für die Echtheit dieser Chrysostomus-Homilien, so fehlt es auch nicht ganz an äußerer Bezeugung. Der Hauptzeuge ist Augustinus, der im ersten Buch seiner Streitschrift gegen den Pelagianer Julian (1, 27) zahlreiche Stellen aus der elften (zehnten) Homilie zum Beweis dafür anführt, daß Chrysostomus über die Erbsünde keineswegs pelagianisch gedacht habe. Isidor von Pelusium (ca. 370–440) kennt ebenfalls die Homilien des Chrysostomus zum Römerbrief und rühmt ihnen ein Verständnis für den paulinischen Text und eine Eleganz der Sprache nach, daß Paulus selbst, wie er meint, sich nicht besser hätte kommentieren können (Epist lib. V 32. Migne, P. gr. LXXVIII 1348).
3. Zeit und Ort der Abfassung
Die Ausgefeiltheit der Sprache und der kunstgemäß rhetorische Aufbau, wodurch sich die Homilien zum Römerbrief auszeichnen, sind nicht allein ein Zeugnis für ihre Echtheit, sondern geben auch einen Fingerzeig für die Zeit und den Ort ihrer Abfassung. Photius und nach ihm Savile wenigstens erblicken darin einen Beweis, daß sie von Johannes während der Zeit seines Wirkens als Diakon und Presbyter in Antiochien (381–398) gehalten worden seien, weil seine Predigten aus dieser Zeit durch sorgfältigere Ausarbeitung vor den als Patriarch in Konstantinopel gehaltenen hervorstechen. Tillemont hält dieses Argument allein freilich nicht für entscheidend, da auch sicher von Johannes in Konstantinopel gehaltene Predigten nicht weniger sorgfältig gearbeitet seien. Doch kommt er zu demselben Schluß auf Grund mancher Bemerkungen in den Predigten selbst, die auf Antiochien als Ort ihrer Abfassung hinweisen. In der neunten (achten) Homilie spricht nämlich Johannes davon, daß er und seine Zuhörer „unter demselben Hirten“ stehen. Das läßt den Schluß zu, daß er damals noch nicht Bischof war, also noch Diakon oder Priester unter dem Bischof Flavian in Antiochien. Noch deutlicher geht aus der einunddreißigsten (dreißigsten) Homilie hervor, daß sie zu Antiochien gehalten wurde. Um die Zuhörer in inniger Liebe zu dem Weltapostel zu entflammen, weist der Prediger nämlich darauf hin, daß der Ort, wo sie leben, voll Erinnerungen an Paulus sei. Nun war aber Paulus niemals in Konstantinopel, wohl aber in Antiochien gewesen. Dem gegenüber wollen manche in einem Ausfalle in der Homilie gegen solche, welche es mit scheelen Blicken betrachten, wenn andere durch ihre Beredsamkeit geistlichen Nutzen schaffen, eine Anspielung auf Severian von Gabala und den Patriarchen Theophilus von Alexandrien, zwei der schärfsten Gegner des Chrysostomus in seiner Konstantinopeler Zeit, erblicken. Doch sind die hier geschilderten Äußerungen des Neides viel zu unbestimmt, als daß sie den oben angeführten Beweisgründen für die antiochenische Zelt die Waage halten könnten. Es kann also mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, daß die Homilien zum Römerbrief von Chrysostomus in Antiochien gehalten worden sind.
4. Druckausgaben und Übersetzungen
Über Ausgaben und Übersetzungen unterrichtet die vorzügliche Chrysostomusbibliographie von Baur2. Darnach wurde der Kommentar erstmals griechisch gedruckt in der Ausgabe der Chrysostomuskommentare zu den paulinischen Briefen, die der Bischof Gibert von Verona im Jahre 1529 durch die Druckerei der Brüder Sabio in Verona in vier Bänden veranstaltete. Die erste kritische Ausgabe des griechischen Textes veröffentlichte Henry Savile in seiner Gesamtausgabe der Chrysostomusschriften zu Eton 1612, die letzte Friedrich Field zu Cambridge 1839 als ersten Band seines Chrysostomuskommentars zu den paulinischen Briefen. Er hat elf Handschriften dazu benützt. In der Migne-Ausgabe der Patrologia Graeca ist der Chrysostomuskommentar zum Römerbrief im sechzigsten Band, S. 385–682 enthalten.
Die Übersetzungen ins Lateinische sind zahlreich3. Ins Deutsche übertragen sind die Homilien zum Römerbrief von Wilhelm Arnoldi, Trier 1831, zweite Auflage Regensburg 1858, und von J. Wimmer in der Kemptener „Bibliothek der Kirchenväter“, Kempten 1880.
Der vorliegenden Neuübersetzung ist der von Field rezensierte griechische Text (Editio nova, Oxonii 1849) zugrunde gelegt. Auch die Fieldsche Zählung der Homilien, die der gewöhnlichen um eins voraus ist, da sie die Einleitung als erste Homilie zählt, wurde angewendet und die Einteilung der Homilien in Paragraphen nach der griechischen Vorlage wie in den bisher erschienenen Bänden beibehalten, obgleich sie nicht immer sinngemäß ist. Daneben wurde der besseren Übersicht wegen der Text auch nach den Versen des kommentierten Briefes eingeteilt. Die Übersetzung bindet sich nicht an das Wort des griechischen Textes, sondern strebt vor allem nach einer gut deutschen, leicht verständlichen Wiedergabe desselben, entfernt sich jedoch auch nicht unnötig weit von der Urschrift. Fremdwörter sind nach größter Möglichkeit vermieden. Angestrebt wurde ein gut deutscher Pedigtstil, weil ja, wie Chrys. Baur in der Einleitung zum ersten Band der Chrysostomus-Homilien dieser Sammlung bemerkt, „die Übersetzung wohl in erster Linie für solche Geistliche und Studierende bestimmt ist, die etwa aus Zeitmangel sich nicht an den Originaltext halten wollen“ (S. 10). Ob diese Absicht immer erreicht worden ist, mag der geneigte Leser beurteilen.
Prag, am 28. Februar 1918.
Der Übersetzer.
Fußnoten
1. Zahn, Der Brief des hl. Paulus an die Römer, 1910, S. 24.
2. Chr. Baur, S. Jean Chrysostome et ses oeuvres dans l’histoire littéraire. Louvain et Paris 1907.
3. Vgl. ebd. S. 139–182.