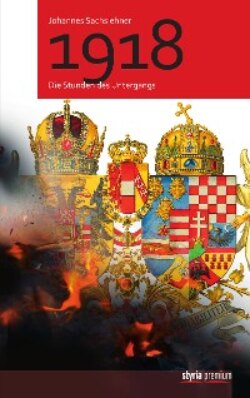Читать книгу 1918 - Johannes Sachslehner - Страница 8
0 UHR
ОглавлениеFelsenfestung Monte Asolone im Monte-Grappa-Massiv, eine Schlüsselstellung der etwa 140 km langen Südwestfront, die von den Bergriesen Südtirols bis zur Mündung des Piave reicht. Seit vier Tagen tobt hier, in einer trostlosen Stein- und Felswüste 1500 Meter über dem Meer, die Schlacht. Gehalten wird dieser Frontabschnitt, der sich weiter westlich durch das tief eingeschnittene Tal der Brenta bis zum Monte Alessi und zu den Linien des VI. Korps fortsetzt, im Osten die ebenso steile Schlucht des Valle Cesilla quert und unterhalb des Monte Pertica an die Stellungen des I. Korps grenzt, vom XXVI. k. u. k. Armeekorps, kommandiert von General der Infanterie Ernst von Horsetzky. Die grauenvolle Zerrissenheit dieser wasserlosen Landschaft soll, so erzählt man sich, bereits Dante Alighieri vor Augen gehabt haben, als er in seiner Divina Commedia den Eingang zum Inferno beschrieb: eine kahle, lebensfeindliche, schwer zugängliche Bergwelt, erreichbar nur über einen Fußsteig, der vom kleinen Dorf Vannini, gelegen am Zusammenfluss von Brenta und Cismon, hier heraufführt. Dreizehnhundert Höhenmeter müssen die Nachschubkolonnen auf diesem bewältigen, auf Schritt und Tritt sind Pferde und Träger dem schweren Feuer des Feindes ausgesetzt, der von seinen höher gelegenen Positionen im Gipfelbereich des Monte Grappa den gesamten Weg einsehen kann und dies gnadenlos nützt – es gibt kaum eine Möglichkeit vom Weg abzuweichen. Am Osthang der engen Cesillaschlucht, die sich vom Hauptgipfel des Gebirgszugs, dem Monte Grappa (1775 m), herabzieht, hat man in halber Höhe einen Saumweg in den Fels gehauen, der zum östlichen Flügel der Stellung führt; auch hier wütet täglich die italienische Artillerie. Die Transporte aus dem Tal müssen dennoch Tag für Tag weitergehen: Allein der Schießbedarf des Korps für einen einzigen Kampftag beträgt 2.200 Tonnen, dazu kommen Lebensmittel, Heiz-, Bau- und Befestigungsmittel. Unter verzweifelter Anstrengung der Seilbahnabteilungen errichtete Seilbahnverbindungen sind im Geschosshagel immer wieder zerfetzt worden, ein Druckpumpenwerk im Brentatal liefert zwar Wasser, aber nie in ausreichendem Maße.
Geradezu komfortabel und hoch technisiert dagegen die Stellungen der Italiener am Monte Grappa, dem höchsten Gipfel im Süden des Massivs, dessen Flanken nach allen Seiten hin steil abfallen und so gut zu verteidigen sind: unterirdische Unterkünfte, eine beschusssichere Wasserleitung, ein Elektrizitätswerk, ein Lazarett und eine gut ausgebaute Zufahrtsstraße, die auch für Lastkraftwagen befahrbar ist. Luigi Cadorna, Oberbefehlshaber des italienischen Heeres bis zur Niederlage von Karfreit im Oktober 1917, hat die Grappa-Position bereits 1916 zur strategisch perfekt gelegenen Auffangstellung ausbauen lassen – eine Vorsichtsmaßnahme, die sich nun, nach dem Zusammenbruch der Isonzo-Front, mehr als bezahlt macht: Der Grappa-Gipfel, die letzte Barriere vor der venetianischen Tiefebene, wird für die k. u. k. Armee zur unüberwindlichen Hürde. Im November 1917 kommt hier der österreichische Vorstoß zum Stehen, der Abwehrsieg am Monte Grappa rettet die Italiener vor dem Aufrollen der gesamten Front am Piave.
Es ist eine empfindlich kühle Herbstnacht, über dem von Granaten zerwühlten Felsenmeer liegt der süßliche Geruch des Todes: Tausende sind hier in den letzten Tagen gestorben – von Kugeln und Splittern durchsiebt. Am Morgen des 24. Oktobers waren elf Divisionen der 4. italienischen Armee von General Gaetano Giardino an der Grappa-Front zum entscheidenden Angriff angetreten, am 25. stand der Feind dreimal am Monte Asolone, dreimal konnte der Gipfel im Gegenangriff wieder zurückerobert werden. Für die Überlebenden des südmährischen Infanterieregiments Nr. 99 ist es jedoch endlich ruhig geworden, in einer Reservestellung haben die abgekämpften Soldaten Gelegenheit etwas Schlaf zu finden. Leutnant Otto Gallian verbringt dennoch eine äußerst unruhige Nacht. Immer wieder läutet das Telefon: Die Bürokraten beim Regimentskommando möchten wissen, wie viel Schuhe seine Leute brauchen, dann wie viel Decken benötigt werden, es folgen lästige Fragen nach Konserven, Mänteln, Kappen und schließlich auch nach der Zahl der notwendigen Unterhosen. Bis der junge Offizier die Geduld verliert, kurz entschlossen sein Messer aus der Tasche zieht und den Telefondraht kappt – die Freude über die so gewonnene Nachtruhe ist jedoch nur kurz: Ein diensteifriger Telefonist taucht in der Dunkelheit auf, drängt darauf, dass er endlich ans Telefon gehen müsse, dem Leutnant bleibt nichts anderes übrig, als den Teufelsdraht mit einem Isolierband wieder zusammenzuflicken.
Leutnant Otto Gallian, der mitten in der Nacht so rücksichtslos schikaniert wird, hat übergenug vom Krieg, aber will nicht aufgeben, denn er ist Soldat mit Leib und Seele und wenn wir bis jetzt durchgehalten haben, so ist es ein Verbrechen, im letzten Augenblick auszuspannen und sich dem Feind auszuliefern. Da heißt es die Zähne zusammenbeißen und durchkämpfen, ob’s einem nun gefällt oder nicht …
Zusammen mit 15 weiteren Infanterieregimentern bilden die 99-er das k. u. k. XXVI. Korps „Asolone“, kommandiert von General der Infanterie Ernst von Horsetzky. Die Zusammensetzung seiner Truppen ist ein Spiegelbild des habsburgischen Vielvölkerstaats: Neben drei von deutschsprachigen Mannschaften dominierten Regimentern zählen dazu jeweils vier ungarische und kroatische Regimenter, drei tschechische, ein ruthenisches und ein bosnisches. Die Situation des Korps „Asolone“ ist kritisch: Nur durch den Einsatz des Geburtsjahrgangs 1899 und von russischen Heimkehrern kann der Stand halbwegs gehalten werden, die Kampfkraft der Mannschaften schätzt der erfahrene Soldat allerdings nicht allzu hoch ein: Sind doch 137 Mann des Bataillons zum ersten Mal an der Front, davon haben 125 noch nicht das 20. Lebensjahr erreicht.
Die tatsächliche, erdrückende Überlegenheit der Alliierten ist den Männern um Otto Gallian in der Kampflinie am Monte Asolone unbekannt: Sie wissen nicht, dass 608 k. u. k. Bataillone und 403.100 Gewehre einer feindlichen Streitmacht von 912 Bataillonen und 670.000 Gewehren gegenüberstehen, dass von den 58 Divisionen an der Südwestfront bereits 19 nur mehr 25 bis 50 Prozent des Sollstandes aufweisen und neun durch die Malaria geschwächt sind – allein im August 1918 verliert die Isonzoarmee 33.000 Mann durch Krankheit, die Tagesabgänge durch Malaria, Ruhr und Grippe bei der Heeresgruppe Boroević steigen bis auf 6.800 Mann. Auch ohne Feindeinwirkung schwindet die Widerstandskraft, der Geist der Truppe ist nicht mehr überall der alte.
Seit dem 17. Oktober ist Otto Gallian wieder bei seinem Bataillon, die zwei Wochen davor hat er auf Fronturlaub in Wien verbracht und hier ein Wiedersehen mit seinem Bruder Karl gefeiert, der aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt ist und nun auf seine Wiedereinberufung wartet. In der Hauptstadt, so hat er feststellen müssen, sieht es traurig aus: Endlose Streiks, eine Unzahl Deserteure. Die Zeitungen, die sich in der Zeit des Glanzes und der Siege nicht genug des Lobes tun konnten, fordern offen zur Revolution auf … Die Behörden kraftlos und schwächlich, die Verhältnisse sind ihnen längst über den Kopf gewachsen. Armes Vaterland!
Der Leutnant erinnert sich an einen Wiener Straßenbahnschaffner, der mit Verwunderung registriert hatte, dass da jemand noch pflichtbewusst an die Front fahre, obwohl ohnehin schon bald alles aus wäre – der gute Mann ahnte nicht, dass für ihn, den Offizier mit Leib und Seele, an die Front fahren so viel wie „nach Hause“ fahren bedeutet. Nur hier, inmitten der Kameraden, fern der zerwühlten und zerrissenen Heimat, fühlt er sich frei und glücklich, die Existenz als Soldat ist ihm zu Sinn und Inhalt des Lebens geworden.
Und während ringsumher eine Welt einstürzt, das alte Donaureich in Trümmer zerberstet, ersteht hier in den blutgetränkten Felsen der Brenta zum letzten Male altösterreichisches Soldatentum in seiner ganzen Größe, geht zum letzten Male durch die Schluchten des Grappa ein Ahnen von Nibelungentreue und Nibelungenlos …
Während sich Leutnant Otto Gallian so beim Abzählen der erforderlichen Unterhosen seine Gedanken über den Krieg macht, sitzt beim Heeresgruppenkommando in Udine der Generalstabschef der Heeresgruppe Boroević, Generalmajor Anton Ritter von Pitreich, die rechte Hand des Feldmarschalls, wie immer noch über seinem Tagebuch. Pitreich, 1870 in Wien als Sohn eines k. u. k. Feldzeugmeisters geboren, hat eine mustergültige Karriere hinter sich: Theresianische Militärakademie und Kriegsschule jeweils mit sehr gutem Erfolg absolviert, die Prüfung zum Major im Generalstab (1907) mit sehr entsprechendem Gesamterfolg. Sein Chef Boroević ist voll des Lobes über ihn: Streng, gerecht, leidenschaftslos, nobel, notiert er im „Vormerkblatt für die Qualifikationsbeschreibung“, militärisch sehr begabt, wissenschaftlich hoch gebildet, in den schwierigsten Situationen ruhig, besonnen, dabei stets initiativ. Den Krieg hat Pitreich, der hervorragend französisch und gut ungarisch spricht, von Anbeginn mitgemacht: 1914 bei der 3. und 5. Armee in Galizien, wo er in den Oktoberkämpfen um Przemyśl erstmals im Feuer stand, später am Isonzo, dabei immer klaren Überblick und volles Verständnis für die Lage bekundet, im kritischen Moment große Ruhe bewahrt. Doch nun gibt sich der erfahrene und hoch dekorierte Generalstäbler, bei dem im Laufe des Tages alle Informationen von den Fronttruppen zusammenlaufen, keinen Illusionen mehr hin: „Am Abend zeigt sich, dass der feindliche Einbruch namentlich von Papadopoli aus nicht unbedenkliche Fortschritte machen konnte. An ein Hinauswerfen des Feindes aus dem Bereich der Isonzoarmee wie auch der 6. Armee ist, bei aller Tapferkeit der noch verfügbaren treuen Truppen, wohl kaum mehr zu denken; die Zahl jener Truppen, welche nicht mehr ganz verlässlich sind, mehrt sich; wo man hinhört, werden neue Gehorsamsverweigerungen bekannt; bis in die späte Nacht hinein laufen hierüber Meldungen ein.
Nur an der Front „frei und glücklich“: Leutnant Otto Gallian – Soldat für den Kaiser und den „Führer“.
Nur die Gebirgsfront hatte sich auch heute wieder brav gehalten; dort ist das zersetzende Gift aus dem Tale noch nicht auf die umkämpften Höhen gelangt. So kommt es zur traurigen Erkenntnis, dass auch der militärische Widerstand hiermit erledigt ist und es jetzt nur mehr darauf ankommt, an die weiteren Konsequenzen der gänzlich verunglückten Politik zu denken. Diesbezüglich zeigt sich, dass die revolutionären Umtriebe im Hinterland immer ärger werden; Nationalräte, -ausschüsse, -garden etc. gemahnen lebhaft an die Ereignisse im Jahre 1848; wir stehen bereits mitten in der Revolution!“
Anton von Pitreich ist einer jener führenden k. u. k. Offiziere, die an der Konstruktion einer österreichischen „Dolchstoßlegende“ arbeiten und schreiben, eigene militärische Versäumnisse und Unzulänglichkeiten, fehlende Vorbereitung, auch unter den zweifellos schweren Umständen, werden in diesen Aufzeichnungen verschwiegen; so hatte Generaloberst Freiherr Wenzel von Wurm, der Kommandant der Isonzoarmee, noch bis zum Abend des 26. Oktober gemeint, dass man es beim Angriff der Alliierten auf die Insel Papadopoli bloß mit einem Ablenkungsmanöver zu tun hätte – und war dann überrascht, als plötzlich wenige Stunden später massiert britische Infanterie über die Insel hinweg angriff.