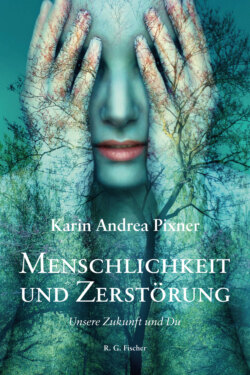Читать книгу Menschlichkeit und Zerstörung - Karin Andrea Pixner - Страница 10
Zerstörung und Destruktivität im persönlichen Leben
ОглавлениеEine der tief traurigen Facetten unseres Mensch-Seins ist, dass wir unter anderem destruktiv, sehr destruktiv sein können.
Ich fragte mich sehr viele Jahre, warum ich manchmal tue, wovon ich weiß, dass es mir nicht gut tut, und warum ich manchmal nicht tue, wovon ich weiß, dass es mir gut tut. »Gut tun« klingt so harmlos. Ich könnte die Frage auch intensivieren und fragen: »Warum tue ich etwas, das meine Gesundheit schädigt? Warum esse ich etwas oder davon zu viel, obwohl ich nun wirklich die Erfahrung gemacht habe, dass es mir danach, sogar Tage danach, schlecht geht? Warum arbeite ich zu viel? Warum gehe ich zu spät ins Bett? Warum räume ich nicht auf?« Diese und mehr Fragen kennen Sie vielleicht auch und auch die sogenannten — ich würde sie so nennen — Pseudo-Antworten: »Weil ich mir mal was gönnen möchte. Weil ich es verdient habe. Weil es nicht anders möglich ist. Weil es Spaß macht. Weil ich ein kreativer Kopf bin …«
Ja, wir können uns Erklärungen zurechtlegen, die den Missstand erklären und vielleicht sogar ein Rechtfertigungs-Empfinden ermöglichen. Wir Menschen sind meisterhaft darin, gute Erklärungen und Geschichten zu finden. Oft finden wir gute Gründe für unser Tun, so dass wir uns auf ungute Weise wieder beruhigen und den Missstand aus unserem Bewusstsein beiseite schieben können.
Von außen, bei anderen, sehen wir eine ungesunde, gar destruktive Lebensweise viel leichter als bei uns.
Hierzu möchte ich Ihnen beispielhaft vier Personen vorstellen. Diese Personen existieren nicht real und ihre Namen sind zufällig gewählt. Jedoch könnten sie real existieren, da ihre Lebensgeschichten und Lebensthemen repräsentativ sind. Ich habe viele Lebensgeschichten und Hintergründe in den folgenden Personen Lukas, Sophie, Markus und Susanne gebündelt. Falls jemand hier seine Geschichte wiederfinden sollte, ist das ein unbeabsichtigter Zufall.
Lukas, 22 Jahre und Student, liebt den Sport, ist gut trainiert. Er hat erfahren, wie gut es ihm tut, früh aufzustehen, sich gleich mal joggend in den Park zu bewegen, dann gut zu frühstücken, dann zu studieren. Wann immer er einen strukturierten Tag hatte, wann immer es ihm gelang, bewältigbare Aufgaben auf eine Liste zu schreiben und diese dann abzuhaken, war er froh und erfüllt. Doch wann immer er viel zu lange in die Nacht hinein Serien schaute, bis mittags schlief, viel zu viel Süßkram aß, keine Struktur im Tag hatte, sich kaum bewegte, ging es ihm schlecht. Er fühlte sich wertlos und unfähig, irgendwas auf die Reihe zu bringen — kurz, er fühlte sich als ein Versager, der immer fauler und dicker wurde.
Sophie, 41 Jahre alt, hat ihre Stellung als Bürokauffrau gekündigt, weil »die viele Arbeit« sie von einem Leben abhielt, in dem sie Zeit für sich haben konnte. Sie sollte sich nun bewerben, verschob dies jedoch jeden Tag aufs Neue. Sie wurde immer unsicherer, gehemmter und auch lethargischer. Ihr Mann versuchte sie zu drängen, endlich wieder etwas zu tun, da mittlerweile auch ihre Partnerschaft unter ihren Stimmungen und Unsicherheiten litt. Nach einem Jahr entwickelte sich das Phänomen, dass, wann immer Sophie sich bewerben wollte, sie entweder einen Unfall oder eine Erkrankung hatte, weswegen das Vorhaben wieder verschoben werden musste. Ihr Mann wird seither mehr und mehr zu einem Krankenpfleger, muss seine Bedürfnisse an Partnerschaft und Lebendigkeit zurückstellen. Sie wird mehr und mehr lebensunfähiger. Das Gegenteil von dem, was sie bezwecken wollte, hat sich entwickelt.
Markus, 53 Jahre, Ingenieur bei einer bekannten Autofirma, begann vor vier Jahren, nach der Trennung von seiner Frau und seinen Kindern, zu trinken. Dies steigerte sich so sehr, dass nun sein Arbeitsplatz gefährdet ist. Doch er kann nicht aufhören. Seit einiger Zeit kommen zusätzliche Verhaltensweisen wie Computer-Spiel-Sucht hinzu. Er weiß, dass dies »alles ein großer Scheiß« ist. Er erzählt Freunden oftmals: »Jetzt hab’ ich es echt kapiert. Ich höre auf mit dem Blödsinn. Ich beginne ein neues Leben.« Er hat schon an die zwanzig Mal aufgehört mit den Verhaltensweisen und immer wieder von Neuem damit begonnen, so dass seine Freunde ihm seine Aussagen nicht mehr glauben können. Er selbst glaubt sie noch, denn sonst wäre er »ja ganz am Arsch, wenn ich sehen würde, dass ich mein Vorhaben gar nicht hinbekommen kann«, wie er auf Nachfrage sagt.
Susanne, 66 Jahre und Rentnerin weiß, dass es ihr nicht gut tut, alle paar Stunden die Nachrichten zu lesen, den Wetterbericht anzuschauen. Doch in dem Corona-Krisen-Jahr 2020 gewöhnte sie sich das an. Eine große Angst erfasste sie im März 2020 — zunächst war es die Angst vor der Erkrankung, dann vor der gesellschaftlich-politisch-wirtschaftlichen Entwicklung und dann ganz allgemein. Sie kaufte ganz viele Nahrungsmittel und stellte sie in den Keller für eine Krisen-Vorratshaltung. Um gut informiert zu sein, um die neuesten Entwicklungen mitzubekommen, um schnell handeln zu können, muss sie nun jede Stunde die News-Ticker lesen. Sie wird dabei immer nervöser und ängstlicher, entwickelte bereits Schlafstörungen und kann von dieser Lebensweise nicht mehr lassen.
Die hier geschilderten Geschichten sind vergleichsweise harmlose Beispiele von destruktiven Kreisläufen, aus denen wir Menschen alleine nicht aussteigen können. Jedoch haben sie das Potenzial, die Gesundheit eines jeden Einzelnen zu zerstören. Sie können das Beziehungsleben und Beziehungsglück mit den Mitmenschen sowie den Lebensverlauf in Richtung Scheitern und Unglück zu wenden. Dementsprechend kann die innewohnende Destruktivität, mit der jeder persönlich umzugehen hat, ebenso übermächtig wirken, wie die Destruktivität, mit der wir global zu tun haben.
Anhand dieser Beispiele ist erahnbar, dass es aktuelle Gründe gibt, warum wir Menschen etwas Destruktives tun und dass es Grundlagen dafür gibt, die in der Vergangenheit liegen:
Lukas war ein zurückhaltender Junge, der sich in der Schule so leicht tat, dass er sich nie dafür anstrengen musste. Seine Eltern, beide berufstätig, waren froh, dass sie sich um Schule und Freunde ihres Sohnes nicht kümmern mussten. So konnten sie ihren sehr arbeitsreichen, karrierebetonten Berufen nachgehen. Lukas war viel alleine. Sein Trost und seine guten Begleiter am Nachmittag waren Süßigkeiten, Computerspiele und diverse Medien. Intensive Aufmerksamkeit bekam er, wenn er seine Eltern durch nicht erledigte Aufgaben enttäuschte. So entwickelte sich in ihm die Überzeugung, dass er enttäuscht, dass er uninteressant sei, dass es sinnlos sei, wenn er Aufgaben erfüllt (weil er dann noch mehr alleine ist, weil dies sowieso niemand bemerkt), dass er anderen nur zur Last falle und es besser wäre, wenn er nicht da sei. Obwohl er nun alleine lebt, einige Freunde und eine Freundin hat, obwohl er sich anders erleben kann durch andere Lebensweisen, trägt er diese Prägung so tief in sich. Er muss nun andere Menschen enttäuschen oder fällt völlig in die Süchte von damals — und er fällt nicht nur, er intensiviert sie.
Sophie fühlte sich von ihren Eltern immer geliebt, obwohl sie nie wirklich sagten: »Wie schön, dass es dich in unserem Leben gibt, Sophie.« Oder: »Wir lieben und wertschätzen dich sehr.« Oder:
»Was ist denn deine Ansicht zu dem Thema…?« Es wurde wenig gesprochen in ihrer Herkunftsfamilie, es wurde nicht nach Ansichten oder Interessen gefragt, eine große Leblosigkeit des Schweigens ummantelte alles, so dass Sophie dachte: »Ich habe eine gute Kindheit. Niemand ist böse zu mir.«
Dass sie ihren Selbstwert nur durch aktive Bestätigung von anderen entwickeln kann, dass sie eine gewisse Autonomie in der Lebensgestaltung nur durch Beziehungserfahrungen mit anderen erwerben kann, das war ihr nicht bekannt. Nie hatte sie dies bewusst vermisst. Die menschlich notwendigen Bedürfnisse nach Gesehen- und Gehört-Werden waren in diesem Ausmaß in ihrer Kindheit abwesend, dass sie das schmerzvolle Vermissen völlig verdrängte. Heute ist ihr nicht bewusst, dass sie diese Bedürfnisse haben könnte.
Markus war der »Sonnyboy« in der Familie. Ein immer lustiger, heiterer Junge, der alle zum Lachen brachte. Enorm leicht kam er durch die Schule, war beliebt, das Studium ging ihm leicht von der Hand. Seine Eltern waren sehr froh um diesen Sohn, denn sie hatten noch einen zweiten Sohn, Martin, mit dem alles so problematisch war. Martin hatte eine schwere Geburt, fand kaum Freunde, tat sich in der Schule aufgrund von Teilleistungsschwächen enorm schwer, brach viele Studiengänge ab, zog sich von der Familie zurück, brach immer wieder den Kontakt ab. Unzählige sorgenvolle Gespräche führten die Eltern über ihren Sohn Martin. Markus saß meistens dabei und hörte der Verzweiflung, der Aussichtslosigkeit und Hilflosigkeit, der entwertenden Wut seiner Eltern zu. Schließlich brachte sich Martin um, was das Herz der Eltern gänzlich in die Verzweiflung und sie in den Alkohol stürzte.
In Markus grub sich das Versprechen tief ein: »Ich mache meinen Eltern keine Sorgen. Ich werde in einem soliden Beruf erfolgreich sein und eine Familie gründen, so dass sie durch mich glücklich werden können.« Als er durch die Trennung von seiner Frau das Familien- und Partnerschafts-Vorhaben scheiterte, riss in Markus das Ausmaß von Versagen auf, das sich durch das schlechte Gewissen seinem Bruder gegenüber, tief unbewusst als Überzeugung einprägte: »Ich bin nicht wirklich besser als mein Bruder, das werde ich irgendwann allen zeigen.«
Susanne hatte Eltern, die den zweiten Weltkrieg als junge Erwachsene erlebt hatten und somit eine ganz andere Wucht an Traumatisierung und Angst in ihren Zellen, ihrem Gehirn und ihrer Seele abbekommen hatten. Ihre Mutter war stets enorm ängstlich, sah hinter jeder Möglichkeit eine Katastrophe aufziehen, die das Leben ihrer Tochter oder das der Familie bedrohen könnte. Ihr Vater war versteinert, sprach wenig, hatte manchmal heftige Wutausbrüche und dominierte die Familie mit einer kurzen, knappen Ansage, die eine Drohung in der Stimme ausdrückte, dass niemand zu widersprechen wagte. Susanne konnte nicht lernen, ihre eigene Meinung zu bilden, sie zu formulieren, sie vor anderen zu vertreten. So konnte sie auch keine eigenen Entscheidungen treffen und sie durchführen, keine eigenen Interessen verfolgen. Sie orientierte sich bis zur Ausbildung an dem, was ihre Eltern als richtig und falsch erachtet hatten. Danach musste sie selbst herausfinden, was richtig war und was falsch — stets im Nacken eine Bedrohung durch das katastrophale und endgültige »Aus«.
Den vier Lebensgeschichten ist gemein, dass es Lebensgeschichten von Im-Stich-Gelassen-Sein, Verlassen-Sein oder Allein-Sein sind. Ich könnte nun die Lebensgeschichten der jeweiligen Eltern erzählen, so dass noch verständlicher wird, warum sie so handelten bzw. nicht handelten, warum sie so waren, wie sie waren. Die Eltern von Lukas z. B. hatten beide wiederum Eltern, die einen Erziehungsstil praktizierten von Härte, Kritik, Leistung. Deswegen entwickelten Lukas Eltern eine Lebensweise von viel, sehr viel arbeiten müssen. Die Eltern von Sophie waren im Krieg als Kinder verschüttet, waren so früh in Lebensbedrohung, dass sie erstarrt waren. Die Eltern von Markus hatten jeweils früh den Vater verloren. Die Mütter mussten mit viel Anstrengung alleine weitermachen. Und von Susanne haben wir schon gelesen. Das erlittene Leid führt unreflektiert dazu, ob wir wollen oder nicht, dass wir anderen oder und uns selbst etwas antun.
Warum ist das so?