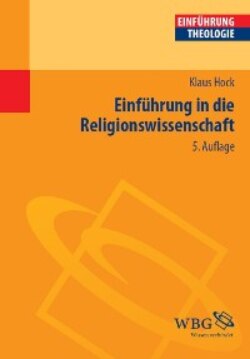Читать книгу Einführung in die Religionswissenschaft - Klaus Hock - Страница 11
3. Religionsgeschichte und Sprache
ОглавлениеDie Religionswissenschaft, zumal die Religionsgeschichte, hat es häufig mit literarischen Quellen zu tun, die zumeist in fremden Sprachen verfasst sind – gleich, ob es sich dabei um historische Schriften aus längst vergangenen Zeiten oder um zeitgenössische Texte aus weit entfernten Regionen der Welt handelt. Religionsgeschichtliche Arbeit ist oft harte philologische Arbeit, und wer fundiert Religionswissenschaft betreiben will, sollte zumindest eine Religion in ihren Originalquellen studieren können.
die Arbeit mit Übersetzungen
Selbstverständlich wird niemand ganz ohne die Hilfe von Übersetzungen auskommen; doch diesen – oftmals durchaus ausgezeichneten – Übersetzungen wird der Religionsforscher, wird die Religionsforscherin ein gesundes Misstrauen entgegenbringen müssen. Übersetzungen sind ja immer auch Interpretationen, und als solche wirken sie nicht selten verzerrend und suggerieren weitergehende, womöglich sachfremde und religionsgeschichtlich problematische Assoziationen. Dies trifft insbesondere für solche Texte zu, bei denen bereits das Original mehrere Deutungen offen lässt. Ein Beispiel hierfür wäre die Sure 96:3–4 aus dem Koran, wo im Zusammenhang mit der Erschaffung des Menschen Aussagen über Gott gemacht werden. In der Übersetzung von A. Th. Khoury heißt es hier: „Der Herr ist der Edelmütigste, der durch das Schreibrohr gelehrt hat …“. Max Henning hingegen hatte übersetzt: „der die Feder gelehrt …“. Rudi Paret wiederum führt in seiner – für wissenschaftliche Zwecke nach wie vor zuverlässigsten deutschen – Übersetzung alternative Möglichkeiten an: „… der den Gebrauch des Schreibrohrs gelehrt hat (oder: der durch das Schreibrohr gelehrt hat) …“. Ein weiterer Nachteil der Arbeit mit Übersetzungen liegt darin, dass oftmals die im Original verwendeten Begriffe nicht durchweg mit demselben deutschen Wort wiedergegeben werden (können). Wenn wir etwa zwei jüngere Übersetzungen der Bhagavadgita – die von Klaus Mylius und die von Peter Schreiner – nebeneinander legen, wird deutlich, wie grundsätzlich Wortwahl und Terminologie voneinander abweichen.
die philologische Erschließung der Bedeutung religiöser Schlüsselbegriffe
Die Bedeutung der sprachlichen Entschlüsselung religionsgeschichtlicher Quellen geht aber noch weiter. Nicht nur auf die Überprüfung von Übersetzungen auf ihre „Richtigkeit“ kommt es an, sondern auf das Erfassen der Tiefendimension religiöser Termini technici. Davon sind nicht bloß zentrale Kategorien wie religio, dîn, dharma oder dao betroffen; auch religiöse Konzeptionen wie das islamische shirk („Polytheismus“), das hinduistische advaita („Nicht-Dualität“), das buddhistische dhyana („Meditation“) oder das polynesische tapu („Verboten“), Titel wie Messias („Gesalbter“), Mahdi („Rechtgeleiteter“), Kundun (Ehrentitel des Dalai Lama) oder Arhat („Heiliger“) sowie weniger prominente Namen und Begriffe sollten möglichst genau philologisch erschlossen werden. Dies garantiert nicht nur eine größere Exaktheit der religionsgeschichtlichen Arbeit, sondern eröffnet der religionsgeschichtlichen Interpretation weitere Verstehenshorizonte: Wer weiß, dass das arabische tawaffâ, wörtlich „abberufen“, in einigen koranischen Passagen auch als Umschreibung für „sterben“ gebraucht wird, kann die bis in die Gegenwart andauernde inner-islamische Debatte über den Tod und die Wiederkehr Jesu mit anderen Augen „lesen“; und wer mit den vielfältigen Implikationen des japanischen Wortes kami und seines Begriffsfeldes vertraut ist, wird die Übersetzung mit „Götter“ stets in dicke Anführungsstriche setzen – oder den Begriff besser gleich unübersetzt lassen.
Wichtiger noch ist jedoch, dass jede Sprache bestimmte Strukturen bereitstellt, an die religiöse Ausdrucksformen und Vorstellungsweisen – ja gar die Grundzüge von Weltbildern gebunden sind. Ein bekanntes Beispiel aus der christlichen Theologiegeschichte wären die Missverständnisse zwischen Griechisch und Lateinisch sprechenden Gelehrten beim Streit um die richtige Formulierung der christlichen Trinitätslehre: Während die einen keine Schwierigkeiten damit hatten, im Blick auf die Wesensgleichheit der drei göttlichen Personen von una substantia und tres personae zu sprechen, fiel es den anderen recht schwer, die Rede von den drei Hypostasen (hypóstasis) und der einen ousía zu akzeptieren. Ein weiteres Beispiel wäre die Besonderheit der semitischen Sprachen, differenzierte Beziehungen zwischen zwei handelnden Größen zu beschreiben, die über eine strikte Trennung in aktives Subjekt und passives Objekt hinausgehen: Wenn mehrfach in der Tora bzw. dem Alten Testament die Rede davon ist, dass Gott Israel aus Ägypten „herausgeführt“ hat, so ist dies meist im Verbstamm des Hiphil ausgedrückt und bedeutet wörtlich: Gott hat „gemacht, dass Israel aus Ägypten heraufgeht …“.
Zusammenhang von Sprache und Religion
Wie eng der Zusammenhang zwischen Sprache und Religion ist, wird daraus ersichtlich, dass einschneidende religiöse Wandlungsprozesse oft mit einem Bedeutungswandel der Sprache verbunden waren bzw. auf die Entwicklung der Sprache selbst einschneidenden Einfluss hatten: Der Koran wurde zu dem großen Sprachregler des Arabischen, und Luthers Bibelübersetzung legte den Grundstein zur Vereinheitlichung des Deutschen; der Protest des Buddhismus gegen die Vorherrschaft der Brahmanen richtete sich auch gegen das Monopol des Sanskrit als alleiniger Ritualsprache; und durch die Identifikation der Bezeichnung des christlichen oder des islamischen Gottes mit dem Namen des afrikanischen Gottes ergeben sich im afrikanischen Christentum bzw. im afrikanischen Islam bedeutsame inhaltliche Veränderungen gegenüber dem in europäischen bzw. arabischen Ländern gepflegten Gottesglauben.
Selbstverständlich geht Religionsforschung nicht in Philologie auf, und die Zeiten, als Religionsgeschichte sich vornehmlich auf die sprachliche Erschließung historischer Texte der Religionen des Altertums konzentrierte, sind lange vorbei. Dennoch nimmt die Philologie nach wie vor eine herausragende Stellung unter den religionsgeschichtlichen Hilfswissenschaften ein, zumal sie als Geburtshelferin der Religionswissenschaft die Emanzipation der jungen Disziplin von der Theologie förderte und sicherte. Ihre grundlegende Bedeutung ist dabei nicht auf die historische Religionsforschung begrenzt – zum einen, weil sich gegenwartsbezogene Religionsforschung gar nicht ohne Berücksichtigung der Vorgeschichte des Untersuchten betreiben lässt, zum anderen, weil auch und gerade aktuelle religionswissenschaftliche Fragestellungen nach einer philologisch untermauerten Analyse verlangen. Wenn ich z.B. die zeitgenössische Verwendung theologischer Termini technici durch Hausa oder Swahili sprechende Christinnen und Christen untersuche, komme ich nicht umhin, nach der exakten Herkunft der einzelnen Begriffe zu fragen und gegebenenfalls ihren arabischislamischen oder traditionell-afrikanischen Hintergrund zu analysieren: Was ist je assoziiert, wenn Hausasprachige Kirchen einmal von Gott als ubangiji, ein andermal als allah sprechen; und was bedeutet es, wenn christliche Theologie als ilmu tawhidi – vom Arabischen ‘ilm attawhîd, wörtlich: „Wissenschaft von der Einheit (Gottes)“ – bezeichnet wird?
Weitere Hilfswissenschaften
Neben der Philologie sind auch noch viele andere Disziplinen für die religionsgeschichtliche Arbeit als Hilfswissenschaften heranzuziehen. Doch die Bemühungen der Religionsforschung gehen selbst darüber hinaus. Bereits Günter Lanczkowski hat in seiner Einführung in die Religionswissenschaft unter Hinweis auf Heinrich Frick die Notwendigkeit unterstrichen, „dass sich der Religionsforscher … vertraut mache mit dem sachgemäßen Milieu“ (12: 43). Martin Greschat geht noch einen Schritt weiter und fordert von Forschenden in Sachen Religion, nicht alleine an Texten zu „kleben“, sondern Bilder, Handlungen, Klänge, ja selbst Geschmack und Gerüche wahrzunehmen, um buchstäblich mit Leib und Seele Religionsforschung zu betreiben: „Alle unsere Sinne sollten wir nutzen, weil auch die fremden Gläubigen, um fromm zu sein, keinen ihrer Sinne verstopfen“ (11: 62). In der Tat: religionsgeschichtliche Quellen bestehen nicht nur aus Texten.