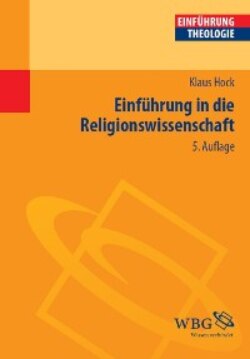Читать книгу Einführung in die Religionswissenschaft - Klaus Hock - Страница 18
b) Faktoren religiösen Wandels
ОглавлениеDie religionsgeschichtliche Forschung im engeren Sinne ist insbesondere am Wandel der Religionen interessiert. Um ihn angemessen zu beschreiben, muss sie zunächst danach fragen, welche Faktoren dafür verantwortlich sind. Religionswandel ist allerdings kein isoliertes Phänomen, sondern Teil des allgemeinen geschichtlichen Wandels. Es gibt also äußerst vielfältige Ursachen des Religionswandels. Dabei ist es hilfreich, diese Ursachen zu klassifizieren, in verschiedene Gruppen einzuteilen. Üblich ist die Unterscheidung von endogenen, internen und exogenen, externen Faktoren. Der Religionswissenschaftler Günter Lanczkowski hat diese Unterscheidung im Sinne von inneren als „religiösen“ und äußeren als „nichtreligiösen“ Ursachen auf die Religionen selbst bezogen (12: 53). In der hier verwendeten Bedeutung allerdings werden diese Begriffe etwas weiter gefasst, indem das Umfeld der Religionen mit berücksichtigt ist: Endogene Faktoren sind „hausgemachte“ Ursachen des Religionswandels, die innerhalb des jeweiligen kulturellen Kontextes wirken, in dem eine Religion beheimatet ist; exogene Faktoren wirken von außen her darauf ein. In beiden Gruppen lässt sich dann nochmals unterscheiden zwischen „religiösen“ Faktoren im engeren Sinne und „kontextuellen“ Faktoren, also solchen, die Auswirkungen nichtreligiöser Bedingungen auf die Religion bzw. die Religionen beschreiben. Das alles sind natürlich recht künstliche Unterscheidungen; in der Praxis bedingen sich die Ursachen des Religionswandels in mannigfaltiger Form und sind vielfach ineinander verwoben.
Religionswandel durch endogene Faktoren religiöser Art
Bei internen Faktoren religiöser Art haben wir es mit Umbrüchen in der Religion selbst zu tun. Diese Umbrüche können von verschiedenen Teilgebieten der Religion ihren Ausgang nehmen – der Lehre, der kultischen Praxis, der Ethik usw. –, erfassen dann aber recht bald die Religion insgesamt und strahlen selbstverständlich auch auf andere Bereiche der Kultur aus.
Beispiele hierfür finden sich zu Genüge an den „Bruchstellen“ der Religionsgeschichte, wo es zur Entstehung neuer Religionen oder religiöser Bewegungen gekommen ist (Islam, Buddhismus, Bahâ’î, aber auch Protestantismus, das Aufkommen der islamischen Mystik oder die Entstehung des Kimbanguismus). So hat beispielsweise die Lehre des Buddha im Verbund mit den gegen das Establishment der Brahmanen gerichteten sog. „asketischen Protestbewegungen“ auch zu massiven Veränderungen im Sozialsystem geführt: An die Stelle der Abhängigkeit vom priesterlichen Opferritual trat die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen, was wiederum die Verbreitung veränderter Wirtschaftsformen und den Aufstieg neuer sozialer Schichten (Händler) begünstigte. Auf den Zusammenhang zwischen protestantischer Ethik und Kapitalismus ist insbesondere vom Soziologen Max Weber hingewiesen worden.
Personen und Gruppen als Agenten religiösen Wandels
Auch Personen sind ein bedeutsamer interner Faktor religiöser Art, vielleicht der wichtigste. Wir haben es hierbei gleichermaßen mit individuellen Gestalten als auch mit kollektiven Trägergruppen als Agenten des Religionswandels zu tun. Beispielsweise gab und gibt es unzählige afrikanische Propheten, aber nur herausragende Persönlichkeiten wie Simon Kimbangu (1889–1951), Isaiah Shembe (1870–1935) oder William Wade Harris (1860–1929) konnten eine Bewegung begründen, die nicht nur kurzfristig existierte, sondern sich erfolgreich zu etablieren vermochte. Gleiches gilt selbstverständlich für die bekannten Stifterfiguren der großen Religionen. Doch diese wie jene hätten wenig bewirken können, wären sie bzw. ihre Sache nicht gleichermaßen durch ihre Anhängerschaft getragen und in einem bestimmten Umfeld zur Wirkung gebracht worden: Beispielsweise hatten die Kimbanguisten Simon Kimbangu nicht nur zu seinen Lebzeiten und auf dem Höhepunkt seines Wirkens als Prophet anerkannt, sondern hielten ihm die Treue auch und gerade dann, als er gescheitert zu sein schien. Die Anfänge des Christentums wären ein analoges Beispiel.
religiöser Wandel durch Traditionskritik
Die aus den eigenen religiösen Traditionen erwachsenden Veränderungen können unterschiedlichen Charakter tragen. Die Kritik an der überkommenen Religion, ja überhaupt Traditionskritik aus der eigenen Religion heraus, ist nicht selten mit Prozessen der Emanzipation von herkömmlichen Glaubensformen, Praktiken oder Organisationsstrukturen verbunden. Dabei kann es durchaus geschehen, dass auf ältere, „ursprünglichere“, vermeintlich „reinere“ Phasen der religionsgeschichtlichen Entwicklung zurückgegriffen wird, um diese Emanzipationsprozesse zu legitimieren. Dieses Muster findet sich in fast allen großen religiösen Reformbewegungen und spiegelt sich ja schon im Begriff selbst wider (re-formare). Das Motto ad fontes – „zu den Quellen!“ ist nicht auf die europäische Religionsgeschichte beschränkt. So haben beispielsweise reformorientierte Muslime bestimmte Entwicklungen der islamischen Geschichte als bida’ (sg.: bid’a) – illegitime „Neuerungen“ – kritisiert und im Kontrast hierzu ihre Programme entwickelt, die beanspruchen, sich unmittelbar an der authentischen Botschaft – dem Koran und der Sunna des Propheten – zu orientieren; und die sog. „alt-buddhistische Gemeinde“, 1921 von Georg Grimm (1868–1945) begründet, beansprucht, den Kern der durch die Tradition verfälschten, ursprünglichen Lehre des Buddha wieder entdeckt zu haben.
Wandlungsprozesse können auch durch Religions- und Traditionskritik ausgelöst werden, die zwar nicht aus der jeweiligen religiösen Tradition selbst stammen, aber in ihrem kulturellen Umfeld entstanden sind. Zum Teil stehen sie deshalb zumindest indirekt im religionsgeschichtlichen Kontext der überkommenen Religion, zum Teil speisen sie sich allerdings auch aus Quellen anderer geistesgeschichtlicher Herkunft, zum Teil haben sie eine nicht- oder gar antireligiöse, oft aber eine ideologische Stoßrichtung. Typische Beispiele für diese Faktoren des religiösen Wandels sind die großen ideologischen Entwürfe des 19. und 20. Jahrhunderts – vom Marxismus mit seiner expliziten Religionskritik über den Liberalismus bis hin zu einem nicht selten quasireligiösen Nationalismus. Die von diesen Strömungen ausgehenden Anstöße wurden in den Religionen selbst teilweise aufgenommen und, wo nicht zurückgewiesen, modifiziert: So gingen in vielen Ländern Osteuropas die orthodoxen Kirchen eine enge Symbiose mit den jeweiligen Nationalismen ein, im Islam wurden Entwürfe eines „islamischen Sozialismus“ erarbeitet und umzusetzen versucht, oder Teile des nordamerikanischen Protestantismus verschrieben sich einem enthusiastisch propagierten Wirtschaftsliberalismus. Ein besonderes Muster des Umgangs mit religionsgeschichtlichen Wandlungsprozessen liegt dort vor, wo versucht wurde, die Religionskritik durch die Integration in das eigene System zu überwinden, so beispielsweise in der Theologie des wohl berühmtesten protestantischen Theologen des 20.Jahrhunderts, Karl Barth (1886–1968), der die Religion als „Unglaube“ und „eine Angelegenheit, man muß geradezu sagen: die Angelegenheit des gottlosen Menschen“ (193: Bd. I,2: 327) bezeichnete und ihr den (christlichen) Glauben als Antwort auf den Einbruch der göttlichen Offenbarung gegenüberstellte. Im japanischen Denken finden sich vergleichbare Ansätze, bisweilen inspiriert durch Karl Barth.
Religionswandel durch endogene Faktoren kontextueller Art
Interne Faktoren kontextueller Art für den religiösen Wandel gibt es in großer Zahl. Hier seien nur die gewichtigsten genannt.
Veränderungen im Bereich der Wirtschaft können einen tiefgreifenden religiösen Wandel nach sich ziehen. Wir wissen beispielsweise, dass der Übergang von der (halb-)nomadischen zur agrarischen Wirtschaftsform einschneidende Veränderungen der altisraelitischen Religion nach sich gezogen hat: Der neue Jahresrhythmus bringt einen veränderten Festkalender mit sich, im Ackerbau verankerte religiöse Praktiken werden – wo nicht abgelehnt – integriert, der „mitziehende“ Gott übernimmt neue Verantwortungsbereiche etc.
Auch technologischer Wandel löst Veränderungen im Bereich der Religionen aus: Wer will, kann sich etwa die Unterstützung eines in Paris lebenden machtvollen nganga (religiöser Experte, „Medizinmann“) „per Korrespondenz“ nach Kinshasa holen, oder bei der dortigen Radio-Kirche um Fürbitte nachsuchen; Videorecorder und Satellitenfernseher bringen den Imam aus der Türkei ins Berliner Wohnzimmer, und seelsorgerlichen Beistand kann ich über das Internet abrufen.
Religionswandel ergibt sich auch aus Veränderungen in der sozialen Struktur der Gesellschaft. Diese fallen oft, aber nicht immer, mit wirtschaftlichen Wandlungsprozessen zusammen. So hat beispielsweise in vielen Regionen Afrikas das Aufkommen neuer religiöser Eliten die Autorität der traditionellen religiösen Experten unterminiert: Modern gebildete islamische Intellektuelle verdrängen die alte Gelehrtenschicht der ‘ulamâ’, und das komplexe Amt des nganga ist auf eine Vielzahl von Spezialisten übertragen, die nur noch für einzelne Aspekte des einst umfassenden Arbeitsfeldes zuständig sind.
Auch politische Veränderungen können zu religiösem Wandel führen: Beispielsweise hat die Anerkennung des Christentums als religio licita, als „erlaubte Religion“, innerhalb kurzer Zeit deutlich erkennbare Auswirkungen auf die Kirche, Theologie und Ethik gehabt; und in der Frühphase des Islams hat die politische Integration der in Medina lebenden Gruppen in ein neu entstehendes Gemeinwesen den Charakter der islamischen Gemeinschaft nicht unerheblich verändert.
religiöser Wandel durch exogene Faktoren
Mit externen Faktoren religiöser Wandlungsprozesse haben wir dort zu tun, wo unterschiedliche Religionen und Kulturen aufeinander treffen. Zu früheren Zeiten schienen religiös-kulturelle Traditionen in relativer Homogenität und Isolation nebeneinander zu bestehen, so z.B. als „christliches Abendland“ und „islamischer Orient“. Auch ethnische Religionen sind deutlich voneinander abgegrenzt. Von daher ist zu erwarten, dass sich Einflüsse von außen bei den genannten Beispielen recht gut aufzeigen lassen. Doch Vorsicht: Homogenität, Isolation und Abgrenzung sind relative Größen, und die Wirkung externer Faktoren betrifft vielfach nicht den gesamten vermeintlichen religiös-kulturellen Komplex, sondern nur einzelne Bereiche. Beispielsweise hat der Rosenkranz aus dem Islam (und vermutlich ursprünglich aus Indien) nur ins katholische Christentum Eingang gefunden. Umgekehrt geht das Minarett auf das Vorbild der Kirchtürme zurück und ist im Islam weit, aber nicht überall, verbreitet – die Moscheen der Ibaditen sind ohne Minarett. In manchen afrikanischen Religionen gehören die religiösen Experten nicht der eigenen Gruppe an, sondern kommen von einer benachbarten Ethnie oder bilden gar einen „transethnischen“ Stand, d.h. sie stehen jenseits der strikten Zugehörigkeit zu einer einzigen Gruppe (so z.B. in manchen Regionen, insbesondere in Westafrika, die Schmiede, die als solche religiöse Experten tätig sind).
Besonders bedeutsam sind externe Faktoren dort, wo Religionen aktiv aufeinander einwirken, vor allem, wenn sie in verschiedenen kulturellen Kontexten beheimatet sind.
Die eindrücklichsten Beispiele hierfür sind sicherlich die neuzeitliche Missionsbewegung und der europäische Kolonialismus. Beide waren eng aufeinander bezogen und ineinander verwoben, sollten aber doch unterschieden werden, alleine schon um ihre durchaus unterschiedlichen Interessen zu berücksichtigen und um die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Mission, Kolonialismus und missionierter bzw. kolonisierter Religion und Kultur in den Blick zu bekommen.
Auch die Expansion des Islams im ersten Jahrhundert der islamischen Geschichte bietet Beispiele für die Bedeutung externer Faktoren religiöser Wandlungsprozesse: Den christlichen Kirchen stand zwar aufgrund ihres rechtlichen Status einer anerkannten religiösen Minderheit eine gewisse Autonomie zu, doch haben sie sich unter dem Einfluss ihrer islamischen Umwelt im Laufe der Zeit nicht unerheblich gewandelt und in Theologie, Frömmigkeitspraxis, Ethik usw. eine andere Entwicklung eingeschlagen als ihre Geschwisterkirchen in nicht islamisierten Regionen.
Zusammenhang von religiösen und nicht-religiösen Aspekten
Beide genannten Beispiele zeigen indirekt, wie bei den externen Faktoren religiösen Wandels religiöse und nichtreligiöse Aspekte ineinander fließen: Die Festschreibung des rechtlichen Status’ der christlichen Kirchen hat religiöse Wurzeln, und christliche Mission wäre in manchen Gebieten, so etwa in den Kernlanden des Islam, ohne die koloniale Intervention und Protektion gar nicht möglich gewesen; beide Beispiele zeigen aber zugleich, wie religiöse und nicht-religiöse Aspekte auch bei der Kategorie der externen Faktoren unterscheidbar bleiben: Der genannte rechtliche Status für die Christen „neutralisierte“ in gewisser Weise den islamischen Bekehrungseifer, und aus der Kolonisierung ergibt sich nicht zwingend die Christianisierung qua Mission – ganz im Gegenteil war in manchen islamischen Regionen eine aktive Missionstätigkeit untersagt, da die Kolonialbeamten um „Ruhe und Ordnung“ in den betreffenden Gebieten fürchteten.
Unberührt davon bleibt, dass externe Faktoren bei den Anhängern der betroffenen Religionen durchaus unterschiedliche Reaktionen hervorrufen konnten und somit auch verschiedene religiöse Wandlungsprozesse nach sich zogen. Eine Reaktion konnte darin bestehen, sich zurückzuziehen und von der Umwelt abzukapseln; das Judentum zur Zeit des babylonischen Exils wäre ein Beispiel hierfür, oder auch viele muslimische Gemeinschaften in manchen kolonisierten Regionen. Eine andere mögliche Reaktion war aber auch, sich gegenüber den externen Einflüssen zu öffnen, wie z.B. einige muslimische oder hinduistische Reformbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Abkapslung und Öffnung konnten dabei unterschiedliche Grade der Intensität annehmen – von der Isolation über den begrenzten Austausch bis hin zu einer vollständigen Offenheit.