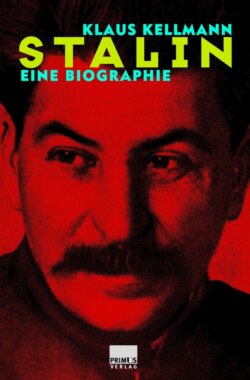Читать книгу Stalin - Klaus Kellmann - Страница 15
Der Volkskommissar
ОглавлениеDie Eisenbahner streikten noch in der ersten Nacht. Die Drucker folgten. Sie verwahrten sich gegen die Zensur und die Schließung oppositioneller und bürgerlicher Zeitungen. Die Beamten in Petersburg und Moskau verweigerten den Dienst, die Angestellten zahlreicher Behörden und Ämter schlossen sich ihnen an. Die Lehrer, Ingenieure, Ärzte und Professoren protestierten auf das Schärfste, und alle vereinigten sich in der Forderung nach einer Regierung aus allen Parteien, mit, aber nicht nur von den Bolschewisten gebildet.
Diese saßen insofern in der Falle, als sie Kerenski immer wieder vorgeworfen hatten, die Einberufung der Verfassunggebenden Versammlung nur deshalb zu verschleppen, um den revolutionären Umbruch zu verhindern. Jetzt waren sie im Wort. Schon ihre erste, noch am frühen Morgen des 26. Oktober veröffentlichte Erklärung enthielt deshalb das Versprechen, die hierfür erforderlichen Wahlen umgehend anzuberaumen, obwohl es nicht den geringsten Zweifel daran gab, dass sich der Ruf „Alle Macht den Räten“ und der parlamentarische Auftrag der Konstituante zueinander verhielten wie Feuer und Wasser.
Die Wahlen begannen am 12. November und zogen sich in der Weite des russischen Raumes bis zum Ende des Monats hin. Sie waren der erste, letzte und einzige demokratische Urnengang für die nächsten 75 Jahre, und sie brachten den Bolschewisten eine vernichtende Niederlage. Von den 703 Sitzen, die die Versammlung auf sich vereinigte, erhielten sie ganze 168, die Sozialrevolutionäre als der erklärte Sieger hingegen 380. Schnelles Handeln war geboten. Als die Delegierten am 5. Januar 1918 im Taurischen Palais zusammentraten, ergriff ein Vertrauter Lenins das Wort, erklärte Russland zur Räterepublik und die Verhandlungen damit für definitiv abgeschlossen. Das erste und einzige frei gewählte Parlament hatte somit ganze 24 Stunden amtiert. Lenin äußerte zu seiner restlosen Zufriedenheit: „Die Auflösung der Konstituante bedeutet die vollständige und offene Liquidation der Idee der Demokratie zu Gunsten des Gedankens der Diktatur. Es wird eine heilsame Lehre sein.“1 In Windeseile wurde jetzt der dritte Allrussische Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte einberufen, mit der zentralen Maßgabe, der Auflösung der Verfassunggebenden Versammlung den ‚Segen des Volkes‘ zu geben. Dieser trat nur fünf Tage später zusammen, legitimierte den zweiten faktischen Staatsstreich und verabschiedete die Verfassung der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik, wie sie von nun an hieß. Nach ihr durften nur noch diejenigen Menschen wählen, „die ihren Lebensunterhalt aus produktiver und gesellschaftlich nützlicher Arbeit“2 bestritten, weshalb Kaufleute, Unternehmer, Spekulanten, Priester und andere ausgeschlossen waren. Überhaupt verkündete der Kongress als seine „Hauptaufgabe (…), jede Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu beseitigen“.3 Das Ministerkabinett, nunmehr „Rat der Volkskommissare“, wurde formell bestätigt und seine Verantwortlichkeit gegenüber dem Sowjet festgelegt, mithin: aus den revolutionären Instanzen waren Staatsorgane geworden.
Gleichzeitig inszenierte man eine kommunistische Umerziehungsdiktatur, die in der Geschichte ihresgleichen sucht. Sie kannte nur ein Instrument, das sich ursächlich deshalb nicht mit dem Namen Stalins, sondern mit der Signatur und Handschrift Lenins verbindet, und dieses hieß Terror. Schon im Dezember 1917 forderte er in einem internen Memorandum die „Säuberung der russischen Erde von allem Ungeziefer“4, wozu er ein Spektrum von beachtlicher gesellschaftlicher Breite rechnete: Adlige, Kapitalisten, Reiche, Konterrevolutionäre, Kulaken, Weißgardisten. Sie alle waren „Volksfeinde“. Seine Skala der Maßnahmen und Methoden, mit denen ihnen gegenüber vorzugehen sei, reichte von der demütigenden Reinigung öffentlicher Klosetts bis zur standrechtlichen Erschießung. Im Grunde genommen war damit der Bürgerkrieg als direkte und gewollte Folge der Revolution eröffnet. Die allmächtigen Disziplinierungs- und Unterwerfungsmittel der neuen Herren hießen Arbeitspflicht, Brotkarte und Getreidemonopol, und der jeden geringsten Widerstand bereits im Keim erstickende Kampfbegriff hieß Sabotage. Nicht zufällig wurde die neue, parteieigene Geheimpolizei „Außerordentliche Kommission zur Bekämpfung der Konterrevolution und Sabotage“ genannt. Dieser berühmt-berüchtigten Tscheka stand der gebürtige Pole Felix Dserschinski vor, der sein bisheriges Leben zumeist im Gefängnis oder in Sibirien verbracht hatte. Er rief auf einer der ersten Sitzungen des Rates der Volkskommissare aus: „Wir haben jetzt keine Gerechtigkeit zu üben. Wir sind im Krieg (…)“5
Der Frieden von Brest-Litowsk
Währenddessen trieb der andere, der auswärtige Krieg mit Deutschland unausweichlich seiner Entscheidung zu. Ein „Frieden ohne Kontributionen und Annexionen“ hatte schon zu Lenins Aprilthesen gehört, wie ja überhaupt die Waffenruhe an der Ostfront die zentrale historische Mission war, die der Kaiser in Berlin ihm zugedacht hatte. Nur dass sich für Lenin der Übergang zum Frieden mit dem sofortigen Ausbruch der Weltrevolution verbinden sollte, was in Deutschland aber noch auf sich warten ließ. Da die russische Armee jedoch gleichzeitig in den Zustand der offenen Auflösung geriet, waren es jetzt die Bolschewisten, die sich die Pistole auf die Brust gesetzt sahen.
Am 9. Dezember 1917 begannen die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk. Von Seiten der Mittelmächte wurde nicht weniger als der Verzicht auf alle nichtrussischen Gebiete verlangt, die das Zarenreich sich nach und nach angeeignet hatte. Abzutreten waren mithin Polen, Finnland, Litauen und weitere Teile des Baltikums. Im Süden forderten die kaukasischen Völker ihre Freiheit. Als dann noch eine ukrainische Delegation in der Stadt erschien, die die (wenig später proklamierte) Unabhängigkeit ihres Landes forderte, war die Einschrumpfung des neuen Sowjetstaates auf das Gebiet des Großfürstentums Moskau vor den Tagen Iwans des Schrecklichen perfekt. Lenins Jünger verließen unter wütenden Protesten Brest-Litowsk, woraufhin die deutschen und österreichischen Truppen das Feuer an praktisch allen Abschnitten der Ostfront wieder eröffneten. Sie stießen tief in die Ukraine hinein, besetzten am 1. März 1918 Kiew, drangen von dort über die Krim bis in den Nordkaukasus vor und schützten die Ukraine vor dem bolschewistischen Zugriff. Im Norden arbeitete man sich fast im Laufschritt über Riga und Pleskau bis vor die Tore von Petersburg vor. Am 2. März fielen deutsche Bomben auf die Stadt.
Im Rat der Volkskommissare herrschte helle Aufregung, wenn nicht Verzweiflung, und der noch im selben Monat gefasste Beschluss, die Hauptstadt Russlands nach 200-jähriger Unterbrechung wieder nach Moskau zu verlegen, war aus der schieren Not geboren. Lenin erklärte unmissverständlich, dass das „Spiel mit revolutionären Phrasen“6 ein Ende haben müsse und ließ den Diktatfrieden am 3. März unterzeichnen. Im Zentralkomitee hatte er sich mit der denkbar knappen Mehrheit von sieben zu sechs Stimmen durchgesetzt.
Der Vertrag von Brest-Litowsk kam einer national-russischen Katastrophe gleich. Alle Kornkammern und die meisten Kohle- und Rohstoffreservoire waren verloren. Lenin selbst scheute sich nicht, das Dokument dem Frieden von Tilsit an die Seite zu stellen, mit dem Napoleon 1807 die Preußen nach den vernichtenden Niederlagen von Jena und Auerstätt gedemütigt hatte. Jetzt, mit dem Rücken zur Wand, wurde auf dem VII. Parteitag auch die letzte und endgültige Trennung von Sozialisten und Sozialdemokraten vollzogen. Zwar hatte man sich seit dem Krakauer Kongress von 1912 immer offener als eigenständige Partei und Organisation bezeichnet, formell aber am Namen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands festgehalten, ihn allerdings immer häufiger mit dem Klammerzusatz „Bolschewisten“ ergänzt. Ab sofort nannte man sich offiziell Kommunistische Partei Russlands, doch ganz so, als ob noch immer von anderen Revolutionssachwaltern zu unterscheiden sei, wurde an dem Klammerzusatz festgehalten. Unmittelbar danach zog die Führungskamarilla von der Newa an die Moskwa. Felix Dserschinski nahm Quartier in der Lubjanka-Straße Nr. 22, einer Adresse, die bald zum Synonym für Folter werden und der nur noch das Gestapo-Verlies in der Berliner Prinz-Albrecht-Straße den Rang ablaufen sollte. Lenin ging in den Kreml.
Stalin, der frischgebackene Volkskommissar für Nationalitätenfragen, erhielt für die Eisenbahnfahrt von der alten in die neue Hauptstadt eines der wenigen Schlafwagenabteile zugewiesen, in das er seine erst 17-jährige Sekretärin Nadjeschda Allilujewa mitnahm. Stalin kannte die Familie schon aus den Tifliser Jahren, wo ihr Vater in der sozialdemokratischen Bewegung engagiert war. Im Schlafwagen soll er dem Mädchen gegenüber zudringlich geworden sein, woraus die Klatschküchen der Partei schnell eine vollzogene Vergewaltigung machten. Was auch immer sich damals ereignet hat: Ein Jahr später und im vierten Monat schwanger heiratete Nadjeschda den zwanzig Jahre älteren Mann, eine Ehe, die in einer Tragödie enden sollte.
Der Bürgerkrieg
Krieg, Bürgerkrieg und Kriegskommunismus, die Verteidigung der Revolution nach außen und innen, bestimmten die Moskauer Tage von Anfang an. Überall entstanden Fronten, überall wurde gekämpft, gehetzt, denunziert und gemordet. Zuerst kämpften Rote gegen Rote, nämlich die sich aufbäumenden Sozialrevolutionäre und Menschewisten, dann Rote gegen Weiße – ein unscharfer Sammelbegriff für alle nichtkommunistisch gesonnenen Kräfte –, dann Rote, aber auch Weiße gegen Grüne, nämlich die Bauern und das Dorf, wo sich der Umbruch trotz Sozialisierung, Enteignung und Landverteilung noch lange nicht durchgesetzt hatte, und schließlich Rote gegen die alliierten Interventionsarmeen aus England, Frankreich, den Vereinigten Staaten und der Tschechoslowakei. Als die Roten, die Bolschewisten, endlich gesiegt hatten, waren 16 Millionen Menschen – jeder zehnte Russe – tot, achtmal so viel, wie der gesamte Erste Weltkrieg an Opfern gefordert hatte, und das Land war nahezu vollständig verwüstet. Hunger, Armut, Diebstahl, Siechtum, Seuchen und Pest bestimmten den Alltag von Wyborg bis Wladiwostok.
Am 15. Januar 1918 wurde per Dekret die Rote Armee aus der Taufe gehoben – unter Trotzkis Führung und mit tausenden zaristischen Offizieren und Unterführern, zusammengerechnet mehr, als in allen weißen Armeen Dienst taten. Als sich im April das Eingreifen englischer und amerikanischer Verbände ankündigte, proklamierte Lenin in bemerkenswerter ideologischer Virtuosität die Kombination aus „russischem Kriegskommunismus“ und „deutschem Staatskapitalismus“, der „mit aller Kraft zu übernehmen“ sei, ohne „vor barbarischen Methoden des Kampfes gegen die Barbarei zurückzuschrecken“.7 Gleichzeitig leisteten in den Großstädten so genannte „Hauskomitees“ gnadenlose Umerziehungsarbeit. Wer nicht so wollte, wie er sollte, dem drohte die Einweisung in hastig errichtete „Besserungsanstalten“, aus denen binnen weniger Jahre ein Lagersystem erwuchs, das zu den finstersten Kapiteln in der Geschichte der zivilisierten Menschheit gehört.
Das Bürgertum floh in Scharen aus den Städten auf das Land. Vor allen Dingen in den Süden, sodass sich schon im Sommer 1918 an Wolga und Don ein regelrechtes „St. Petersburg in der Steppe“ gebildet hatte, von dem mit Freiwilligenarmeen die weiße Gegenbewegung ihren Ausgang nahm – in Tuchfühlung mit den Donkosaken, denen man am ehesten wirksamen militärischen Widerstand zutraute. Diese wiederum fanden wirkungsvolle Unterstützung durch die deutsche Heeresgruppe Süd, die in der Ukraine geblieben war. Aus dem Fernen Osten brach die gefürchtete Tschechoslowakische Legion gen Westen auf, mächtige, auf das Festland drängende japanische Verbände in der Hinterhand. Aus Angst, dass die nach Jekaterinburg am Ural zwangsumgesiedelte Zarenfamilie vom Feind befreit würde, gab Lenin den Befehl zu ihrer Liquidation. In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 wurden das Herrscherpaar, die vier Töchter, der bluterkranke Sohn, der Leibarzt und mehrere Bedienstete von einem Exekutionskommando hingerichtet. Die Leichen der Erschossenen verscharrte man an Ort und Stelle. Das wilde Grab wurde erst 1989 entdeckt und die Identität der Toten anhand der Knochenreste zweifelsfrei aufgeklärt.
Die Bolschewisten waren von überall her eingekreist. Erschwerend kam hinzu, dass auch der große ideologische Rivale noch nicht als überwunden gelten konnte und sich ein letztes Mal aufbäumte: Als Anfang Juli in Moskau der fünfte Allrussische Sowjetkongress zusammentrat, stellten die Sozialrevolutionäre immerhin noch 352 Delegierte gegenüber den 745 der Bolschewisten. Sogar in Dserschinskis Tscheka arbeiteten Sozialrevolutionäre mit, unter ihnen Maria Spiridonowa, die an der Ermordung des deutschen Botschafters Graf Mirbach beteiligt war. Zweck des Kommandounternehmens war es gewesen, einen diplomatischen Bruch zwischen Moskau und Berlin herbeizuführen und gleichzeitig sozialrevolutionäre Aufstände im ganzen Land anzustacheln, die auch tatsächlich in 23 Städten ausbrachen. Sie boten den neuen Machthabern den willkommenen Vorwand, praktisch alle sozialrevolutionären Kongressteilnehmer in der Lubjanka verschwinden zu lassen und über ein Dutzend standrechtlich zu erschießen. Die Reaktion folgte auf dem Fuße: Am 30. August richtete die Sozialrevolutionärin Dora Kaplan ihre Waffe auf Lenin, der blutüberströmt zusammenbrach, das Attentat aber überlebte.
Es war der letzte Auftritt der ideologischen Nebenbuhler auf der großen historischen Bühne. Vom Rat der Volkskommissare wurde das Dekret Über den roten Terror erlassen, das nur zu bald seine Wirkung zeigen sollte.
Die Beziehungen zu Berlin erlitten durch den Anschlag auf den Botschafter keinen Schaden, und erst als der sowjetische Bevollmächtigte in Berlin offen für die Revolution agitierte, wurde er des Landes verwiesen. Die junge Sowjetregierung war damit weltweit diplomatisch isoliert.
Nur wenige Tage später weigerten sich im fernen Kiel Marinesoldaten, zu einem Himmelfahrtskommando gen England auszulaufen und lösten dadurch die Revolution aus. Am 9. November dankten die Hohenzollern in Berlin und kurz darauf die Habsburger in Wien ab, der Erste Weltkrieg war für das Deutsche Reich und Österreich verloren. In welchen gesellschaftlichen und politischen Wandel würde die Niederlage einmünden? Würde Lenins Hoffnung auf die Fortsetzung seiner Revolution an der Spree nun Wirklichkeit werden? Könnte es gelingen, den bürgerlich-demokratischen Umbruch von Flensburg bis Klagenfurt in einen politischen Flächenbrand zu verwandeln?
Einstweilen waren das noch kühne Zukunftsträume. Noch standen die Tschechen im Osten, die Engländer im Norden, die Weißen im Süden und die Deutschen im Westen, in der Ukraine, und tagtäglich wurden die bolschewistischen Truppen durch Überläufer dezimiert, meist ehemalige zaristische Offiziere, die in Trotzkis Roter Armee nicht heimisch geworden waren. Schon im Frühherbst hatte der Gegner so viel Terrain zurückerobert, dass sich vom 8. bis zum 23. September die Vertreter der verschiedensten Parteien und Organisationen in Ufa, im tiefsten Baschkirien, zu einer Allrussischen Staatskonferenz zusammenfanden, um den weißen Gegenstaat auszurufen.
Der Bürgerkrieg rückte in sein entscheidendes Stadium. Es wurde immer deutlicher, dass die Entscheidung nicht im Zentrum, sondern an der Peripherie fallen würde, dass der Versorgungsfrage in dem erbärmlich hungernden Land eine kaum geringere Bedeutung zukam als den Waffengängen und dass Alliierte und Weiße daran gehindert werden mussten, ihren erdrückenden Ring um Moskau zu schließen, was sich im Süden und Osten bereits anbahnte. Eine Großstadt am Unterlauf der Wolga avancierte deshalb zum Brückenkopf, der um jeden Preis gehalten werden musste. Sie hieß damals noch Zarizyn, später jedoch Stalingrad, und derjenige, der mit dieser Mission beauftragt wurde, war Stalin. Als „Beauftragter für die Proviantbeschaffung“ mit beträchtlichen Sondervollmachten ausgestattet, eilte er nach Südrussland, und das gewünschte Ergebnis stellte sich bald ein. Umgeben von vierhundert Leibwächtern und mit Nadjeschda an seiner Seite hielt er Einzug in die Stadt, deckte eine Reihe angeblicher oder tatsächlicher Komplotte auf und ließ alle Beteiligten sofort hinrichten. Anweisungen der Zentrale, vorher sorgfältig zu recherchieren und zu ermitteln, blieben unbeachtet, und als ein Untergebener zu äußern wagte, dass ihm dieses Verhalten eines Tages sicher Schwierigkeiten bereiten würde, erhielt der Mann zur Antwort: „Der Tod löst alle Probleme: kein Mensch, kein Problem.“8 Dennoch oder vielleicht gerade deshalb, Stalin rettete Zarizyn vor der Besetzung durch die Weißen, und weil dies sein einziger sichtbarer Erfolg im Bürgerkrieg war, benannte er die Stadt fünf Jahre später, als längst die Heroisierung und Verfälschung des revolutionären Kampfes und der Kult um seine Person begonnen hatten, in Stalingrad um. Der Mythos von Stalingrad wurde also geboren, lange bevor die 6. Armee der deutschen Wehrmacht dort im Zweiten Weltkrieg unterging.
Der Sondereinsatz in Zarizyn bedeutete gleichzeitig den Auftakt zum Bruch mit Trotzki. Dieser hatte das Problem der Übernahme von Zarenoffizieren dadurch gelöst, dass er ihnen so genannte politische Kommissare als ideologische Aufpasser an die Seite stellte. Den Bolschewisten unter den Militärführern war dieses System von Anfang an suspekt, und einen solchen, General Woroschilow, ernannte Stalin eigenmächtig zum Befehlshaber des Heeresabschnitts Süd. Noch am selben Tag schrieb er an Lenin, dass „das Fehlen eines Papierchens von Trotzki mich natürlich nicht davon abhalten (wird)“.9 Woroschilow kannte er schon seit den Tagen in Baku, und Sergo Ordschonikidse, einen anderen alten Weggefährten, machte er zum politischen Kommissar. Beiden impfte er als erstes die Befehlsverweigerung gegenüber ehemaligen Offizieren des Zaren ein. Um endlich eine Entscheidung im Bürgerkrieg zu erzwingen, führte Trotzki die allgemeine Wehrpflicht wieder ein, mobilisierte die letzten Reserven und sprengte die Einheitsfront der Gegenregierung in Ufa. Der Held des Bürgerkrieges hieß also Trotzki. Am 4. Oktober kabelte er nach Moskau: „Ich bestehe kategorisch auf der Abberufung Stalins“10, doch nichts geschah. Lenin versuchte weiterhin, zwischen seinen beiden ungleichen Ziehsöhnen zu vermitteln, und ernannte den Georgier um die Jahreswende 1918/19 sogar zum Volkskommissar für Staatskontrolle, eine vorwiegend aus Spitzeltätigkeiten hinter der Front bestehende Aufgabe.
Der Sieg in Ufa bildete den Auftakt zu einer groß angelegten roten Offensive. Am 13. November erklärte die Sowjetregierung den Friedensvertrag von Brest-Litowsk für null und nichtig. Lenin entsandte seinen Revolutionseinpeitscher Karl Radek nach Berlin, mit dessen tatkräftiger Hilfe die Kommunistische Partei Deutschlands gegründet wurde. Am 5. Januar 1919 begann der Spartakusaufstand. In München übernahmen Räte die Macht, im Ruhrgebiet wurde eine Arbeiter- und Soldatenrepublik ausgerufen. Anfang Februar stand die Rote Armee vor der Grenze zu Ostpreußen. Radek frohlockte: „Der Ring der Völker ist schon nahezu geschlossen, es fehlt nur noch das wichtigste Glied, Deutschland.“11 Die große Frage war, ob Berlin fallen würde.
In Washington, London und Paris klingelten die Alarmglocken. Die Schreckensvision, dass sich die beiden Verlierer des Weltkrieges unter der roten Fahne vereinigen würden, drohte Wirklichkeit zu werden, weshalb in England ein junger Kriegsminister namens Winston Churchill den „Kreuzzug gegen den Bolschewismus“ proklamierte. Alliierte Geschwader liefen in das Weiße Meer vor Archangelsk, in den Finnischen Meerbusen und in das Schwarze Meer ein, die erneute Umklammerung des roten Russland stand bevor. Im Inneren holten die reorganisierten Kräfte der Weißen zum Gegenschlag aus. Schon im Sommer nahmen sie das Baltikum, scharten estnische, lettische und litauische Freiheitskämpfer um sich und marschierten im Oktober gen Petersburg, fest auf das Eingreifen der britischen Flotte vertrauend. Zu Unrecht, da sich die Westmächte zurückzogen. Die Offensive brach in sich zusammen und den Bolschewisten gelang der Durchbruch an allen Fronten. Die Ukraine, die größte Opfergabe von Brest-Litowsk, wurde bereits im Herbst 1919 zurückerobert, im Süden konnte das Bollwerk Zarizyn abermals gehalten und die Vereinigung der gegnerischen Heeresabschnitte verhindert werden. Im November wurde Omsk eingenommen, wohin die Regierung der Weißen geflüchtet war, und zum Schluss verschanzten sich nur noch auf der Halbinsel Krim Einheiten unter dem Kommando des Generals Wrangel. Ganz Russland bis zum Baikalsee war jetzt unter kommunistischer Herrschaft, das Gebiet östlich davon bis zum Pazifik kontrollierte allerdings nach wie vor Japan.
Mit dem Versailler Vertrag erlangte Polen, das über hundert Jahre als selbstständiger Staat von der Landkarte gelöscht war, seine Unabhängigkeit zurück. Marschall Pilsudski, der neue Machthaber in Warschau, erklärte sich jedoch von Anfang an mit der Grenzziehung im Osten nicht einverstanden, marschierte in die Ukraine ein und besetzte am 7. Mai 1920 Kiew. Wrangel, der Oberbefehlshaber der Weißgardisten in Südrussland und auf der Krim, nahm dies als Signal und setzte sich mit 70.000 Mann nach Norden in Bewegung. Sympathie wurde ihm von Seiten der Polen dafür aber nicht entgegengebracht. Im Gegenteil, er setzte damit sogar eher noch probolschewistische Emotionen frei. In dieser Situation startete Lenin den Gegenschlag. Im Norden stieß General Tuchatschewski tief bis nach Polen hinein, im Süden schnitt Budjonny Wrangels Truppen ab und warf die Polen über den Bug zurück. Trotzki warnte vor einem Marsch auf Warschau, an dem Lenin unvermindert festhielt, ja, er sollte sogar nur die Zwischenstation auf dem Weg nach Berlin sein. Ziel war die Verbindung der russischen mit der deutschen Revolution. Nicht zuletzt an Stalins Eingreifen sollte dies scheitern.
Dieser war im Herbst 1919 erneut an die Südfront entsandt worden. Als die Nachricht durchsickerte, dass Tuchatschewski schon die Vororte von Warschau erreicht hatte, bestand Stalin zum Entsetzen aller Fachleute und in Missachtung der Befehle aus dem Kreml auf der Einnahme Lembergs, die so viele Kräfte im tiefsten Süden Polens band, dass Pilsudski die sowjetischen Verbände nicht nur abwehren, sondern am 14. August 1920 im so genannten „Wunder an der Weichsel“ vernichtend schlagen konnte. Stalin wurde noch am selben Tag von seinem Kommando entbunden, nach Moskau zurückbeordert und zu Lebzeiten Lenins nicht wieder mit einer militärischen Aufgabe betraut. Im Frieden von Riga fand sich nicht nur die Unabhängigkeit der baltischen Staaten bestätigt, sondern es wurde auch die polnische Ostgrenze bis weit nach Weißrussland und in die Ukraine hinein verschoben. Sie blieb ein permanenter Zankapfel.
Letzter Brandherd war die ewig brodelnde Kaukasusregion. Dort hatten sich in Georgien, Armenien und Aserbaidschan mit seiner mächtigen Hauptstadt Baku formell unabhängige Staaten gebildet, die gemäß dem im Roten Oktober 1917 proklamierten Selbstbestimmungsrecht der Völker von der Sowjetregierung auch anerkannt worden waren. Jetzt, da an allen anderen Fronten Ruhe herrschte, wurde beim Moskauer Zentralkomitee ein so genanntes Kaukasus-Büro gegründet, das die Aufgabe hatte, über die kommunistischen Parteien dieser Länder Aufstände zu entfachen, die gegebenenfalls eine als „brüderliche Hilfe“ deklarierte Intervention der Roten Armee erforderlich machten und damit die nationale Selbstständigkeit dieser Staaten beenden sollten. Es lag aus biographischen Gründen nahe, dass Stalin in diese Angelegenheiten eingebunden wurde, was ihn nach fast einem Jahrzehnt offiziell auf „Inspektionsreise“ wieder in die Heimat führte.
Die Rückkehr des einstigen Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili nach Baku, von Ordschonikidse perfekt vorbereitet, wurde zum triumphalen Erfolg. In der Erklärung des örtlichen Zentralkomitees war wörtlich von „unserem geliebten Führer“12 Stalin die Rede. Dieser spottete in seiner Ansprache über das „rückständige Tiflis“13, die Stadt seiner Kindheit und Jugend, wo die bolschewistische Machtergreifung in der Tat nicht so recht vorankam. Armenien und Aserbaidschan waren zu dem Zeitpunkt, dem Dezember des Jahres 1920, bereits in abhängige Sowjetrepubliken umgewandelt, nur in der georgischen Metropole amtierte nach wie vor eine menschewistische Regierung, für deren Unabhängigkeit alle Sozialdemokraten der westlichen Welt in flammenden Appellen eintraten. Mitte Februar 1921 griff die Rote Armee an und nach zehntägigem, blutigem Kampf gab es Georgien als eigenständigen Staat nicht mehr.
Als Stalin im Sommer in Tiflis Einzug hielt, um an einem bolschewistischen Plenum teilzunehmen, glaubte er das Feld für sich bereitet, doch es kam anders: Der Georgier wurde von seinen ehemaligen Landsleuten als „Abtrünniger“ und „Verräter“ beschimpft, niedergeschrieen und angespuckt. Leibwächter der Tscheka mussten ihn aus dem Saal führen. Das, was als glorreiche Heimkehr gedacht war, wurde in dem skrupellosen Wandlungsprozess vom Georgier über den Bolschewisten bis hin zum großrussischen Chauvinisten zur entscheidenden Wendemarke.
Die mehr als ernüchternde Erfahrung von Tiflis beeinflusste die gesamte Organisation des künftigen Sowjetstaates, für die Stalin die verantwortliche Federführung übertragen werden sollte, nicht unerheblich. Unter dem Eindruck der katastrophal gescheiterten Versammlung verlangte er, „die Hydra des Nationalismus zu vernichten“.14 Lenin, der auf reale Ereignisse weit flexibler und intelligenter zu reagieren in der Lage war, wollte jetzt eine formell gleichberechtigte „Union Sozialistischer Sowjetrepubliken“, denn „eine Sache ist die Notwendigkeit, uns gegen die westlichen Imperialisten zusammenzuschließen, eine andere Sache ist es, wenn wir selbst (…) in imperialistische Beziehungen zu den unterdrückten Völkerschaften hineinschlittern“.15 Für Stalin hingegen stand es außer Zweifel, dass alle Sowjetrepubliken, gleich ob Russen oder Nicht-Russen, den Anordnungen aus Moskau diskussionslos Folge zu leisten hatten.
Ende 1922 mussten auf massiven amerikanischen Druck hin auch die Japaner das Festland verlassen. Die einzige noch bestehende weiße Gegenregierung im fernen Wladiwostok brach dadurch in sich zusammen. Alle äußeren und inneren Feinde waren besiegt, die Invasionstruppen aus dem Westen und dem Osten genauso wie die Zarentreuen, Großagrarier, Unternehmer und das reaktionäre Bürgertum im eigenen Lande. Der Bürgerkrieg schien zu Ende, aber jetzt, da der Frieden in greifbarer Nähe lag, begann das vielleicht schrecklichste Kapitel, die brutale Unterwerfung gerade derjenigen, mit denen man das neue, andere sozialistische Russland gestalten wollte: der Arbeiter und Bauern. Auf den nationalen Terror folgte der soziale.
Der Kriegskommunismus
Für den einfachen Mann und die einfache Frau war auch vier Jahre nach dem ruhmreichen Oktober von den Errungenschaften der Revolution noch wenig zu spüren. Im Gegenteil, die Lebensmittelrationen wurden immer weiter heruntergesetzt. In den Straßen von Petersburg tauchten Anfang 1921 die ersten Flugblätter mit menschewistischen Parolen auf, die Stadt wurde von einer Welle wilder Streiks erfasst. Auf der großen Insel im Delta der Newa, dort, wo die Industriearbeiter ihre Quartiere hatten und der Blick über das Meer bis hinauf nach Kronstadt geht, verschärften sich die Demonstrationen von Tag zu Tag, und es war schon mehr als ein Menetekel für den künftigen Sowjetstaat, dass ausgerechnet an der Stelle, an der sich im Oktober 1917 die radikalste Speerspitze der Revolution formiert hatte, jetzt das erste Kapitel jenes unendlichen Fortsetzungsromans Die Revolution entlässt ihre Kinder geschrieben wurde.
Als der Funke auf die Kronstadter Matrosen übersprang, bildeten diese in Windeseile ein „Provisorisches Revolutionskomitee“, das geheime Neuwahlen zu den Sowjets, Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit, gleiche Brotrationen für alle, Trennung von Partei- und öffentlichem Amt sowie die weitgehende Rücknahme von Verstaatlichungen und Enteignungen forderte. Auch wenn wortwörtlich die „Befreiung von der Gewaltherrschaft der Kommunisten“16 verlangt wurde, so konnte doch von einer Vorstufe zur bürgerlichen Demokratie keine Rede sein. Die Kronstadter wollten auch weiterhin das Rätesystem und vor allem sollten die Freiheiten nur für Arbeiter und Bauern gelten. Dennoch war den bolschewistischen Machthabern vom ersten Moment an klar, dass das Signal aus dem aufsässigen Kronstadt, wo Stalin bereits zwei Jahre zuvor 67 Offiziere wegen einer angeblichen Verschwörung kurzerhand hatte hinrichten lassen, ihr Herrschaftsmonopol im ganzen Land in Frage stellen würde. Trotzkis Tagesbefehl vom 5. März 1921 lautete deshalb, die Rebellen zu erschießen. Ein Zehntageskrieg setzte ein, in dem selbst ernannte gegen tatsächliche Arbeitervertreter, mithin Genossen gegen Genossen kämpften. General Tuchatschewski schickte seine Truppen im dichten Schneetreiben, mit weißen Hemden getarnt, auf Schlitten über das Eis, flankiert von Panzerbeschuss und Luftangriffen. Hinter den Rotarmisten lagen Maschinengewehreinheiten der Tscheka, die Zurückweichende niederzuschießen hatten. „Feldmarschall Trotzki“, wie ihn die Angegriffenen nannten, steigerte den Angriff zum Bombardement. Die Kronstadter sandten verzweifelte Funksprüche an die „Genossen Arbeiter“ der ganzen Welt, in der Hoffnung, gehört zu werden. Am 18. März war der Aufstand niedergeschlagen. Die Arbeiteropposition war ausgelöscht. Nachforschungen der russischen Generalstaatsanwaltschaft aus den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts ergaben, dass nach dem Niederschlagen der Rebellion noch über 2000 Menschen hingerichtet worden sind.17
Die eigentliche Schlacht im Inneren aber wurde gegen die Bauern geschlagen, die nach wie vor über achtzig Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten und größtenteils weder rot noch weiß waren. Das Dorf wurde von den neuen Kremlherren als Haftungsgemeinschaft behandelt, das man bei nicht erbrachten Abgaben, Rationen und Tributen kollektiv abstrafte, so wie zu Zeiten Peters des Großen. Eine weitere Eingriffsmöglichkeit brachte die Wiedereinführung der Wehrpflicht mit sich. Ihr entziehen konnten sich – wie zu allen Zeiten und in allen Systemen – nur die Söhne der Oberschicht. Die Dörfer hingegen sahen sich überfallartig umstellt, und wenn sie die geforderten Rekrutenkontingente nicht aufbrachten, kam es zu Geiselnahmen und Erschießungen. Ähnlich verfuhr man bei der Ablieferung der Getreiderationen. Im Grunde genommen blieben sich die Bauern und die Bolschewisten für immer fremd. Oft rückte die männliche Landjugend im Winter ein und desertierte im Sommer. Die Fahnenflüchtigen wurden gnadenlos gejagt und fanden Unterstützung durch mit Sensen und Sicheln bewaffnete Partisanen. In einem Tschekabericht vom Sommer 1919 heißt es: „Nachdem wir damit begonnen hatten, einen Mann pro Deserteursfamilie zu erschießen, kamen die Grünen aus den Wäldern und ergaben sich.“18
Ein Jahr später hatte die Regierung Lenin praktisch die Kontrolle über weite Teile des Landes verloren, das gesamte Terrain von der mittleren Wolga bis zum westlichen Sibirien war fest in den Händen von Grünen, wie der ländliche Widerstand genannt wurde. General Budjonny, gerade vom Vormarsch auf Warschau und dem Kampf gegen den äußeren Feind zurückgekehrt, begann daraufhin mit etlichen hunderttausend Soldaten, Reiterei, Artillerie und Flugzeugen einen brutalen Niederwerfungskrieg gegen die eigene Bevölkerung auf dem Land, in dem die vergleichsweise wohlhabenden Kosaken seit jeher eine besondere Rolle eingenommen hatten. Auch von Moskau wurde ihnen eine besondere ‚Behandlung‘ zugedacht. Bereits im Januar 1919 verabschiedete das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei eine Geheimresolution mit dem folgenden Wortlaut:
„Im Lichte der Erfahrungen des Bürgerkriegs gegen die Kosaken ist es notwendig anzuerkennen, dass die einzige politisch korrekte Maßnahme ein erbarmungsloser Kampf und massiver Terror gegen die reichen Kosaken ist, die vernichtet und physisch bis zum letzten Mann liquidiert werden müssen.“19
Dieses zum vielfachen Mord aufrufende Dokument ist erst seit 1989 zugänglich.
Allein durch die Unterwerfung der Bauern und die Enteignungen und Verstaatlichungen der Industrie, der Banken, der Handelsflotte, des Grund- und Hausbesitzes sowie aller Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten war noch keine kommunistische Wirtschaft entstanden, sondern ein nur schwer zu entwirrendes Geflecht aus militärischem Kommando, aus Mangelwirtschaft, Naturaltausch, Schwarzmarkt, Versorgungsdiktatur, Zwangseintreibung, Plünderung und Diebstahl. „An die Stelle attraktiver Abnahmepreise traten Bajonette, Requisition ersetzte den Markt.“20 Soziale Spannungen, auch zwischen Stadt und Land, waren die Folge. Das Geld als Wertäquivalent spielte keine Rolle mehr, die Inflation stieg auf über tausend Prozent, Rubelscheine wurden zum Feueranzünden verwendet. Da es die Grundnahrungsmittel wie auch Gas, Wasser, Strom, Post und Telefon gratis gab und Mietzahlungen abgeschafft waren, bestand auch gar kein Anreiz, etwas zu verdienen. Es herrschte so etwas wie eine „ökonomische Steinzeit“.21 Den Schwarzhändlern waren Tür und Tor geöffnet, und man schätzt, dass die Schattenmärkte im Bürgerkrieg bis zu siebzig Prozent aller Nahrungsmittel verteilten, wohlweislich und bewusst nie ernsthaft von der Staatsmacht beeinträchtigt.
Die Versorgungslage verschlechterte sich immer mehr, und im Winter 1921/22 brach die schlimmste Hungersnot aus, die Russland seit Menschengedenken erlebt hatte. Die Industrieproduktion sank auf nur noch ein Zehntel des Standes vor dem Weltkrieg ab, und die Arbeiter begannen der Partei davonzulaufen. Immer stärker setzte sich auch im Rat der Volkskommissare das Bewusstsein durch, dass es so, wie es war, einfach nicht mehr weiterging, und wieder war es Lenin, nicht Stalin, der das Steuer herumriss.